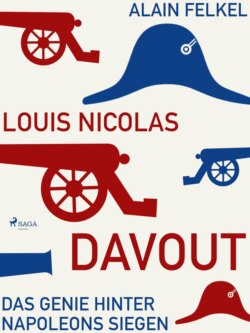Читать книгу Louis Nicolas Davout. Das Genie hinter Napoleons Siegen - Alain Felkel - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеSchauen Sie sich Davout an, wie er manövriert!
Er wird mir noch diese Schlacht gewinnen!
Napoleon zu den Marschällen Lannes und Masséna
am 22. April 1809 in der Schlacht bei Eckmühl
Der lange Trauerzug in Begleitung von 1500 Soldaten bahnte sich seinen Weg durch Paris, nachdem die letzten Worte der Totenmesse in der Kirche von Sainte-Valère beim Invalidendom verklungen waren. Die Spitze der andächtig schreitenden Kolonne bildete eine Abteilung Gendarmen, gefolgt von Musikern und Fahnenträgern des 43. und 59. Linienregiments, denen sich eine Abordnung von Veteranen der Napoleonischen Kriege anschloss. Hinter diesen rollte der Leichenwagen vorbei, auf dem der fahnengeschmückte Katafalk von Marschall Louis Nicolas Davout lag, der im Alter von 53 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben war. Als sich der Sarg auf Höhe der Invaliden befand, ging ein Ruck durch die Kriegskrüppel, die unter Davout in so vielen Schlachten siegreich gefochten hatten. Obwohl ein königliches Verbot ihnen den Besuch der Begräbnisfeierlichkeiten untersagte, waren sie trotz ihrer Behinderungen über die Mauer des Invalidenhospitals gestiegen und durch Gräben gekrochen, um Davout das letzte Geleit zu geben. Mit Tränen in den Augen salutierten sie, als der Leichenwagen an ihnen vorbei fuhr. Ein letztes Mal bewunderten sie das an den Zügeln geführte Schlachtpferd des Marschalls, dem vier Soldaten folgten. Diese trugen samtene Kissen, auf denen Davouts Orden gebettet waren; Ehrenzeichen jener blutigen Siege, welche die Invaliden am Straßenrand mit abgerissenen Gliedern, zerschmetterten Hüften und zerschlagenen Gesichtern bezahlt hatten. Hinter den Kissenträgern schritt die Familie, allen voran der erst zwölfjährige Sohn Davouts, Louis-Napoleon, einher. Dann gewahrten die Schaulustigen des Trauerzugs Marschälle, Generäle, Senatoren und Abgeordnete beider Regierungskammern, denen schweigend der Abgesandte des Königs folgte. Das Zugende bildeten die Musiker und Infanteristen des 20. Linienregiments sowie eine Abteilung Gendarmen.
Langsam wand sich der Trauerzug vom Invalidendom durch die Straßen von Paris zum Friedhof Père-Lachaise. Dort wurde der Marschall neben dem Grab seiner geliebten Tochter Josephine bestattet, während Marschall Jourdan, der Sieger von Fleurus, für seinen Kameraden eine halbstündige Grabrede hielt. Diese endete nach einem Abriss der Verdienste des Marschalls mit folgenden Worten:
Aber, meine Herren, ein großer Mann stirbt nicht ganz. Von unserem berühmten Marschall, dem Fürsten von Eckmühl, bleiben uns das Beispiel seiner Tugenden, die Erinnerung seiner großen Qualitäten und seine hervorragenden Dienste, die er dem Vaterland erwiesen hat ...1
Soweit die Worte des Marschalls Jourdan an jenem 4. Juni 1823, welche der damals weit verbreiteten Ansicht Ausdruck verliehen, dass der Mensch durch unsterblichen Ruhm zur Ewigkeit findet. Leider irrte sich Jourdan hinsichtlich Davouts. Das Andenken des Fürsten von Eckmühl – einer der Ehrentitel, die der Tote neben dem des »Herzogs von Auerstedt« trug – hat sich weder in der Geschichtswissenschaft noch im Bewusstsein der europäischen Völker eingegraben.
Als ich Anfang 2013 das Archiv des »Service Historique de la Défense« im Schloss von Vincennes aufsuchte, um mit der Aktenrecherche für mein Buch zu beginnen, stieß ich gleich bei meinen ersten Gehversuchen auf ein unerwartetes Hindernis. Nachdem ich mein Anliegen auf Französisch vorgetragen hatte, schockierte mich eine Bibliothekarin damit, dass sie den Gegenstand meiner Anfrage nicht kannte. Dieser Suchbegriff bestand aus sechs Buchstaben und las sich »Davout«.
Wäre ich auf der Straße, im Bistro oder in einem Pariser Restaurant gewesen, hätte mich diese Reaktion nicht weiter erstaunt. In einem kriegsgeschichtlichen Archiv, in dem Akten der Napoleonischen Kriege einen wesentlichen Bestandteil ausmachen, hatte ich dies jedoch nicht vermutet.
Doch es sollte noch besser kommen. Liebenswürdig wie meine Ansprechpartnerin war, bat sie einen weiteren Bibliothekar um Hilfe, der zuerst wissend nickte, als er erfuhr, um was es ging. Kurze Zeit später jedoch wirkte er ratlos. Eifrig bemüht, sich dies nicht anmerken zu lassen, blätterte er durch ein Findbuch.
»Wie, sagten Sie, hieß Ihr Marschall noch gleich?«, fragte er in beiläufiger Harmlosigkeit.
»Davout«, antwortete ich.
»Davout, Davout ... Davout, sagten Sie?«
»Ja«.
Es folgte eine gedankenschwere Pause, dann die Frage: »Welche Epoche ist das?«
Die Antwort, die ich ihm gab, liegt auf der Hand. Jetzt, da der genaue Zeitraum bekannt war, zeigte sich die Tüchtigkeit des Mannes, und es wurde das richtige Findbuch samt entsprechendem Eintrag sofort gefunden, sodass ich die Akten in den Lesesaal bestellen konnte.
Trotzdem gab mir der Vorfall zu denken. Während der Vorrecherchen in Deutschland hatte ich oft die Erfahrung gemacht, dass außerhalb eines engen Kreises von Historikern und auf die napoleonische Epoche spezialisierten Reenactern viele Menschen nichts mit dem Namen »Davout« anzufangen wussten. Doch stets hatte mich der Gedanke getröstet, dass dies in Frankreich anders sei.
Ich wurde eines Besseren belehrt. Die verhältnismäßig geringe Anzahl französischer Sachbuchpublikationen und Biografien über Davout ließ erahnen, wie schlecht es selbst westlich des Rheins um das öffentliche Gedenken an den Fürsten von Eckmühl bestellt ist. Abgesehen von zwei eher als Raritätenkabinette zu bezeichnenden Museen und einem Standbild in Auxerre erinnert nur noch ein 63 Meter hoher Leuchtturm an der bretonischen Küste an jenen Kriegshelden Frankreichs, der für kurze Zeit im Sommer 1815 das Schicksal der Grande Nation in den Händen hielt.
Noch heute gibt es in ganz Paris, das sonst mit Straßennamen französischer Schlachtenerfolge nicht eben geizt, weder eine Straße oder Brücke noch einen Platz, der an den Sieg Davouts bei Auerstedt erinnert. Nicht einmal der Triumphbogen, jener für die Ewigkeit gebaute Siegestempel, weist den Namen Auerstedt auf. Dass dies so ist, liegt an Napoleon Bonaparte. Beständig wob er noch zu Lebzeiten dank kaiserlicher Bulletins, Moniteur-Artikeln und Memoiren an der eigenen Übermenschenlegende.
Als besonders zäh erwies sich damals wie heute der napoleonische Mythos vom unbesiegbaren Schlachtengott, den nur eigene Krankheit, Naturkatastrophen, feindliche Übermacht oder die Unfähigkeit der eigenen Marschälle besiegen konnten. Doch der Kaiser war als Feldherr nicht unfehlbar, wie seine Niederlagen in den Schlachten von Aspern-Essling, Leipzig und Waterloo sowie der gescheiterte Russlandfeldzug beweisen.
Es ist keine Frage, dass Napoleon eine der wichtigsten historischen Persönlichkeiten der Neuzeit und einer der bedeutendsten Strategen der Kriegsgeschichte ist. Mehr als ein Jahrhundert vor Hitler erfand er den Blitzkrieg, die alles umfassende Operation, deren Zielsetzung nicht das Gewinnen einzelner Schlachten, sondern die Vernichtung der feindlichen Armee innerhalb weniger Wochen war. Seine Feldzugspläne waren kühn, die Schnelligkeit seiner Manöver atemberaubend.
Und trotzdem: Der Nimbus des unbezwingbaren Kaisers war selbst in seinen siegreichen Jahren nicht in allererster Linie das Produkt seines Feldherrngenies, sondern seines propagandistischen Talents.
Geschickt wurden Beinahe-Katastrophen – wie der im Jahr 1799 gescheiterte Feldzug nach Syrien – zu Erfolgen umgedeutet. Skrupellos schrieb sich Napoleon wie im Fall der Schlacht von Marengo die Siege anderer zu oder redete deren Triumphe klein. Mit Stillschweigen überging er eigene Irrtümer. Im Fall des Russlandfeldzugs lastete er seinen Generälen und Marschällen jene Misserfolge an, die er selbst zu verantworten hatte. Schon Napoleons größter Rivale, der republikanische General Moreau, wusste um dessen größte Schwäche und urteilte im Jahr 1800 treffend über ihn:
Was die Entwicklung von Plänen, die Leitung großer Militäroperationen und die Kriegspolitik anbetrifft, ist er unser aller Meister. Was aber die methodische Kriegsführung auf einem abgesteckten Kriegsschauplatz oder ein Schachspiel angeht, verhält es sich anders; hier glaube ich, ihm überlegen zu sein.2
Die Schachspiel-Metapher von Napoleons Rivalen wirkt auf den ersten Blick etwas bemüht, doch sie trifft den Kern des Problems: Denn als Stratege war Napoleon kaum zu schlagen, aber als Taktiker hatte er seine Schwächen. Es ist ein Fakt, dass Napoleon sich 1805 in Böhmen in eine äußerst prekäre Lage manövriert hatte und während des polnischen Feldzugs von 1807 mehrfach auf eine sichere Niederlage zusteuerte. Dass er dieser jedes Mal entging, verdankte er den Fehlern seiner Kontrahenten, der außerordentlichen Tapferkeit seiner Soldaten und dem taktischen Geschick seiner Marschälle.
Zu ihnen zählte Davout, ein prinzipientreuer Mann, der zu Beginn der Offizierslaufbahn Anführer einer der ersten Truppenmeutereien der Revolutionszeit gewesen war. Während des 1. Koalitionskriegs von 1792–1797 hatte er sich zum Brigadegeneral hochgedient, dann am Ägyptenfeldzug Napoleons teilgenommen. Obwohl der Feldzug scheiterte, hatte Davout Glück. Zurück in Frankreich stieg er unter Napoleon vom Brigadegeneral zum jüngsten Marschall Frankreichs auf. Bald rechtfertigte er das Vertrauen, das der Kaiser in ihn gesetzt hatte.
Durch Davouts taktisches Geschick gewann Napoleon die Schlachten von Austerlitz, Eylau, Eckmühl und Wagram. Mit seinem entscheidenden Triumph bei Auerstedt über die Hauptarmee der Preußen stellte der junge Marschall sogar seinen Kaiser in den Schatten, der am selben Tag bei Jena die Preußen schlug.
Was den Russlandfeldzug anbetrifft, so kam Davout beim Vormarsch und beim Rückzug eine tragende Rolle zu. Das Debakel dieses Feldzugs wäre vielleicht vermieden worden, hätten alle Marschälle ein so vorbildlich gerüstetes Armeekorps wie Davout gehabt und wäre er mit seinen strategischen Vorstellungen beim Kaiser erfolgreich gewesen. Doch das Gegenteil war der Fall. Der Marschall fiel während des Russlandfeldzugs beim Kaiser in Ungnade. Der Bruch mit Davout beraubte Napoleon seines fähigsten Offiziers. Der Kaiser detachierte den Fürsten von Eckmühl nach Norddeutschland, um Hamburg zu verteidigen, wo sich der diskreditierte Feldherr erneut auszeichnete.
Aber Davout war nicht nur ein hervorragender General, sondern auch ein großartiger Verwalter der besetzten Gebiete. Mehr fach bekleidete er das Amt eines Militärgouverneurs: 1807/1808 in Polen, 1810–1812 und 1813/1814 in Deutschland, bevor er 1815 während der »Hundert Tage« Kriegsminister wurde. Mit dieser Ernennung trug Napoleon einer weiteren Stärke des Marschalls Rechnung: der Fähigkeit Davouts, einen Feldzug logistisch vorzubereiten.
Historische Bedeutung erwarb der Fürst von Eckmühl jedoch nicht nur durch seine kriegerischen Tugenden, sondern auch dadurch, dass er sich in den Tagen nach Waterloo gegen Napoleon stellte und diesen dazu nötigte, Frankreich zu verlassen. Wenig später schloss er unter der Bedingung einer Generalamnestie für alle Soldaten und Offiziere, die Napoleon gefolgt waren, einen Waffenstillstand mit den Alliierten, der die Kampfhandlungen abschloss. Damit ermöglichte Davout trotz persönlicher Antipathie gegen die Bourbonendynastie die Rückkehr König Ludwigs XVIII. an die Macht und beendete einen Weltkrieg, der, von einigen kurzen Unterbrechungen abgesehen, 23 Jahre gedauert hatte.
Anschließend führte er die Reste der kaiserlichen Armee über die Loire, wo sich das Heer auflöste. Kurz darauf trat Davout vom Amt des Kriegsministers zurück und schied aus der Armee aus.
Diese Tat wurde von vielen Zeitgenossen als Verrat gewertet und fand nicht den Beifall der Öffentlichkeit. Zumal sie von einem Mann ausging, der für seinen Jähzorn und seine angebliche Neigung zur Grausamkeit nicht nur in der französischen Armee, sondern auch in Deutschland berüchtigt war.
Dort hatte sich während der Belagerung von Hamburg eine schwarze Legende verbreitet, die Davout zum Henker Hamburgs stilisierte, der aus nichtigem Grund Hunderte erschießen ließ. Diese Behauptungen sind hinsichtlich ihrer Monstrosität grotesk, knüpfen jedoch daran an, dass Davout während der Hamburger Belagerung einige wenige Todesurteile vollstrecken ließ. Sicher trug zu seinem Negativimage bei, dass er in der französischen Armee wegen seines Hangs zu drakonischen Maßnahmen gefürchtet war.
Gemäß seinem selbstgewählten Motto »Justum et tenacem« (»Hart, aber gerecht«) konnte die Prinzipientreue des Marschalls durch seine Unerbittlichkeit bisweilen grausame Züge annehmen. Wenn es sein musste, ließ er überführte Mörder, Plünderer, Marodeure, Vergewaltiger und vermeintliche Spione sofort vor das Standgericht stellen und erschießen. Sicher war er nicht der einzige unter Napoleons Marschällen, der dies tat, doch der konsequenteste in der Anwendung jenes Strafmaßes. Und vor allem unternahm er nichts dagegen, dass ihn die Gräuelpropaganda der Alliierten als zweiten Herzog von Alba schilderte, der im 16. Jahrhundert während des Freiheitskampfes der Niederlande ganze Landstriche der Halsgerichtsbarkeit unterzogen haben soll. Populärhistoriker wie Bleibtreu trieben die Kolportage sogar so weit, Davout die Erschießung des Buchhändlers Palm anzudichten, obwohl diese auf Veranlassung Napoleons von Davouts Intimfeind Berthier befohlen worden war.
Betrachtet man das Ausmaß der damals üblichen Kriegsgräuel an der Zivilbevölkerung, so verwundert es jedoch, dass es unter Davout, abgesehen vom Ägyptenfeldzug, kaum zu Übergriffen kam. Diejenigen, die den Marschall am meisten zu fürchten hatten, waren seine eigenen Soldaten, nicht die Unterworfenen.
Doch Verleumdungen und Vorurteile sind hartnäckig. Bis heute verzerren sie das Bild eines der redlichsten Marschälle des Empire. Mit Recht moniert Stendhal in seinen »Denkwürdigkeiten über Napoleon«, dass der Marschall der am meisten missverstandene Charakter der napoleonischen Epoche sei und in seiner historischen Bedeutung völlig unterschätzt werde.
Dies hat sich bis heute kaum geändert, wie allein die Anzahl der Publikationen über ihn beweist. Bücher über Napoleon sind Legion, Abhandlungen über den Marschall gibt es nur wenige.
Aus der Feder des Marschalls selbst existieren drei Hauptwerke, das »Journal des Opérations du 3e Corps«, die Verteidigungsschrift »Mémoire de Mr. Le Maréchal Davout au Roi« und die bei Vigier abgedruckte Version eines handgeschriebenen Memoirenfragments »Souvenirs du Maréchal Prince D’Eckmühl sur les Cent Jours«. Darüber hinaus befinden sich in den Archiven Frankreichs unzählige Briefe Davouts an seine Frau, Napoleon und diverse Dienststellen.
Von den im 19. Jahrhundert verfassten Biografien zeichnen sich die Bücher von Chenier, Joly und Vigier durch detailreiche Kenntnis der Originalquellen aus. Die vierbändige Biografie der Tochter des Marschalls, Adélaïde-Louise, Princesse d’Eckmühl et Marquise de Blocqueville, stammt aus den Jahren 1879/1880. Sie besteht aus bis dahin unveröffentlichtem Quellenmaterial – zumeist Briefe – aus dem Nachlass des Marschalls.
In den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts erschienen gleich drei Buchpublikationen auf dem Markt. »The Iron Marshal« von John J. Gallaher (die einzige englische Biografie über den Marschall), »Davout le terrible« von François-Guy Hourtoulle und die gründliche Studie »Davout et l’Art de la guerre« von Daniel Reichel. Letztere ist, anders als der Titel vermuten lässt, nicht eine bloße Studie zu den Taktikgrundsätzen des Marschalls, sondern enthält auch viele biografische Informationen zum Werdegang Davouts. Bei den zu Beginn dieses Jahrhunderts veröffentlichten Büchern Frédéric Hulots und Pierre Charriers handelt es sich bei ersterem Werk um ein populäres Sachbuch, bei letzterem um ein zur Polemik neigendes Porträt mit wissenschaftlichem Anspruch.
Was Deutschland anbetrifft, existiert bis zum heutigen Tag keine einzige deutsche Biografie.
Das vorliegende Buch basiert in erster Linie auf dem Studium oben genannter biografischer Sekundärliteratur und der Auswertung von Akten- und Briefsammlungen. Zwecks Quellenstudium begab sich der Autor ins »Service Historique de la Défense« des französischen Verteidigungsministeriums. Darüber hinaus kamen kontextbezogen Memoiren und Briefe beteiligter Zeitzeugen Davouts und themenrelevante Sekundärliteratur zur Verwendung.
Was die Gliederung des Buches anbetrifft, möchte ich dem Leser kurz erläutern, welche Erzählstrategie ich angewandt habe.
Manche Biografen neigen dazu, die Geschichte ihres Protagonisten in die ordnenden Bahnen einer Chronologie zu lenken, die vom ersten Geburtsschrei bis zum letzten Todesseufzer zur Ordnungsmaxime wird. Diese Vorgehensweise erschien mir jedoch angesichts des Ereignisreichtums von Davouts Leben als unangemessen.
Diese Biografie ist anders strukturiert. Sie verfolgt einen fiktionalen Erzählansatz. Und so beginnt dieses Buch nicht im Jahr 1770, sondern 1815, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Davout und dem Kaiser, um in einen Rückblick zu münden, der das Leben des Marschalls erzählt.
Es ist der Versuch der Rehabilitation eines Verkannten, der viel zu lange von der historischen Zunft als Nachtschattengewächs Napoleons wahrgenommen wurde; ein Abenteuerroman der Geschichte, der nicht erfunden werden musste, weil er auf Fakten beruht.