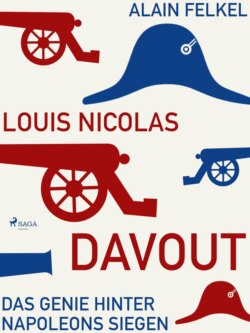Читать книгу Louis Nicolas Davout. Das Genie hinter Napoleons Siegen - Alain Felkel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II Vom Kadetten des Königs zum Revolutionsgeneral
Оглавление»Wenn ein D’Avoust der Wiege entsteigt, wird ein Schwert aus der Scheide gezogen.«
Burgundisches Sprichwort
Am 7. Mai 1770 wurde in der Geschichte des Königreichs Frankreich und Österreichs ein neues Kapitel aufgeschlagen. In Reichweite der kaiserlichen Festung Kehl gegenüber dem französischen Straßburg steuerten mehrere festlich geschmückte Kähne eine unbewohnte Rheininsel an, die im Niemandsland zwischen beiden Mächten lag.
Anmutig setzte ein blauäugiges, weißgepudertes Mädchen von 14 Jahren seine Füße auf den Boden der Insel und ging, begleitet von ihren Höflingen, auf einen Pavillon zu, dessen Holzwände kostbare Stofftapeten mit allegorischen Darstellungen schmückten. Dieser Pavillon war zweigeteilt. Die östliche Hälfte symbolisierte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, der Tisch in der Mitte markierte die Grenze und die westliche Hälfte des kleinen Saals verkörperte das Königreich Frankreich.
Jetzt kam der wichtigste Teil der Prozedur und der schamhafteste Akt für die Vierzehnjährige. Unter den Augen der Zeremonienmeister schritt die junge Habsburgerin andächtig zu dem Tisch in der Saalmitte und entledigte sich ihrer Kleider, bis sie ganz nackt war. Dann überschritt sie zitternd die symbolische Grenze zwischen Frankreich und dem Reich und ging in den anderen Trakt, wo sie sofort nach französischer Mode neu eingekleidet wurde. Nun erst war dem Protokoll Genüge getan, konnte sich die junge Österreicherin nach Salischem Recht10 als Braut des zukünftigen Königs Ludwig XVI. von Frankreich betrachten, den sie in einer Woche treffen sollte.
An jenem 7. Mai 1770 hatte Marie Antoinette von Habsburg den Ritualtod erlitten, um als Thronfolgerin und spätere Königin Frankreichs wiedergeboren zu werden.
Der Zufall wollte es, dass in derselben Woche, in der dieser wunderliche Akt geschah, ein Junge im burgundischen Dorf Annoux geboren wurde, der einst ein großer Feind des Reiches werden sollte: Louis Nicolas Davout.
Seine Mutter, Françoise-Adélaïde Davout, war eine geborene Minard de Velars, sein Vater, Chevalier Jean François D’Avoust, trug den Titel eines Junkers und stammte aus uraltem burgundischem Adel. Zum Zeitpunkt der Geburt ihres ersten Sohnes bewohnten beide zusammen ein ärmliches Landhaus, das Jean François D’Avoust von seinem kargen Sold angemietet hatte, den er als Leutnant im Kavallerieregiment La Rochefoucault bekam.
Eins nämlich war allen D’Avot, Davo, Davoust, Davoult, D’Avoust, D’Avout oder Davout11, wie sie im Lauf der Jahrhunderte geschrieben wurden, gemeinsam: die Vorliebe für das Waffenhandwerk und den Soldatenstand. Aus dem Tale Avot in Burgund stammend, hatten Generationen dieser kriegerischen Familie erst unter dem Andreaskreuz der Burgunderherzöge, dann unter dem Lilienbanner Frankreichs gekämpft. Zu Reichtum waren die wenigsten dieser streitbaren Sippe gelangt.
In dieser Hinsicht bildete Jean François D’Avoust12 keine Ausnahme. Zeitzeugen beschrieben ihn als schmuck, tapfer und von untadeligem Benehmen, aber mit dem Makel behaftet, arm zu sein. Wie bedeutend dieser Mangel an Eigentum und Besitz in einer ständischen Gesellschaft wie der des 18. Jahrhunderts sein konnte, zeigt ein Bericht über die Eignung von Nachwuchsoffizieren, die 1764 verfasst wurde. Hier heißt es über Jean François D’Avoust lapidar: »Sehr gutes Subjekt, sehr fleißig, er ist guter Abstammung und hat den Eifer, nützlich zu sein, er hat kein Vermögen«.13
Daran änderte sich auch durch die Heirat mit Françoise-Adélaïde de Minard nichts. Entgegen den Gepflogenheiten des Jahrhunderts hatten beide 1768 aus Liebe und nicht aus materieller Berechnung geheiratet, was die Mutter der Braut nicht guthieß. Aber die bildhübsche, energische Françoise-Adélaïde hatte es verstanden, sich gegen den Willen ihrer Mutter durchzusetzen, die in der Verbindung mit einem mittellosen Offizier eine klassische Mesalliance sah. Indes, die anfängliche Abneigung von Davouts Schwiegermutter legte sich bald, als sie sah, dass sich ihr Schwiegersohn rührend um ihre Tochter und sein Kind kümmerte, wann immer es ihm sein Dienst ermöglichte.
Die junge Familie blieb nur kurze Zeit in Annoux und zog Ende 1770 nach Étivey bei Avallon, wo die Mutter von Françoise-Adélaïde wohnte. Dort brachte die junge Mutter drei weitere Kinder zur Welt: Julie (1771), Louis Alexandre Edme François (1773) und Isidore Louis Charles (1774). Das Leben der Davouts schien unbeschwert, als am 26. Dezember 1778 eine schreckliche Tragödie über die Familie hereinbrach.
Der Schicksalsschlag ereignete sich, als Jean François D’Avoust an einer Treibjagd auf Wildschweine teilnahm. Während die Treiber das Wild durch den Wald hetzten, löste sich aus der Flinte eines Jägers ein Schuss und verletzte den jungen Familienvater schwer im Unterbauch. Zwar gelang es, den Junker noch in ein nah gelegenes Hospital zu bringen und ihn vorläufig zu stabilisieren, aber den Ärzten wurde nach mehreren Operationen bald klar, dass Jean François D’Avoust nicht zu retten war. Am 3. März 1779 schloss der Leutnant nach mehrwöchigem Todeskampf für immer die Augen. Er hinterließ eine verzweifelte Frau mit vier kleinen Kindern.
Françoise-Adélaïde wusste vor Trauer weder ein noch aus. Wie sollte sie sich und ihre Zöglinge durchbringen? Zum persönlichen Schmerz um den Verlust des geliebten Mannes gesellten sich Geldprobleme: 372 Pfund schuldete sie den Chirurgen des Hospitals, 66 Pfund dem Apotheker, 180 Pfund für die Trauerfeierlichkeiten.
Die Not war groß und wurde einzig durch den Umstand gelindert, dass ihre Mutter Mme. de Velars sich vorerst um die Erziehung ihrer Kinder kümmerte und Louis Nicolas bei einer renommierten Privatlehrerin namens Mme. Moreau anmeldete.
Diese Maßnahme, die als Vorbereitung auf den Besuch einer höheren Schule gedacht war, wurde ein Fehlschlag.
Der Neunjährige erwies sich nicht als besonders gelehrig und machte vor allem in Latein wenig Fortschritte. Die Lektionen von Mme. Moreau langweilten den Knaben. Stattdessen spielte Davout in jeder freien Minute lieber mit seinen Mitschülern Krieg.
Bei diesen Spielen, die er meistens auch anführte, bewies er unermüdlichen Eifer und ließ keinen über seinen Berufswunsch im Zweifel. »Wenn ich groß bin, werde ich die Köpfe der Feinde mit einem großen Säbel abschlagen«, hörte man ihn oft sagen, worauf Mme. Moreau stets resigniert erwiderte, dass er wohl nur zum Offizier tauge.
Zu diesem Zeitpunkt ahnten weder Mme. Moreau noch der kleine Louis, dass seine kindlichen Fantasien nur drei Monate später einen entscheidenden Anschub erfahren sollten. Von der Situation überfordert, hatte Françoise-Adélaïde D’Avoust ihren ältesten Sohn Louis Nicolas in der Militärschule von Auxerre-Sur-Yonne angemeldet, wodurch sich ihre finanzielle Lage etwas enspannte. Dank einer Maßnahme des Kriegsministeriums, das den niederen Adel der Provinz für die Armee begeistern wollte, wurde der Schulbesuch mit einem Stipendium gefördert. Françoise-Adélaïde konnte sich glücklich schätzen. Ihr Glück bestand nicht nur darin, für ihren Sohn einen der heiß umkämpften Plätze an der Militärschule ergattert zu haben. Vielmehr zählte, dass sie die Unterbringung ihres Sohnes sowie dessen Unterricht und Verpflegung nichts kostete. Um dem jungen Kadetten den Schulbesuch zu ermöglichen, bewilligte ihm das Kriegsministerium eine Pension von 1100 Pfund jährlich, was deutlich über dem Durchschnitt lag. Normalerweise betrug die Höhe der Jahrespensionen für den Besuch der Militärschule in Auxerre 700 Pfund. Aber dies war nicht der einzige Geldsegen, der über das leidgeprüfte Haus der Davouts hereinbrach. Gegen Ende des Jahres 1779 genehmigte der König Françoise-Adélaïde eine Witwenrente von 200 Pfund jährlich, was ihre Existenz absicherte. Zur gleichen Zeit gelang es der jungen Witwe, ihre Tochter Julie in einer Mädchenschule unterzubringen und für den Schulbesuch ihres Sohnes Alexandre ebenfalls ein Stipendium zu erlangen. Was ihren jüngsten Sohn Charles anbetrifft, so brachte sie ihn bei einem Regimentskameraden ihres Vaters, einem gewissen M. d’Hargicourt unter. Jetzt, nachdem sie die Erziehung und Zukunft ihrer Kinder abgesichert hatte, konnte die junge Mutter endlich aufatmen.
Zu Beginn des Jahres 1780 betrat der »Cadet gentilhomme« Louis Nicolas Davout in einer blauen Uniform mit roten Aufschlägen und weißen Knöpfen das alte Jesuitenkollegium von Amyot, die Militärschule von Auxerre. Diese wurde von Benediktinern geleitet und war erst 1776 gegründet worden. Die Militärschule von Auxerre war Baustein eines umfassenden Reformprogramms, das die Ausbildung des französischen Offizierskorps von Grund auf zu erneuern trachtete. Die schweren Niederlagen des Siebenjährigen Krieges hatten die taktischen Schwächen und das strategische Unwissen vieler französischer Offiziere offenbart, die das Schlachtfeld für einen besseren Exerzierplatz hielten. Katastrophale Niederlagen wie die Schlachten von Rossbach (1757) und Minden (1759) hatten den guten Ruf der einst gefürchteten französischen Armee schwer erschüttert.
Mit der Reform von 1776 hoffte das Kriegsministerium, dies zu ändern. Zu diesem Zweck wurde ein Dutzend Militärschulen gegründet, die ihre Standorte in der Provinz hatten. Mit dieser Maßnahme sollte vor allem der niedere Landadel, dessen Angehörige oft zu arm waren, um Offizier zu werden, mithilfe von Pensionen die Chance erhalten, die Offizierslaufbahn einzuschlagen.
In dieser Hinsicht hatte der Besuch des Militärkollegs die Funktion, dem Schüler eine solide Allgemeinbildung und militärische Werte wie Disziplin und Standhaftigkeit zu vermitteln. Die Lehrer dieser Kollegien waren in Ermangelung geeigneter Pädagogen keine Offiziere, sondern erfahrene Geistliche, die klassische Lehrfächer wie Latein, Mathematik, Englisch und sogar Fechten unterrichteten. Hatten die Schüler sich nach fünf Jahren Schulunterricht bewährt, entschied ein Auswahlverfahren darüber, ob sie in Paris die École Royale Militaire, das West Point des Ancien Régime, besuchen durften.
Dass ausgerechnet Davout sämtliche Instanzen dieser Einrichtung erfolgreich durchlaufen würde, schien zu Beginn des Jahres 1780 noch völlig undenkbar. Der Neunjährige tat sich mit der strengen Disziplin im Militärkolleg äußerst schwer und kam mit dem Erziehungskonzept der Benediktiner nicht zurecht. Er störte oft den Unterricht und glänzte eher als Raufbold denn als Musterschüler. Dies ging sogar so weit, dass er eines Tages einem Mitschüler vorschlug, ihn bei den tagtäglichen Schulhofschlägereien zu beschützen, falls dieser für ihn lästige Hausaufgaben erledigte.
In einem Brief aus dem Jahre 1807 meinte Davouts Mutter rückblickend, dass ihr Sohn während seiner Kindheit dafür bekannt gewesen sei, mit äußerster Kaltblütigkeit für viel Lärm zu sorgen. Diese und andere Eigenschaften – der Hang zur Provokation und Rebellion sowie eine außergewöhnliche Nervenstärke – sollten sich im Lauf der Jahre zu seinen Hauptcharakterzügen entwickeln.
Aber noch etwas anderes zeigte sich in diesen prägenden Jahren: sein Hang zu den Kriegskünsten sowie seine hohe analytische Begabung. Während er überhaupt keine Neigung zu Latein zeigte und in Deutsch versagte, war er ein guter Fechter und erbrachte unter der Anleitung des Pädagogen Dom Laporte in Algebra und Geometrie ausschließlich exzellente Leistungen.
Wie es schien, erreichte dieser hervorragende Lehrer, dass der Klassenrabauke langsam Interesse am Unterrichtsstoff entwickelte. Dies lag zum einen an seiner einfühlsamen Pädagogik, zum anderen an seinem Charisma. Dom Laporte war nicht ausschließlich Pädagoge und Geistesmensch wie seine Lehrerkollegen, sondern auch ein hervorragender Sportsmann mit gewaltiger Körperkraft. Sein Lieblingssport war Ringen. In dieser Disziplin erreichte Dom Laporte eine derartige Meisterschaft, dass ein Schausteller es auf dem Jahrmarkt mit der Angst zu tun bekam, als der Geistliche ihm anbot, einen Schaukampf gegen seinen Tanzbären zu machen. Statt sich auf die Urkraft seines Untiers zu verlassen, zog es der Bärenführer vor, die Flucht zu ergreifen. Augenscheinlich hatte er von Dom Laportes Ringkünsten gehört und Angst bekommen, dass dieser seinen Tanzbären schwer verletzen und somit seine Existenz ruinieren könnte.
Erzählungen wie diese waren natürlich dazu angetan, den Schüler Louis Nicolas für Dom Laporte zu begeistern. Davout legte sich ins Zeug. Fast wäre er sogar bei einer Schulfeier mit einem Preis in Mathematik ausgezeichnet worden, hätten ihm nicht zwei seiner Charakterschwächen einen üblen Streich gespielt, die ihm während seines Lebens noch oft schaden sollten: krankhafter Argwohn und sein Hang zum Jähzorn.
Folgendes war passiert: Beim alljährlichen Abschlussfest seiner Schule hatte Louis, in der Annahme, bei der Preisverleihung unfairerweise übergangen worden zu sein, aus Rache die Birnenbäume seiner Lehrer verwüstet und war dabei von Dom Laporte erwischt worden.
Doch es kam noch schlimmer. Nachdem Dom Laporte dem Wüterich vor versammelter Schule seine Verfehlungen vorgehalten hatte, erhielt Louis den Preis nicht, den man ihm ursprünglich zugedacht hatte. Es war eine peinliche Situation, an die sich Davout noch Jahrzehnte später erinnerte.
Von nun an änderte sich Davouts Wesen. Der einstige Problemschüler tat alles, um die Scharte auszuwetzen, und brachte bis zum Ende seines Aufenthalts in Auxerre gute Leistungen. Trotzdem hätte er sich nie für die École Royale Militaire von Paris qualifiziert, wenn sein Onkel Jean Edme Davout sich nicht für ihn verwendet hätte. Dieser nutzte seine guten Beziehungen zum stellvertretenden Generalinspekteur der Militärschulen und verschaffte seinem Neffen im Handumdrehen den heiß begehrten Platz. Klüngeleien wie diese waren im Ancien Régime an der Tagesordnung und der Türöffner für so manche Karriere.
Mit der Reise nach Paris öffnet sich für das Halbwaisenkind aus der Provinz das Tor zur großen weiten Welt. Wie muss der Junge gestaunt haben, als er zum ersten Mal die von 5000 Straßenlaternen beleuchtete Metropole mit ihren gepflasterten Straßen, luxuriösen Karossen und dem Königspalast sah. Wie wird er innerlich gejubelt haben, als er seine neue Schule, die »École Royale Militaire de Paris«, entdeckte, die ein junger Korse namens Napoleon Bonaparte erst einen Monat zuvor mit seinem Offizierspatent verlassen hatte.
Die Akademie, die für weitere zwei Jahre sein Heim werden sollte, glich in keinster Weise dem Militärkolleg von Auxerre, sondern einem königlichen Lustschloss. Eine große Allee führte durch einen gepflegten Park auf das Portal des Haupthauses, ausladende Seitenflügel verliehen dem Gebäude Grandeur. Was jedoch auf den ersten Blick wie ein Paradies anmutete, erwies sich schnell als goldener Käfig. Architektonisch ein Prachtbau, wehte in diesen scheinbar so glanzvollen Mauern der eisige Wind schneidender Kommandos und die moralische Sittenstrenge klösterlichen Lebens.
Von Montag bis Samstag wurden die Zellen der Kadetten pünktlich morgens um halb sechs aufgeschlossen, damit sie sich waschen konnten. Dann gingen die Offiziersanwärter gemeinsam zur Messe, bevor sie sich zum Uniformappell sammelten. War diese allmorgendliche Prozedur überstanden, begannen nach einem kräftigen Frühstück um 7 Uhr morgens die Kurse. Klassische Unterrichtsfächer wie Geschichte, Geografie, Englisch, Deutsch und Mathematik wechselten sich mit Fächern wie Festungsbau, Exerzieren, Schießen, Fechten, Reiten ab.
Darüber hinaus wurden die Zöglinge der École Royale Militaire im öffentlichen Recht unterwiesen und bekamen Tanzstunden. Schließlich musste ein Offizier auch bei gesellschaftlichen Anlässen glänzen.
Der Stundenplan war dicht, das Leben in der Schule hart und entbehrungsreich. Die Kadetten sollten in der École Royale derartig geschliffen werden, dass der spätere Dienst in ihren Einheiten ihnen wie ein Kinderspiel vorkam.
Und so verging jeder Unterrichtstag im steten Wechsel von Kursblöcken, Uniformappellen, Messen und Pausen, bis es 20.45 Uhr schlug und die Kadetten erschöpft auf ihre Zimmer gingen und wieder eingeschlossen wurden.
Nur donnerstags und sonntags wurde nicht gelernt. An diesen beiden Tagen gab es für die Offiziersanwärter nur eine Pflicht: die Messe zu besuchen. Danach waren sie frei, Briefe zu schreiben, auszureiten oder auf den Schießplatz zu gehen, bis sie sich wieder zur gewohnten Zeit in ihre Zimmer begaben und einschließen ließen.
Für den jungen Davout war diese Tagesordnung an sich nichts Neues, kannte er derartige Regeln doch schon von Auxerre. Der wesentliche Unterschied zu seiner alten Schule bestand darin, dass die Anforderungen an den einzelnen Offizierskadetten viel höher waren und er endlich praxisbezogen lernte. Im Festungsbau, in dem sich Davout fast 30 Jahre später in Hamburg bestens bewährte, lernte ein angehender Offizier nicht nur theoretisch das Anlegen von Schanzen und die Verteidigung von Breschen. Es wurde ihm auch Zeichnen beigebracht, damit er in der Lage war, selbständig Festungswerke zu entwerfen und zu skizzieren. Desgleichen war auch der Geografieunterricht alles andere als praxisfern. Da Frankreich in den letzten 150 Jahren immer wieder Krieg um Italien, die Niederlande und Deutschland geführt hatte, gehörte es zu den Hauptaufgaben der Kadetten, die Topografie der betreffenden Länder und ihre Sprachen zu kennen. Ein französischer Offizier sollte sich zu jeder Zeit, in jedem Land auch ohne Karten grundsätzlich auf feindlichem Gebiet orientieren können.
Das Erziehungsprogramm der École Royale Militaire war für seine Zeit vorbildlich. In den zehn Jahren ihres kurzen Bestehens zwischen 1777 und 1787 brachte die École Royale Militaire niemand Geringeres als Napoleon Bonaparte, die Marschälle Davout und Clarke, zehn Divisionsgeneräle sowie dreißig Brigadegeneräle hervor. Vor allem Napoleon und Davout sollten zeit ihres Lebens immer wieder beweisen, dass sie ihre Lektionen gut gelernt hatten.
Entgegen seiner Schulzeit in Auxerre wissen wir nichts von irgendwelchen Eskapaden Davouts aus der Zeit an der École Royale Militaire de Paris. Er scheint sich von Anfang an gut eingefügt zu haben, war bei seinen Kameraden beliebt und bestand alle Prüfungen, sodass er am 2. Februar 1788 die Kaderschmiede als Unterleutnant verließ. Keinen Moment zu spät. Nur zwei Monate später wurde die Schule Opfer der schweren Wirtschaftskrise, die Frankreich erfasst hatte, und musste aus Kostengründen schließen. Die Revolution warf ihre Schatten voraus, und ehe es sich der frisch gebackene Unterleutnant Davout versah, sollte er wie so viele Hunderttausende in ihren Sog gerissen werden.
Was Davout außerhalb der Mauern der königlichen Militärschule erwartete, war ein Land in Agonie, dessen Bevölkerung dabei war, zu verelenden.
Grund dafür waren Missernten, welche durch Getreidespekulationen verschlimmert wurden. Dies zog eine Teuerung der Lebenshaltungskosten um 100 bis 200% und somit eine Hungersnot nach sich, welche mit einer Finanzkrise zusammenfiel, die auf Frankreichs Teilnahme am US-amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in den Jahren 1776–1783 zurückging. Damals war es Finanzminister Necker nur durch die Zeichnung von Staatsanleihen gelungen, die französische Militärintervention zugunsten der amerikanischen Unabhängigkeitskämpfer zustande zu bringen. Von dieser massiven Neuverschuldung hatte sich Frankreich nicht mehr erholt.
1788 schätzte der dem König vorgelegte Haushaltsbericht die Ausgaben des französischen Staates auf 629 Millionen Livres, die Einnahmen dagegen nur auf 503 Millionen, was einen Fehlbetrag von 20% ergab. Noch schlechter sah es jedoch hinsichtlich der Tilgung und Zinsen für die Staatsschulden aus. Diese erreichten die enorme Zahl von 318 Millionen Livres, was der Hälfte aller Ausgaben entsprach.
Diese Unsummen türmten sich zu einem Haushaltsdefizit, was das Königreich Frankreich nach Meinung führender Finanzexperten nicht mehr allein durch die Mittel seiner bisherigen Steuerverfassung auffangen konnte. Obwohl die Bevölkerung Frankreichs gegen Ende des Ancien Régime ca. 25 Millionen betrug, sank die Kaufkraft der Massen infolge der Teuerung der Grundnahrungsmittel.
Fortschrittlich denkende Wirtschaftsminister wie Neckers Nachfolger Calonne versuchten verzweifelt, den Staatsbankrott durch eine Territorialsteuer, die jeden Grundbesitzer ungeachtet seiner Standeszugehörigkeit zur Zahlung von Steuern verpflichtete, abzuwenden. Das Prinzip der Steuergleichheit scheiterte jedoch an der zähen Weigerung von Adel und Klerus, sich besteuern zu lassen, was Calonne zu Fall brachte. Am 8. April 1787 entließ der durchsetzungsschwache König seinen ungeliebten Finanzminister und ersetzte ihn durch den Finanzpolitiker Loménie de Brienne. Dessen Versuche, die Schatztruhen Frankreichs zu füllen, indem er Unterzeichner für eine Staatsanleihe von 120 Millionen Livres warb, scheiterte erneut am Widerstand der Adelskaste. Nur wenige Wochen nach Calonne kapitulierte auch Loménie de Brienne. Seine letzte Tat bestand darin, am 8. August 1788 die Generalstände für den 1. Mai 1789 einzuberufen. Damit war der Versuch Ludwigs XVI. gescheitert, sein Königreich mittels bloßer Steuerreformen aus dem Sumpf der Wirtschaftskrise zu ziehen. Mit der Einberufung der Generalstände hoffte der schwache Enkel Ludwigs XIV., den Widerstand von Adel und Klerus zu brechen, ohne dem Dritten Stand zu viele politische Zugeständnisse machen zu müssen.
Der König irrte sich. Mit der Einberufung der Ständeversammlung hatte er einen großen Fehler begangen. Statt sich, wie vom Hof vorgesehen, als bloße Geldbewilligungsmaschine instrumentalisieren zu lassen, sollte sie sich bald als trojanisches Pferd entpuppen. Einmal ins Machtzentrum der brüchigen Monarchie gezogen, dauerte es nur wenige Monate, bis der Geist der Revolution von Frankreich Besitz ergriff.
Von all diesen großen Umwälzungen ahnte der junge Unterleutnant Davout nichts, als er mit 18 Jahren seine Mutter auf ihrem neuen Landsitz in Ravières besuchte, den sich Françoise-Adélaïde 1785 gekauft hatte. Dort lernte Davout den ehrgeizigen Rechtsanwalt Louis Turreau de Linières kennen, der gerade seine Tante besuchte. Die beiden jungen Männer freundeten sich auf Anhieb an und stellten schnell fest, dass sie ähnliche politische Ansichten hatten. Ob Turreau schon 1788 ein überzeugter Verfechter revolutionärer Ideen war, kann aufgrund mangelnder Quellen heute nicht mehr nachgewiesen werden, sein späterer Werdegang lässt dies jedoch vermuten. Was Davout anbetrifft, so hüllen sich die meisten seiner Biografen in Schweigen. Fest steht, dass die Freundschaft zu Turreau nicht ohne schwerwiegende persönliche Konsequenzen blieb. Wie es scheint, entflammten Françoise-Adélaïde D’Avoust und Louis Turreau de Linières derart heftig füreinander, dass sie noch im selben Jahr am 31. 8. 1789 heirateten. Aus Sicht von Françoise-Adélaïde brachte diese Heirat jedoch viel Bekümmernis. Ihre Familie missbilligte die Verbindung und erschien nicht zur Hochzeit, auch Louis nicht, was sehr verwundert, weil er als Freund von Turreau galt. Wahrscheinlich zwang ihn sein Dienst im Royal Champagne, den Feierlichkeiten fern zu bleiben. Bei den anderen Familienmitgliedern kann über den Grund des Ausbleibens nur spekuliert werden. Höchstwahrscheinlich spielte die bürgerliche Herkunft, der große Altersunterschied von 20 Jahren und die politischen Ansichten Turreaus eine große Rolle. Für Louis sollte der neue Stiefvater, der nur vier Jahre älter war als er, bald als Freund, Mentor und Förderer eine Schlüsselrolle spielen. Wie schicksalhaft diese Verbindung werden sollte, war in jenen Monaten der »Grande Peur« – der Angst der Adeligen vor den marodierenden Banden der Revolution – keinem der Beteiligten klar. Bis zu seinem frühen Tod 1797 blieben Davout und Turreau jedenfalls bestens befreundet.
Doch springen wir zurück zum Zeitpunkt, als Davout in das Kavallerieregiment »Royal Champagne« eintrat, in dem schon sein Vater gedient hatte.
Um dem mittellosen Unterleutnant überhaupt zu ermöglichen, standesgemäß seinen Dienst zu versehen, hatte der König ihm auf Staatskosten ein Pferd spendiert, was den jungen Offizier von einer seiner größten Hauptsorgen befreite. Zur Zeit des Ancien Regime kamen die Offiziere in der Regel selbst für ihre Ausrüstung auf und kauften sich Waffen, Uniform sowie ihre Pferde, was sehr kostspielig werden konnte.
Doch das Geschenk des Königs war nicht der einzige Grund, weswegen der junge Unterleutnant sofort die Aufmerksamkeit seiner Regimentskameraden erregte. Diese nahmen vielmehr Anstoß an seinem unsoldatischen Verhalten. Statt sich, wie es sich damals für einen richtigen Offizier gehörte, die Freizeit mit Kartenspiel, Zechgelagen und amourösen Abenteuern zu vertreiben, las Unterleutnant Davout – und zwar nicht die gängigen Schundromane seiner Zeit, sondern französische Philosophen. Diese unsoldatischen Interessen ließen seinen Onkel Major Jacques-Edme D’Avout, der auch im Royal Champagne diente, ernsthaft an seiner soldatischen Eignung zweifeln. Seiner Meinung nach war diese kurzsichtige Leseratte mit der hohen Stirn drauf und dran, den guten Ruf der Davouts als tapfere Militärs zu ruinieren. Seinem Tagebuch vertraute der Major an, was er aus Höflichkeit seinem Neffen nicht zu sagen wagte:
Mein Neffe Davout wird es in unserem Beruf zu nichts bringen. Er wird nie ein Soldat sein. Anstatt sich mit seinen militärtheoretischen Schriften zu befassen, beschäftigt er sich mit Montaigne, Rousseau und anderen Philosophen.14
Wie das Schicksal so spielt, sollte die Zukunft erweisen, dass der Major sich in Bezug auf die langfristigen beruflichen Perspektiven seines Neffen gründlich täuschte, was seine langfristige berufliche Perspektive anbetraf. Betrachtet man die Dienstzeit Davouts im Royal Champagne, so muss man dem Major zustimmen. Wie die folgenden Ereignisse beweisen, war Davout in diesem Regiment tatsächlich keine große militärische Zukunft vorbestimmt. Dies lag weniger an seiner Leidenschaft für Literatur, sondern vielmehr an seiner Parteinahme für die Revolution.
Diese war endlich im Sommer 1789 in Paris ausgebrochen, nachdem die Ständeversammlung sich feierlich im Ballhaus dazu verpflichtet hatte, Frankreich eine neue Verfassung zu geben. Die verzweifelten Rettungsversuche des erneut zum Finanzminister ernannten Schweizer Bankiers Necker hatten den Königshof dazu bewogen, diesen zu entlassen, was zu heftigen Protesten führte, in deren Verlauf am 14. Juli 1789 die Bastille gestürmt wurde.
Der Sturm auf die Bastille wurde zum Fanal der revolutionären Erhebung, die in einem gewaltigen Sturmlauf von ganz Frankreich Besitz ergriff. In den Städten gewannen nach zahlreichen Unruhen die Revolutionäre die Oberhand, während auf dem Lande blutige Bauernaufstände ausbrachen, die einen großen Teil der Aristokratie und des Klerus in die Emigration trieben. Im August schuf die Nationalversammlung erst die Privilegien von Adel und Geistlichkeit ab, dann erklärte sie die Menschenrechte. Im Oktober zogen zehntausend Marktfrauen nach Versailles, um die Königsfamilie im Triumphzug nach Paris zu führen. Kurz darauf wurden im November die bis dahin sakrosankten Besitztümer der Klöster verstaatlicht.
Überall, so schien es, siegten die Feuergeister der Revolution, allen voran der pockennarbige Graf Mirabeau, der wegen seiner wüsten Ausschweifungen Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Unverdrossen schleuderten die Revolutionäre die Fackel der Empörung in das morsche Gebälk des verrotteten Königreichs, das nach und nach bis in die hintersten Winkel von den hungrigen Flammenzungen eines neuen Zeitalters erfasst wurde.
Einer dieser Winkel war der Standort des Kavallerieregiments Royal Champagne – die alte Festungsstadt Hesdin im heutigen Departement Pas-de-Calais. Während die Bourgeoisie der trutzigen Kleinstadt die neuen Ideen enthusiastisch begrüßte, zeigte sich die Stadtverwaltung der alten Ordnung verpflichtet, worin sie vom Offizierskorps des Royal Champagne aufs Innigste unterstützt wurde.
Die Offiziere des Regiments zeigten keinerlei Verständnis für die Revolution, ja waren sogar ihre geschworenen Feinde, während die einfachen Kavalleristen und Unteroffiziere offen mit ihr sympathisierten. Nur wenige Offiziere wagten es, sich offen zur Revolution zu bekennen. Einer von ihnen war Davout, der bald zum Sprachrohr der Meuterer wurde.
Dieser Enthusiasmus für eine Idee, die die Abschaffung aller Vorrechte seiner gesellschaftlichen Kaste implizierte, wurde von seinen Offizierskameraden als Verrat am König gewertet. Die Spannungen im Regiment entluden sich zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit, als ein königstreuer Offizier anlässlich eines Umtrunks im Offizierskasino einen Toast auf die Gesundheit seiner Majestät ausbrachte und dabei Davout öffentlich beleidigte.
Meine Herren! Ich erhebe mein Glas auf einen Mann, den wir alle aus tiefstem Herzen lieben. Auch wenn uns diese Zeit der »Freiheit« nicht gestattet, dies zu zeigen, schmeichle ich mir, dass es unter uns keinen Feigling gibt, der auf etwas anderes anstoßen würde: Auf die Gesundheit des Königs!15
Dieser Toast, der als mutwilliger Affront gegen Davout gedacht war, forderte eine Reaktion des revolutionären Offiziers. Der junge Burgunder zögerte nicht, den hingeworfenen Fehdehandschuh aufzunehmen und seinerseits den Provokateur herauszufordern.
Meine Herren! Ich bin der Feigling, auf den sich dieser Herr bezogen hat: Auf die Nation!16
Auf diese Entgegnung Davouts konnte es nach den Gepflogenheiten der Zeit nur eine Antwort geben: ein Duell. Aber die Regimentskommandantur schritt, kaum dass die Einzelheiten des Zweikampfs vereinbart worden waren, energisch ein, untersagte den Ehrenhandel und arretierte beide Offiziere, weil sie gegen das Verbot verstoßen hatten, jegliche politische Meinungsäußerung zu unterlassen. Aber mit disziplinarischen Maßnahmen dieser Art war die Revolution selbst in Hesdin nicht mehr aufzuhalten.
Als im Jahr 1790 infolge des einjährigen Jubiläums der Revolution die allgemeine Welle der Verbrüderungsfeste die Picardie erfasste, trieben die Ereignisse im Regiment Royal Champagne auf ihren Höhepunkt zu. Den Anlass zu diesem Konflikt lieferte die Idee von der Waffenbrüderschaft von Nationalgarde und Royal Champagne. Dieses Projekt, das sofort die Nationalgardisten entflammte, stieß auf den entschlossenen Widerstand der Offiziere, hassten sie doch die beiden Hauptelemente der Föderationsfeste aus tiefstem Herzen: das feierliche Beschwören der Nation und den Eid auf die revolutionäre Verfassung.
Hinzu kam, dass sie die kurz nach dem Bastillesturm in Paris gegründete Nationalgarde verachteten. In ihren Augen war diese neue Kampftruppe nur eine militärisch minderwertige Ansammlung bewaffneter Bürger, die der Armee nicht das Wasser reichen konnte. Vor allem der Kommandeur vor Ort, der Marquis de Broc, machte aus seiner Missbilligung des Föderationsprojekts keinen Hehl und untersagte Offizieren wie Soldaten, sich mit den Nationalgardisten zu verbrüdern.
Aber weder Davout noch die Mannschaften ließen es sich verbieten, ihre revolutionäre Gesinnung öffentlich zu demonstrieren.
In einem feierlichen Akt verbrüderten sie sich am 26. April 1790 mit der Nationalgarde von Hesdin, wobei Davout von De Broc sogar den Schwur des Föderationseids forderte, was dieser ablehnte. Indigniert über diese ungeheure Provokation und unsicher darüber, ob die politische Lage es zuließ, mit aller Härte gegen Davout und seine Anhänger vorzugehen, wandte sich der Marquis an Kriegsminister De La Tour du Pin. Dieser reagierte sofort und beschloss am 15. Mai 1790, das Regiment zu verlegen, als ein Brief von der Nationalversammlung in Hesdin eintraf.
In ihrem Schreiben erklärte diese die Verbrüderung der Nationalgarde mit dem Kavallerieregiment Royal Champagne nachträglich als beispielhaft und richtungsweisend für das ganze Land, was für frenetischen Jubel bei den Soldaten sorgte.
Davout und seine Anhänger hatten einen ersten Sieg errungen. Doch die Freude über ihren Erfolg verging den Soldaten bald. Nachdem zwei Monate lang ein trügerischer Burgfrieden in Hesdin geherrscht hatte, spitzte sich die Lage am 1. August 1790 erneut zu.
Den Anlass zu neuem Unfrieden bot die Beförderung eines bei den Mannschaften verhassten, royalistischen Unteroffiziers zum Unterleutnant, was eindeutig gegen das Reglement verstieß. Aufgrund eines Erlasses vom 29. Juli 1790 hatte die Nationalversammlung erst mal alle Offiziersernennungen bis zur Erarbeitung neuer Beförderungsrichtlinien ausgesetzt. Davout protestierte gegen diese Maßnahme, ohne vorerst etwas dagegen ausrichten zu können.
Die Soldaten murrten, verhielten sich jedoch den ganzen Tag ruhig. Die Lage eskalierte erst anlässlich eines Banketts, welches das Offizierskorps des Royal Champagne der Nationalgarde gab. Um sich für eine vorangegangene Einladung der Nationalgarde zu revanchieren, hatten die Offiziere des Kavallerieregiments die Nationalgardisten zu einem Festessen eingeladen, den mit ihnen verbrüderten Unteroffizieren und Reitern des eigenen Regiments jedoch die Einladung verweigert. Der Affront traf die Mannschaften schwer, zeigte jedoch nicht die erhoffte Wirkung.
Der Protest der Soldaten beschränkte sich zuerst nur auf lautes Lärmen und Anstoßen auf die Nation. Aber dabei blieb es nicht. Die Reiter bewaffneten sich mit Knüppeln sowie Musikinstrumenten und machten sich einen Spaß daraus, mit entsetzlicher Katzenmusik das Fest ihrer Offiziere zu sprengen. Als diese jedoch ihren Soldaten befahlen, die Störaktionen zu unterlassen, kam es zu Tumulten, die erst spät in der Nacht endeten, wobei die Reiter mehrmals forderten, die Offiziere an der nächsten Laterne aufzuknüpfen.
Jetzt endlich hatte De Broc, was er wollte. Was sich in dieser Nacht abgespielt hatte, konnte als ein klarer Fall von Meuterei gelten. Der Ortskommandant fackelte nicht lange und schickte zwei seiner Offiziere nach Paris zum Kriegsminister und zu den wichtigen politischen Clubs – darunter die Jakobiner, um die Vorfälle anzuzeigen und um harte Bestrafung der Schuldigen zu bitten.
Die Entsendung der beiden Boten de Brocs blieb jedoch Davout und seinen Anhängern nicht verborgen. Um den Verleumdungen der Offiziere in Paris entgegenzuwirken, erbat sich Davout Urlaub. De Broc, der genau wusste, weswegen Davout so dringend nach Paris wollte, stellte sich ihm nicht in den Weg. Großzügig gewährte er dem abtrünnigen Unterleutnant zwei Tage, was für die Hin- und Rückreise nach Paris viel zu kurz war. Doch so leicht ließ sich Davout nicht auszutricksen. Er dachte gar nicht daran, nur zwei Tage wegzubleiben. Wenn sein Urlaub Sinn machen sollte, musste er ihn überziehen. Nur so konnte er überhaupt nach Paris reisen und die Nationalversammlung aufsuchen, um ihr seine Version der Ereignisse darzustellen, die zu den Tumulten in Hesdin geführt hatten.
Davout verließ seine Garnison und erreichte Paris am 5. August. Dort suchte er sofort den Jakobinerklub auf, von dem er sich durch die Fürsprache Robespierres die größte Hilfe versprach. Er betrat die Tribüne gerade, als einer der Sendboten De Brocs, M. D’Aubignan, den Abgeordneten seine Version der Geschehnisse dargeboten hatte. Noch heute dringt die Häme aus dem Brief, den D’Aubignan unmittelbar darauf an seinen Kameraden Vacquier schrieb:
Davout befand sich unterhalb der Tribüne, um mir, wenn er konnte, zu widersprechen. [...] Er ging auf die Tribüne und war dort nur, um Dummheiten von sich zu geben. Er musste zweimal zur Ordnung gerufen werden und wurde, nachdem er nichts mehr zu sagen wusste, mit Gewalt von der Tribüne gezerrt, wobei er forderte, vom Militärkomitee gehört zu werden. Doch da wartete ich schon auf ihn. Ich war ihm vorausgeeilt und hatte diese Herren schon vor ihm gewarnt: »Er ist da!« Ich bestand darauf, dass er in dieser Sache nicht gehört wurde und dass unsere Sache gut wäre. [...] Er wurde angehört und sagte nichts als Dummheiten.17
So zumindest die Version D’Aubignans, die Davout als Dummkopf präsentiert. In Wirklichkeit verhielt sich die Situation anders. Nicht D’Aubignan, sondern Davout hatte in der Redeschlacht den Sieg errungen und sich durch sein Engagement und seinen Mut die Achtung der Jakobiner und des Militärkomitees erkämpft.
Denn hinsichtlich der Vorfälle im Royal Champagne erließ das Militärkomitee ein Dekret, das alle kommenden Befehlsverweigerungen unter Strafe stellte, die Aufrührer des 1. August jedoch amnestierte. Die Königlichen waren am Boden zerstört und hofften, dass der Kriegsminister das Regiment mit Gewalt auflöste, was viele Soldaten ängstigte, da das Regiment ihr Lebensunterhalt war. Schon machten in Hesdin Gerüchte die Runde.
Aber Davout kannte die Rechtslage und verstand es, in einem Brief vom 13. August seine Kameraden zu beruhigen:
Letztendlich müsst ihr wissen, dass weder der Minister noch der König selbst das Recht hat, einen Soldaten an der Ausübung seiner Tätigkeit zu hindern oder aus triftigerem Grunde einfach ein Regiment aufzulösen. Ihr könnt euch also beruhigen. Wir sind hier, um eure Interessen zu vertreten.18
Was die Rechtslage anbetraf, so war Davouts Argumentation schlüssig. Nur in einem täuschte er sich. Seine Kameraden hatten allen Grund, misstrauisch zu sein.
Mit Kriegsminister De La Tour du Pin hatte sich Davout einen gefährlichen Feind gemacht, der gar nicht daran dachte, sich geschlagen zu geben.
Mit wahrhaft machiavellischer Energie nutzte der Kriegsminister eine Gesetzeslücke des Dekrets aus, um Davout und die weiteren Unruhestifter des Royal Champagne doch noch kaltzustellen. Im Text des Erlasses fand sich nämlich ein Artikel, der dem König das Recht gab, Soldaten und Offiziere jederzeit aus der Armee zu entlassen, sofern ihre Dienste »nicht mehr angenehm« oder »nützlich waren«. Und genau diese Bestimmung nutzte der Kriegsminister jetzt, um gegen die Aufrührer vorzugehen. Das Einzige, was De La Tour du Pin brauchte, waren eindeutige Beweise, die belegten, dass sich die Meuterer vom 1. August als unangenehme und unnütze Untertanen des Königs erwiesen hatten.
Diese Beweise wurden schnell erbracht. Mit Hilfe von Bestechungen und Drohungen brachte De Broc mehrere Reiter und Unteroffiziere dazu, 36 ihrer Kameraden zu denunzieren und zu behaupten, dass diese sich gegen ihre Offiziere zu einer Meuterei verschworen hätten.
Jetzt galt es nur noch, Davout auszuschalten, dann waren die Meuterer führerlos. Zu diesem Zweck befahl der Kriegsminister eigens den Provinzkommandanten von Arras, M. de Biaudos, nach Hesdin.
Als Davout am 19. August in der Kaserne eintraf, lief er in eine Falle. Ohne ihn überhaupt gerichtlich anzuhören, wurde er sofort wegen unerlaubten Entfernens von der Truppe verhaftet und ohne Gerichtsurteil in ein Verlies der Zitadelle von Arras geworfen.
Der Kriegsminister konnte zufrieden sein. Jetzt, wo er den Aufrührern ihren wichtigsten Anführer genommen hatte, brauchte er nicht mehr zu fürchten, dass die Meuterer den Offizieren noch gefährlich werden konnten.
Unter dem Vorwand eines Regimentsappells ließ der Stadtkommandant von Arras am nächsten Tag die Truppe auf dem Rathausplatz von Hesdin antreten, den er vorsorglich mit königstreuen Truppen umstellt hatte.
Im Angesicht von vier Kanonen, die feuerbereit auf die Reiter gerichtet waren, erzwangen die Offiziere die Entlassung der 36 denunzierten Reiter und Unteroffiziere unter Wegfall aller weiteren Bezüge. Für viele der Betroffenen, die seit mehr als zwanzig Jahre in der Armee dienten, bedeutete dies die sichere Katastrophe und das Todesurteil. Wie sollten sie kurz vor der Rente, ohne Bezüge überleben?
Wie es schien, hatte der Kriegsminister an allen Fronten gesiegt und die Disziplin wiederhergestellt.
Aber so schnell gaben die Kameraden Davouts nicht auf. Mit Hilfe der Nationalgardisten gelang es Ihnen, die Nationalversammlung zur Entsendung einer Kommission zu bewegen, die Ende September zu dem Schluss kam, dass die Verhaftung Davouts unrechtmäßig gewesen war.
Nach sechs Wochen Kerkerhaft kam Davout wieder frei. Seine Freilassung erfolgte zum Zeitpunkt, als seine verzweifelte Mutter Françoise-Adélaïde durch ihre Beredsamkeit den mitleidigen Festungskommandanten von Arras schon dazu gebracht hatte, ihrem Sohn die Flucht zu ermöglichen.
Aber hier zeigt sich wieder ein bemerkenswerter Zug in Davouts Charakter, der seine Mutter schier verzweifeln ließ. Halsstarrig wie er war, hatte sich der Gefangene der Flucht verweigert, weil diese als Eingeständnis seiner Schuld gewertet werden konnte. Dieser Starrsinn wäre fast tödlich für ihn gewesen, wenn nicht das Urteil der Untersuchungskommission ihn befreit hätte.
Die Episode gewährt einen Einblick in Davouts Rechtsverständnis und in die innige Beziehung zwischen Mutter und Sohn. In seinem naiven Gerechtigkeitswahn hätte Davout sich lieber selbst geopfert, als die Flucht zu ergreifen.
Was seine Mutter anbetrifft, so ist man erstaunt, wie geschickt sie vorging, um ihren Sohn zu befreien und welches Risiko sie dabei in Kauf nahm. Zwei Jahre später sollte der Tag kommen, an dem ihr Sohn sich für den Altruismus seiner Mutter revanchieren konnte.
Fürs Erste war Davout gerettet. Seine Karriere als Offizier konnte er jedoch vergessen. Die Kommission hatte seine Verhaftung zwar als ungerechtfertigt eingestuft, aber den Aspekt der Insubordination als gegeben angesehen. Jetzt gehörte Davout zu den Elementen, deren Dienste für den König nicht mehr angenehm oder nützlich waren. Dies bedeutete: Für Rädelsführer wie Davout war kein Platz mehr in der Armee. Er war gezwungen, den Dienst zu quittieren. Dem Unterleutnant stand eine ungewisse Zukunft bevor. Da half es auch nichts, dass er die Einreichung seines Abschieds um ein Jahr hinauszögerte. Auch seine Hoffnung, sich durch eine Klage am Kriegsminister rächen zu können, erwies sich als trügerisch. Schon im November wurde sein Todfeind De la Tour Du Pin gestürzt und somit selbst zum Opfer der Revolution.
All die tristen Jahre in Auxerre, all die Schinderei in der École Royale Militaire – sollte dies alles umsonst gewesen sein? Davout musste den Kopf freikriegen, Distanz gewinnen und zog zu seiner Mutter nach Ravières, die ihn vorerst finanziell unterstützte.
Nach all den Verwicklungen und schlechten Erfahrungen hatte der ehemalige Unterleutnant Ruhe nötig. Er fand Zerstreuung und Muße in der Bibliothek des Schlosses Ancy-le-Franc, deren Benutzung ihm Freunde seiner Mutter, die Familie Louvois, gewährte. Seiner Tochter Adélaïde-Louise Davout D’Auerstedt zufolge las er in dieser Zeit bevorzugt Reiseliteratur und interessierte sich auffallend für das Leben in den Kolonien Frankreichs.
Wollte Davout auswandern, um ein neues Leben anzufangen? Die Quellen belegen dies nicht. Falls er dies jedoch vorgehabt hatte, so durchkreuzte die Macht des Schicksals seine Pläne.
Wenige Monate nach seiner Entlassung lernte Davout die 23-jährige Nicole de Seuguenôt kennen, die gerade zu Gast bei Verwandten in Ravières war, und heiratete sie nach kurzem Werben am 8. November 1791. Über die Ehe ist kaum etwas bekannt. Weder Dokumente noch Briefe sind aus dieser Zeit erhalten geblieben – was vermutlich dem tragischen Ende dieser kurzen Beziehung zuzuschreiben ist. Kein Brief, weder von der Braut an den Bräutigam noch vom Gatten an die Ehefrau, ist uns überliefert, was angesichts der Tatsache, dass Davout zeit seines Lebens gern Briefe schrieb, verwundert. Sicher ist nur, dass die Flitterwochen ganze 34 Tage dauerten, bevor er sich gezwungen sah, von Nicole Abschied zu nehmen, um ins Feld zu ziehen.
Denn mittlerweile war zusätzlich zu Davouts Heirat ein neues Ereignis in sein Leben getreten, das ihm bald einen entscheidenden Beitrag zur Geschichte Frankreichs ermöglichte. Davout hatte ein Mittel gefunden, seine militärischen Kenntnisse doch wieder in den Dienst seines Heimatlandes zu stellen. Nicht, dass er rehabilitiert worden wäre, nein, diesmal kam der Ruf zu den Waffen von der Nationalgarde, die niemand Geringeres als der Comte de Lafayette befehligte. Ursprünglich als Bürgerwehr gedacht, hatte das Kriegsministerium per Erlass die Kompetenzen der Nationalgarde erweitert und sie als gleichberechtigte militärische Kraft der Armee zur Seite gestellt. Wie es aussah, stand Frankreich kurz vor einem Krieg.
Die heimliche Flucht der königlichen Familie im Juni 1791 und ihre darauffolgende Verhaftung in Varennes hatten dazu geführt, dass die Revolution sich radikalisierte.
Nachdem der König und seine Familie im Triumphzug nach Paris zurückgeführt worden waren, hatten sich Friedrich Wilhelm II., König von Preußen, und Kaiser Leopold II. am 27. August 1791 in einem kleinen sächsischen Ort namens Pillnitz getroffen. Das Resultat dieses Gipfeltreffens war die Erklärung von Pillnitz gewesen, in der die Fürsten Europas dazu aufgefordert wurden, sich für die Wiederherstellung der monarchischen Regierung in Frankreich einzusetzen.
Was dies bedeutete, lag auf der Hand. Aus Sicht der Revolutionsregierung hatten die Monarchen die Weichen für einen kommenden Krieg gestellt. Stillschweigend rüsteten Preußen, das Reich und das revolutionäre Frankreich zum Entscheidungskampf.
Da half es nichts, dass König Ludwig am 14. September den Eid auf die neue Verfassung leistete und Frankreich endlich eine konstitutionelle Monarchie wurde. Von nun an standen die Zeichen auf Krieg. Langsam massierten sich die Berufsarmeen der Gegenrevolution an ihren Sammelpunkten, während die improvisierten Bataillone der Revolution sich hastig im Inland formierten.
Zu einer dieser Kampfeinheiten gehörte das 3. Bataillon der Nationalgarde von Yonne, das erst am 22. 9. 1791 aufgestellt worden war. In dieser Einheit hatte Louis Davout sofort, kaum dass er sich in die Musterrolle eingetragen hatte, einen entscheidenden Karrieresprung gemacht. Da es in sämtlichen Truppenteilen der Nationalgarde an Berufssoldaten mangelte und die Soldaten ihre Offiziere selbst wählten, bestimmten sie Louis Davout erst zum Kapitän der 8. Kompanie, dann zum stellvertretenden Oberstleutnant des Bataillons.
Dieser war höchst motiviert und begann sofort mit der Ausbildung der ungeübten Miliz, um sie auf die schweren Kämpfe mit den vermeintlich besten Armeen Europas vorzubereiten. Die meisten der Freiwilligen wussten weder, wie man eine Waffe hielt, noch, wie man schoss. Auch musste der Umgang mit dem Bajonett und das taktische Exerzieren auf dem Gefechtsfeld geübt werden. Vielen der Nationalgardisten fehlte es auch schlichtweg an körperlicher Eignung, was man nicht von ihrem stellvertretenden Bataillonskommandeur sagen konnte.
Davout maß in der Höhe 1,80 Meter, was für die damalige Zeit groß war. Er hatte ausladende, breite Schultern und einen großen Kopf, auf dem sich schon erste Anzeichen einer baldigen Kahlheit bemerkbar machten.
Ein Gemälde aus der Zeit zeigt Davout in der blau-rot-weißen Uniform der Freiwilligen von Yonne. Was sofort auffällt, ist der leicht verhangene Blick, der vielleicht schon damals ein Hinweis auf seine später dokumentierte Kurzsichtigkeit war, und eine eigenartige Aura kühner Überlegenheit, die aus dem Porträt spricht.
Wie sich bald herausstellen sollte, konnte sich das 3. Bataillon von Yonne keinen besseren Oberstleutnant wünschen. Als sich das Bataillon am 16. Dezember 1791 nach Norden Richtung Verdun in Marsch setzte, kam es im Ort Dormans zu einem schweren Zwischenfall, bei dem Davout mehrere wegen Landesverrats angeklagte Gefangene davor bewahrte, von einem Mob gelyncht zu werden.
Dieser Vorfall, bei dem Davout und seine Kameraden sieben mutmaßliche Verräter vor dem Galgen retteten, ist typisch für ihn. Unerschütterlich war selbst in Zeiten der Revolution sein Glaube an den Anspruch des Einzelnen auf Gerechtigkeit, auch wenn er erwiesenermaßen schuldig war.
Wahrscheinlich bestärkte ihn die Erinnerung an seine eigene, unrechtmäßige Verhaftung in seinem Verhalten, willkürliche Gewaltakte wie den in Dormans nicht zu dulden.
Nach dem Zwischenfall bezog das Freiwilligenbataillon Winterquartier und wartete, bis der Krieg ausbrach. Dieser ließ nicht lang auf sich warten. Als Leopold II. starb und sein Sohn als Franz II. römisch-deutscher Kaiser wurde – ab 1804 Kaiser Franz I. von Österreich –, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Waffen sprachen.
Während die Kriegsrüstungen Preußens und Österreichs immer unverhohlener wurden, zwang die kriegswillige Partei der Girondisten das Kabinett des Königs zum Rücktritt.
Angesichts der drohenden Gefahren und einer wachsenden Kriegseuphorie in der Bevölkerung entschied sich die neue Regierung, dem Gegner zuvorzukommen. Am 20. April 1792 erklärte Frankreich Österreich den Krieg, was den sofortigen Kriegseintritt von Preußen und Hessen-Kassel auf österreichischer Seite nach sich zog.
Gleich zu Beginn der Kampfhandlungen zeigte sich, wie schlecht die französische Armeeführung auf den Krieg vorbereitet war. Nach einer Serie von Niederlagen geriet der französische Aufmarsch ins Stocken, herrschte Chaos an allen Fronten.
Nachdem das 3. Bataillon am 21. April den Befehl bekommen hatte, das Lager von Dormans abzubrechen, wurde es in den ersten Kriegsmonaten erst nach Verdun, dann wieder nach Sedan beordert, um sich mit der Armee General Lafayettes zu vereinigen.
Kaum war die Vereinigung vollzogen, mussten die Freiwilligen von Yonne schon wieder weitermarschieren. Im Juli bezogen sie im befestigten Lager von Maulde Stellung. Die Soldaten waren des Marschierens müde, die Offiziere nervös. Ungeduldig brannten sie darauf, sich im Kampf beweisen zu können. Dann, endlich, kam der Tag, an dem das Bataillon und Oberstleutnant Louis Davout ihre Feuertaufe erhielten. Beim Versuch, eine vorgeschobene Einheit abzulösen, lief das Bataillon in einen Hinterhalt und verlor nach einem wilden Scharmützel zehn Mann, sodass es sich überstürzt zurückziehen musste.
Das erste Gefecht in Davouts Karriere endete mit einer Niederlage. Trotzdem war Davout nicht entmutigt. Seine Männer hatten sich gut geschlagen.
Dagegen waren andere Ereignisse weit weniger dazu angetan, Davouts Gemüt zu beruhigen.
In Paris hatte sich Ungeheuerliches ereignet. Am 10. August 1792 war eine erregte Menschenmenge ins Schloss des Königs gestürmt, hatte die Schweizer Garde massakriert, das Königtum für aufgehoben erklärt und die Königsfamilie in der alten Burg der Tempelritter gefangen gesetzt. Dies waren die Anfänge der zweiten Phase der Revolution, die Geburtswehen der französischen Republik, die nach Verkündung der Abschaffung des Königtums am 21. September das Licht der Welt erblickte.
Die Nachricht von der Erstürmung der Tuilerien und der Gefangennahme der Königsfamilie hatte sofort Folgen für die Freiwilligen von Yonne. Gerade, als das Bataillon den Befehl erhielt, auf Condé zurückzugehen, erfuhr es, dass der Oberkommandierende der Nationalgarde, der Marquis de Lafayette, zu den Österreichern übergelaufen war.
Die Regierung reagierte schnell. Sie übertrug General O’Moran das Kommando über die Nationalgarde, während sie General Dumouriez zum Oberbefehlshaber der Nordarmee machte. Nun erst wendete sich auf dem nördlichen Schauplatz das Kriegsglück.
Unter dem Kommando O’Morans hatte Davout mit seinem Bataillon endlich die Gelegenheit, sich für die im August erlittene Niederlage zu rächen und den ersten bedeutenden Sieg zu erfechten.
Am 1. September wiesen die Nationalgardisten einen Angriff von 6000 Österreichern ab und setzten ihnen so schwer zu, dass sie 400 Mann verloren. Am 4. September 1792 konnte Davout in einem Brief an die Administratur von Yonne schreiben, dass das 3. Bataillon den Tod seiner Kameraden gerächt hatte.
Dieser kleine Sieg der Nationalgarde ist symptomatisch für den weiteren Kriegsverlauf. Nachdem General Kellermann die Offensive der Preußen bei Valmy gestoppt, der Feldherr Custine Mainz erobert und Dumouriez die Österreicher bei Jemappes in Belgien geschlagen hatte, brach der Angriff der Verbündeten zusammen. In einem Siegeslauf sondergleichen eroberten die französischen Armeen innerhalb eines Monats Belgien. Jetzt konnte die neue französische Regierung die Völker Europas endlich dazu aufzurufen, sich gegen die Monarchien zu erheben.
Doch so schnell, wie dies die Führer Frankreichs erhofften, erhoben sich die Völker nicht. Berauscht durch ihre Siege und vom festen Willen beseelt, die Revolution zu exportieren, erklärten die Revolutionäre England und den Niederlanden den Krieg.
Das Wiederaufflammen der Feindseligkeiten im nächsten Jahr sollte zeigen, dass die Ideen der Revolution in den besetzten Gebieten an Boden verloren hatten.
Die Hinrichtung von Ludwig XVI. am 31. Januar 1793 hatte unmissverständlich jedem in Europa klar gemacht, dass dieser Konflikt kein gewöhnlicher Kabinettskrieg des 18. Jahrhunderts, sondern ein totaler Krieg zweier Gesellschaftssysteme war. Entweder siegen oder sterben, dies war die Parole.
Als Dumouriez die Österreicher bei Neerwinden stellte, erlitt er am 18. März 1793 eine vernichtende Niederlage. Im Gegensatz zur Schlacht von Jemappes nahm das 3. Bataillon der Freiwilligen von Yonne an der Schlacht teil und kämpfte tapfer auf dem Flügel General Mirandas, der letztendlich geworfen wurde, was die Katastrophe einleitete.
Dumouriez verlor die Schlacht, was in Zeiten der Revolution lebensgefährlich sein konnte. Unter dem Druck der radikalrevolutionären Bergpartei wurde dem General befohlen, nach Paris zu kommen.
Der General konnte sich ausrechnen, was das für ihn bedeutete. Wie die Verhaftungen von General Custine und Marschall Luckner später bewiesen, war der Befehl zum Rechenschaftsbericht in Paris gleichbedeutend mit der Verurteilung zum Tod. Eine verlorene Schlacht oder ein missratener Feldzug reichte, altgediente Soldaten aufs Schafott zu bringen.
Dumouriez entschied sich dafür, ein derartiges Schicksal zu vermeiden. Heimlich nahm er mit den Österreichern Verhandlungen auf und gewann sie für sein Vorhaben, gegen die Regierung in Paris zu putschen.
Sein Plan war einfach. Während er mit loyalen Truppen auf Paris marschieren wollte, sollten die Österreicher stillhalten und nicht angreifen. Doch Dumouriez’ Putschvorhaben hatte eine Achillesferse. Um seinen Angriff auf Paris durchzuführen, musste er seine Armee ins Vertrauen ziehen und für sich gewinnen.
Schon in dieser Phase zeigte sich, dass Dumouriez die Loyalität seiner Truppen gegenüber der Regierung weit unterschätzt hatte. Die meisten Generäle und Offiziere verweigerten ihm die Gefolgschaft und unterrichteten ihrerseits die Regierung von Dumouriez’ Plänen.
Diese entsandte eine vierköpfige Kommission unter Kriegsminister Pierre Beurnonville zu Dumouriez, um ihn festzunehmen. Abermals durchkreuzte der Abtrünnige die Pläne. Statt sich verhaften zu lassen, setzte er Beurnonville und die Kommission gefangen und schickte sie den Österreichern. Dann befahl er seinen Truppen den Rückzug aus Belgien nach Frankreich, um der österreichischen Armee die Grenze zu öffnen.
Der Plan wäre fast geglückt, hätte nicht Louis Nicolas Davout dem Verräter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Verärgert durch die Order, kampflos aus Belgien abzurücken, und aufgewühlt durch das Publikwerden von Dumouriez’ Umsturzplänen, trafen sich die Kommandeure der Freiwilligen im Lager von Löwen und hielten Kriegsrat.
Was sollten sie tun? Mit Dumouriez marschieren oder gegen ihn kämpfen? Für Davout als treuen Anhänger der Revolution gab es keinen Zweifel: Gegen Dumouriez, für die Revolution!
Entschlossen, die Republik zu retten und Dumouriez zu verhaften, setzte er seine Truppe in Marsch. Der Zufall wollte, dass Davouts Marschkolonne ausgerechnet dem Verräter begegnete, als dieser gerade in Begleitung einer kleinen Eskorte vom österreichischen Hauptquartier kam.
Überrascht, die Nationalgardisten Davouts an derartig unvermutetem Ort zu sehen, wusste der Ertappte, dass er verloren war, und wandte sich überstürzt zur Flucht.
Sofort heftete sich Davout an seine Fersen. In der folgenden halsbrecherischen Verfolgungsjagd wurde Dumouriez beim Übersetzen eines Grabens von seinem Pferd abgeworfen. War dies das Aus? Schon jagte Davout heran, pfiffen die Flintenkugeln der Freiwilligen von Yonne links und rechts am General vorbei. In diesem Moment bewies ein Begleiter des Generals, der Herzog von Chartres, der spätere Bürgerkönig Louis-Philippe, großen Mut. Geistesgegenwärtig kehrte er zurück, hob Dumouriez auf sein Pferd und gab ihm die Sporen.
Der Verräter war entkommen. Davout fluchte, aber die Kommissionäre der Regierung waren zufrieden. Die Revolution hatte einen neuen Helden. Am 1. Mai 1793 wurde Davout erst zum Oberst einer Halbbrigade ernannt, dann, am 3. Juli 1793, zum Brigadegeneral befördert.
Nach einigen Gefechten in Belgien erhielt er den Befehl, sich in die Vendée zu begeben. Hier hatte sich die durchweg royalistisch gesinnte Bevölkerung nach dem Ausrufen der Republik gegen die jakobinische Regierung aus Paris erhoben und deren Truppen schwere Niederlagen zugefügt.
Dies sollte sich auch nicht ändern, als Davout auf dem Kriegsschauplatz eintraf. Der Feldzug in der Vendée verlief unglücklich. Der Brigadegeneral kam gerade noch rechtzeitig, um an der Schlacht von Vihiers teilzunehmen, die zu einer vernichtenden Niederlage für die Regierungsarmee wurde. Obwohl die Bauern der Vendée schlecht bewaffnet waren, durchbrachen sie mit Todesmut die miserabel geführten Kolonnen der republikanischen Infanterie und schlugen sie in die Flucht. Einzig Davouts Umsicht war es zu verdanken, dass der Rückzug der Regierungstruppen nicht zum Desaster wurde. Mit einer kleinen Kavallerieabteilung sicherte der Brigadegeneral den Rückzug seiner Kameraden und bewahrte sie so vor völliger Vernichtung. Mit dieser Aktion endete auch schon Davouts aktiver Beitrag an den Kampfhandlungen in der Vendée.
Am 30. Juli 1793 erhielt er vom Kriegsministerium die Nachricht, dass er zum Divisionsgeneral befördert worden war und nach Paris reisen sollte, um weitere Instruktionen entgegenzunehmen. Er war gerade auf dem Weg dahin, als ihn eine Nachricht erreichte, die all seine Karriereträume wie Seifenblasen zerplatzen ließ. Er erfuhr, dass der Konvent gerade einen Gesetzesentwurf beriet, der zum Inhalt hatte, die Armee von ehemaligen Adeligen zu säubern. Was dies für ihn als Chevalier bedeutete, konnte sich Davout ausrechnen. Aufgeschreckt durch die Ermordung Marats und die royalistischen Aufstände in Marseille, Nimes und Bordeaux witterte die neue radikalrevolutionäre Regierung Frankreichs, der Wohlfahrtsausschuss, überall Verrat und suchte nach Sündenböcken, die er jederzeit dem Volk präsentieren konnte. Schon zeichnete sich die Zeit der Schreckensherrschaft ab, der 30 000 Franzosen unter dem blutigen Zepter Dantons und Robespierres zum Opfer fallen sollten. Davout musste handeln, bevor das Gesetz gegen die ehemaligen Adeligen öffentlich verkündet wurde.
Am 29. August 1793 schrieb er Kriegsminister Bouchotte, dass er nicht nur die ihm angebotene Beförderung zum Divisionsgeneral ablehnen müsste, sondern reichte auch darüber hinaus seine Demission ein, mit der Begründung, früher adelig gewesen zu sein. Der Kriegsminister, fern davon, Davout zu grollen, bedauerte dessen Entscheidung zutiefst, wünschte ihm jedoch viel Glück für seine weitere Zukunft.
Und Glück brauchte Davout. Zwar hatte ihn sein Abschied aus der vordersten Schusslinie gebracht. In den Augen des Konvents jedoch blieb er trotzdem verdächtig. Einzig seine Verdienste in der Dumouriez-Affäre und mächtige Fürsprecher wie General Pille von der Nordarmee hatten ihn davor bewahrt, sich in langwierigen Verfahren wegen seines Ausscheidungsgesuchs rechtfertigen zu müssen.
Hoffnungsvoll machte sich Davout auf den Weg nach Ravières. Der junge Brigadegeneral »a. D.« war der Ruhe bedürftig. Aber in Ravières hatte sich Einiges geändert. Die erste Veränderung betraf seine Mutter, die sich inzwischen von ihrem Mann Turreau im gütlichen Einvernehmen getrennt hatte. Der zweite Umbruch betraf Davouts eigene Ehe. Wie er bei seiner Ankunft erfuhr, war seine junge Frau Nicole, die er zwei Jahre nicht mehr gesehen hatte, mit einem anderen Mann eine Liaison eingegangen, was den gehörnten Ehemann zutiefst erzürnte. Ohne sich von den Tränen seiner Frau erweichen zu lassen, reichte er sofort die Scheidung ein. So sehr Nicole ihn um Verzeihung bat, so sehr ihn ihre Verwandten wegen der zu erwartenden Schande bedrohten, Davout blieb hart.
In keinster Weise mit dem Gemüt und Charakter meiner Ex-Frau sympathisierend, wollte ich aus dem Gesetz Vorteil ziehen und die Verbindungen kappen, die mich nicht glücklich machten: Nun gut. Ich wurde mit Spießen, Flintenschüssen und Steinwürfen bedroht. [...] Endlich, nach all den vorgeschriebenen Formalitäten, wurde meine Scheidung durch den Standesbeamten verkündet.19
Davout trennte sich von seiner Frau und verstieß sie. Diese Härte sollte tragische Konsequenzen haben. Ein Jahr später war Nicole Davout, geborene de Seuguenôt, tot. Ob an einer Krankheit, am gebrochenem Herzen oder an der Schande gestorben, darüber geben die Quellen keine Auskunft.
Aber nicht nur im privaten Bereich wartete Unbill auf den Heimkehrer wider Willen. Kaum hatte sich Davout von Nicole getrennt, verhaftete ein Ratsmitglied aus Auxerre in Begleitung zweier Gendarmen Davouts Mutter wegen Hochverrats und versiegelte ihren Sekretär. Was jedoch wurde der Schlossherrin von Ravières zur Last gelegt? Um dies zu erfahren, beschloss Louis, seine Mutter nach Auxerre zu begleiten, was ihm der Beamte nicht abschlug. Als der Gefangenentransport in einem Wirtshaus im kleinen Örtchen Tonnere abstieg, um dort zu übernachten, gelang es Davout, sich endlich mit seiner Mutter auszutauschen. Reumütig gestand Françoise-Adélaïde ihrem Sohn, dass sie als Strohmann der emigrierten Adelsfamilie La Rochefoucault deren Grundbesitz vor der Zwangsversteigerung gerettet habe, indem sie ihn pro forma aufkaufte. Darüber hinaus hatte Françoise-Adélaïde der emigrierten Familie weiterhin den Gelderlös aus den landwirtschaftlichen Erträgen heimlich zukommen lassen und die Briefe, welche diese gefährlichen Transaktionen belegten, in einem Geheimfach ihres Sekretärs aufbewahrt. Damit, das wurde Davout sofort klar, schwebte seine Mutter in Lebensgefahr. In den Augen der Regierungsbehörden hatte sie eine verdächtige Korrespondenz mit französischen Emigranten, den erklärten Feinden der Revolution, geführt und Hochverrat begangen.
Wie aber hatten die Behörden davon erfahren? Für Davout war klar, dass jemand seine Mutter gezielt bei den Behörden denunziert hatte. Sollten sich für diese Vorgänge Beweise finden lassen, drohte Françoise-Adélaïde die Guillotine. Es gab nur eine Chance: Er musste die belastenden Briefe finden, bevor es die Untersuchungsbeamten taten.
Noch in der Nacht schritt Davout zur Tat. Nachdem er die Eskorte mithilfe einiger Freigetränke außer Gefecht gesetzt hatte, entwich er durch den Hinterausgang des Wirtshauses und lief in tiefster Nacht den langen Weg nach Ravières zurück. Dort weckte er seine Schwester Julie und ging mit ihr in den Salon seiner Mutter. Vorsichtig, ohne die Amtssiegel aufzubrechen, öffnete er das Geheimfach des Sekretärs, wo nach dem Hinweis seiner Mutter die belastende Korrespondenz eingelagert war.
Dann verbrannte er die Briefe, schloss das Geheimfach und kehrte den langen Weg nach Tonnere wieder zurück, wo er kurz vor Morgengrauen ankam, ohne dass jemand seine Abwesenheit bemerkt hätte. Als der Tag graute, konnte Françoise-Adélaïde aufatmen.
Seelenruhig sah sie mit ihrem Sohn ihrem Prozess entgegen, der Tage später in Auxerre stattfand und zu einem Fiasko für den öffentlichen Ankläger der Revolution wurde. Zum Erstaunen des Staatsanwalts erwiesen sich die Anschuldigungen gegen Mme. D’Avoust wegen Hochverrats als haltlos, da die Hausdurchsuchungen in Ravières nicht die sicher geglaubten Beweise geliefert hatten. Aber so einfach ließ sich ein Chefankläger der Republik in den Tagen von Robespierres Schreckensherrschaft nicht vor einem Revolutionstribunal blamieren. Obwohl die Unschuld von Françoise-Adélaïde Davout laut der Aktenlage eindeutig erwiesen war, verurteilte das Gericht sie aufgrund des Verdachts, Kontakte zu Emigrierten zu unterhalten, zu einem mehrmonatigen Gefängnisaufenthalt.
Da ihr Sohn Louis wusste, dass seine Mutter eine derartige Haft nicht überleben würde, beschloss er, ihr Schicksal zu teilen und mit ihr ins Gefängnis zu gehen, das im Benediktinerkloster von Auxerre untergebracht war. Er wäre vielleicht mit seiner Mutter für immer im Gefängnis von Auxerre geblieben, hätte nicht ein mächtiger Parteifreund ihres Ex-Mannes Turreau sich für die Staatstreue von Mme. D’Avoust verbürgt. Am 13. Mai 1794 verließen Françoise-Adélaïde und Louis Davout das Gefängnis von Auxerre, das sie nie mehr betreten sollten.
Nur zwei Monate später befreite der kühne Putsch vom 9. Thermidor 1794 (26./27. Juli 1794) nicht nur Frankreich von der Diktatur Robespierres, sondern auch Davout aus seiner erzwungenen Eremitage in Ravières.
Mit dem Sturz der Jakobinerherrschaft, so glaubte der junge Brigadegeneral, war für ihn der Weg zurück in die Armee frei. Aber so einfach wie der 24-Jährige sich dies vorstellte, gestaltete sich seine Rückkehr in die kämpfende Truppe nicht. Nur dank der Fürsprache seines Ex-Stiefvaters Turreau de Linières und seines Kameraden General Pille gelang es ihm, im Frühjahr 1795 in seinem Dienstrang als Brigadegeneral zur Moselarmee detachiert zu werden.
Unter dem Befehl von General Moreaux zeichnete er sich bei der Einnahme Luxemburgs durch einen waghalsigen Stoßtrupp gegen eine vorgeschobene feindliche Stellung aus, deren Zerstörung schließlich die Eroberung der Festung beschleunigte.
Aber Davout konnte die Früchte seines Erfolgs nicht ernten und sollte den Fall Luxemburgs nicht miterleben. Statt an dem weiteren siegreichen Feldzug unter dem Kommando Moreaux’ teilzunehmen, wurde er der Rheinarmee unter dem Kommando von General Charles Pichegru unterstellt und nahm an dessen verhängnisvollem Feldzug in die Kurpfalz teil.
Schlecht koordiniert, miserabel geführt, wurden die französischen Truppen am Neckar schwer geschlagen. Im Laufe der blutigen Gefechte mussten die Franzosen Heidelberg aufgeben und sich aus der Kurpfalz zurückziehen. Einzig das erst im September eroberte Mannheim blieb in der Hand einer Garnison von 9000 Mann, darunter Davout mit seiner Brigade.
Aber auch diese Festung fiel nach einer Belagerung von nur drei Wochen in die Hände des Feindes, was Davout zutiefst erzürnte. Seiner Meinung nach hatte sein Vorgesetzter, Festungskommandant General Montaigu, längst nicht alle Register der Verteidigung gezogen und die Festung aufgegeben, obwohl der Feind noch nicht mal eine Bresche geschossen hatte. Diesen Umstand verübelte Davout Montaigu. Machtlos musste Davout mit ansehen, wie die langen Reihen seiner Männer in die Gefangenschaft marschierten. Fast wäre es dem Brigadegeneral ebenso ergangen, hätte ihn nicht ein seltsamer Zufall vor diesem Schicksal bewahrt.
Diesmal war es ausgerechnet seine adelige Abstammung, die ihn rettete. Wie sich herausstellte, hatte der österreichische Feldmarschall Dagobert Wurmser mit Davouts Onkel Jean-Edme vor Jahren zusammen in einem französischen Regiment gedient und sich mit diesem angefreundet. Aus Verbundenheit zu seinem alten Kameraden ließ der greise Feldmarschall den jungen Brigadegeneral zu sich kommen und entließ ihn auf sein Ehrenwort als Offizier aus der Gefangenschaft. Die Bedingungen für Davouts Freilassung entsprachen den Gepflogenheiten der Zeit. Kraft seines Eids verpflichtete sich Davout, an keinen Kampfhandlungen gegen die Österreicher und ihre Verbündeten teilzunehmen, bis der nächste Gefangenenaustausch stattgefunden hatte.
Davout hielt Wort. Wieder zog er sich nach Ravières zu seiner Mutter zurück, wieder nistete er sich wissensdurstig in der reichen Bibliothek des benachbarten Schlosses Ancy-le-Franc ein, um erneut militärtheoretische Schriften zu studieren. Es sollte das letzte Mal sein.
Nach Ablauf eines Waffenstillstands stieß Davout nach neun Monaten zur Rheinarmee, deren Oberbefehl Jean Victor Moreau hatte. Dort wurde er dem Kommando von General Louis Charles Antoine Desaix unterstellt, dessen Freundschaft und Gunst für seinen weiteren Lebensweg entscheidend wurde.
Dieser Louis Charles Desaix war ebenfalls wie Davout adelig und hatte die Militärschulen von Effiat in der Auvergne besucht. 1792 hatte er sich geweigert, die Aufhebung des Königtums anzuerkennen, weshalb er für sechs Wochen ins Gefängnis geworfen wurde, aus dem ihn nur gute Beziehungen befreiten. Danach war Desaix zum Generalstab Custines versetzt worden und hatte dessen siegreichen Feldzug von 1792 mitgemacht, der mit der Eroberung von Frankfurt endete. Im September 1793 war er erst zum Brigadegeneral, dann im darauffolgenden Jahr zum Divisionsgeneral ernannt worden und hatte sich unter Pichegru 1795 in der Rhein-Mosel-Armee ausgezeichnet. Da die Qualitäten von Desaix als Kommandeur unbestritten waren und er zudem ein angenehmes Wesen hatte, wurde dieser neue Vorgesetzte für Davout zum bewunderten Vorbild und guten Freund, der ihn förderte, wo er konnte.
In den folgenden zwei Jahren bewährte sich Davout überall dort, wo er von Desaix eingesetzt wurde. Im Rheinfeldzug von 1796 hatte er auf dem Vormarsch nach Deutschland entscheidenden Anteil am Sieg von Haslach. Als der Feldzug scheiterte, sicherte er mit seiner Kavallerie den Rückzug von Moreaus Truppen zurück an den Rhein. Besondere Verdienste erwarb er sich jedoch im Winter 1796/97 unter Desaix’ Kommando bei der Verteidigung der Festung Kehl.
Hier nutzte Davout für seine Truppen eine in Abstimmung mit Desaix neu entwickelte Verteidigungsmethode. Mittels einer Rotation von zwei Tagen Frontdienst, vier Tagen Pause tauschten die Verteidiger stets die Kampftruppen aus, die dem Bombardement der österreichischen Artillerie ausgesetzt waren. Diese neue Methode hatte große Vorteile. Sie half nicht nur, die Motivation der kämpfenden Truppe hochzuhalten, sondern hielt auch die Verluste klein. Außerdem bewirkte diese Taktik, dass den angreifenden Österreichern stets gut ausgeruhte Verteidiger gegenüberstanden. Trotzdem konnte auch eine derartig ausgeklügelte Verteidigungsstrategie auf die Dauer nicht verhindern, dass Kehl nach 50 Tagen Belagerung in die Hände des Feindes fiel. Als die Österreicher jedoch in Kehl einmarschierten, war nicht mehr viel übrig von den vormals stolzen Bastionen der Festung.
Wie hohl dieser Sieg war, musste der österreichische Oberkommandierende Erzherzog Karl im Frühjahr 1797 erfahren. In einer gewagten amphibischen Operation überquerte Moreaus Rheinarmee auf einer Flotille von Landungsbooten 1797 den Rhein bei Diersheim und überrannte dort nach heftigem Widerstand die österreichischen Verteidigungsstellungen. Wieder war es der umsichtigen Führung Desaix’ und dem kühnen Wagemut Davouts zu verdanken, dass der Sieg so vollständig wurde.
So gesehen, entwickelten sich die Dinge für Davout gut. Sein Tatendrang hatte das richtige Betätigungsfeld gefunden, seine Aktionen waren erfolgreich. Die Operationen des Jahres 1797 hätten ihn zufrieden stimmen können, wäre da nicht ein gravierender Umstand gewesen, der ihn gegen seinen Oberkommandierenden Moreau einnahm. Der energische Brigadegeneral fühlte sich von Moreau benachteiligt und nicht genügend gelobt.
Wahrscheinlich dachte Davout über Moreau genauso wie Desaix, der stets nur negativ von seinem Vorgesetzten sprach und behauptete, dass sie unter seinem Kommando nichts, bei Napoleon jedoch alles erreichen würden.
Dieser hatte in Italien Moreaus Erfolg mit seinem überragenden Sieg von Rivoli überflüssig gemacht und den deutschen Kaiser Franz II. dazu genötigt, Frieden zu schließen.
Für wenige Monate schwiegen die Kanonen, hörte das Sterben auf den Schlachtfeldern auf. Fast wäre Davout erneut arbeitslos geworden, wenn ihm nicht Desaix gegen Jahresende eine Kommandostelle in der Englandarmee verschafft hätte, die auf Geheiß des Direktoriums in Großbritannien einfallen sollte, um unter dem Kommando von Napoleon Bonaparte den einzigen noch verbliebenen Feind der Republik endlich auszuschalten.
Doch die Pläne des Direktoriums waren zum Scheitern verurteilt. Nachdem Napoleon im Winter 1798 die französische Flotte einer Inspektion unterzogen hatte, kam er zum Schluss, dass diese nicht in der Lage sei, gegen die Briten die Seeherrschaft im Kanal zu erringen.
Wie es schien, war die Englandarmee überflüssig geworden. Aber Napoleon wusste Abhilfe und schuf ein neues Betätigungsfeld für sich und seine Armee. Mithilfe von Außenminister Talleyrand setzte er Anfang März 1798 seine Vision durch, die britischen Handelsinteressen im Mittelmeer und in Indien durch einen Angriff auf Ägypten zu erschüttern.
Dieses Vorhaben, in der Geschichtsschreibung oft als tückischer Plan des Direktoriums skizziert, Napoleon aus Paris zu entfernen, trug von Anfang an die Handschrift des Korsen.
Militärisch gesehen war die Ägyptenexpedition ein Hasardstück, wie der Direktor Larevallère-Lepaux in einem Streitgespräch mit Bonaparte richtig erkannt hatte. Um den Truppenkonvoi nach Ägypten zu leiten, musste man die französische Flotte der Gefahr aussetzen, von den Briten vernichtet zu werden. Zudem entfernte die Expedition 40 000 der besten Soldaten Frankreichs aus Italien, der Schweiz und den Niederlanden, wo es seit der Einführung der Republik in weiten Bevölkerungsschichten gärte und Aufstände drohten.
Vor allem jedoch verstieß das Unternehmen politisch gegen sämtliche Grundsätze französischer Außenpolitik.
Ägypten gehörte zum Reichsverband des Osmanischen Reiches und war diesem pro forma zu jährlicher Tributentrichtung verpflichtet. De facto jedoch hatten die Mamelucken, eine Kriegeraristokratie aus ehemaligen tscherkessischen Sklaven, die Herrschaft inne. An ihrer Spitze standen zwei Mameluckenbeys, die mit ihren Gefolgsleuten das Land regierten: Ibrahim Bey und Murad Bey.
Eroberte Napoleon Ägypten, war damit zu rechnen, dass Sultan Selim III. aufgrund der Verletzung seines Reichsgebiets der französischen Republik den Krieg erklärte. Mit anderen Worten: Frankreich befand sich von Anfang an in einem politischen Dilemma. All dies irritierte Napoleon nicht. Seiner Meinung nach konnte das bevölkerungsstarke Frankreich den Abgang von 40 000 Mann verkraften. Die englische Flotte würde zu überrascht sein, um den französischen Geleitzug angreifen zu können, und der Sultan hielte es sicherlich für begrüßenswert, wenn Frankreich seine unbotmäßige Provinz für ihn in Besitz nähme.
Schweren Herzens ließen sich die Direktoren von Bonaparte überzeugen. Aus der schon bestehenden Englandarmee wurde per Dekret vom 5. März 1798 die Orientarmee, deren Bestimmungsziel vorerst geheim gehalten wurde. Einzig die fünf Direktoren und einige Minister erfuhren vom wahren Ziel der neu gegründeten Armee, die fieberhaft in Südfrankreich, Korsika und Italien zusammengezogen wurde.
Von den wenigen Militärs, die Napoleon nach und nach einweihte, war einer Desaix, den er am 22. März 1798 im Hotel Rue de la Chanteraine im Beisein von Davout traf.
Über das Treffen und seinen Verlauf wissen wir wenig. Wie aus einer Bemerkung Napoleons über Davout zu entnehmen ist, war ihm Desaix’ Freund nicht sonderlich sympathisch. Bonaparte stieß sich sehr am ungepflegten Äußeren des Brigadegenerals, den er später als Konsul gern im Beisein seines Sekretärs Bourienne als »foutue bête« – als »dreckiges Tier« bezeichnete. Wie die meisten Offiziere der laxen, republikanisch gesinnten Rheinarmee legte Davout keinen besonderen Wert auf korrektes Äußeres. Hinzu kam, dass seine blasse Gesichtsfarbe ihm ein ungesundes Aussehen verlieh. Seine starke Kurzsichtigkeit hatte zur Folge, dass er oft stolperte, wobei er seine Uniform und Stiefel befleckte. Am meisten störte Bonaparte jedoch an Davout dessen Eigenart, viele seiner Äußerungen mit einem sardonischen Lächeln zu unterlegen, was er als Zynismus wertete.
Trotz dieses instinktiven Unbehagens Napoleons gegenüber Davout gibt das Resultat der Unterredung keinen Anlass zum Zweifel, dass das Treffen mit Bonaparte nicht zuletzt durch die Fürsprache Desaix’ für Davout erfolgreich verlief.
Am nächsten Morgen wurde Davout im Rang eines Brigadegenerals ohne besonderes Kommando dem Generalstab der Division Reynier zugeteilt, die sich in Marseille sammelte.
Vier Monate später segelte er an Bord der Alceste inmitten einer von 13 Linienschiffen, 14 Fregatten und 72 Korvetten gedeckten Armada von 400 Transportschiffen nach Malta.
An Bord dieser Schiffe befanden sich 40 000 Soldaten und 10 000 Seeleute. An Proviant hatten sie Wasser für einen Monat, Lebensmittel für acht Wochen.
Überrascht von der ungeheuren Anzahl feindlicher Schiffe leisteten die Malteserritter den Invasoren keinen nennenswerten Widerstand und übergaben die Festung nach einer kurzen Kanonade.
Sofort machte sich Napoleon daran, die Festungswerke zu verstärken und die Vorräte der Orientarmee aufzufrischen. Zehn Tage blieb die Orientarmee auf Malta, dann schiffte sie sich wieder ein, nachdem Napoleon eine 3500 Mann starke Garnison zurückgelassen hatte.
Noch immer wussten seine Männer nicht, wohin die Reise ging. Endlich, am 2. Juli 1798, nachdem der Konvoi mit Glück dem englischen Geschwader unter Nelson entwischt war, ankerte die Invasionsflotte in Sichtweite des Strands von Marabout, der nur 13 Kilometer von Alexandria entfernt lag.
Der Empfang war alles andere als einladend. Ein heftiger Wind peitschte die See, trieb die Schiffe gegeneinander. Schäumende Wellenberge brachen sich an zackigen Felsenriffen, welche die Landungsstelle säumten. Aber Napoleon ließ sich nicht schrecken. Seinen Männern ein Beispiel, ging er trotz stürmischen Wetters als Erster an Land. Sorgenvoll beobachtete er, wie sich immer mehr Einheiten ausschifften und trotz heftiger See in ihren winzigen Schaluppen den Strand erreichten. Als der Brückenkopf 4000 Mann fasste, befahl Napoleon den Generälen Bon, Kléber und Menou, nach Alexandria zu marschieren, das sie unter geringen Verlusten noch am selben Tag im Sturm eroberten.
Am Abend des 3. Juli 1798 wehte die Trikolore über den Mauern der jahrtausendealten Stadt, die von Alexander dem Großen gegründet worden war. Müde ruhten sich die Eroberer Alexandrias aus. Einer von ihnen war Davout, der an jenem Tag zeitweilig eine Abteilung Infanterie kommandiert hatte und unter der Führung General Klébers am Sturm auf die Festungsmauern beteiligt gewesen war.
Der Ägypten-Feldzug hatte begonnen.