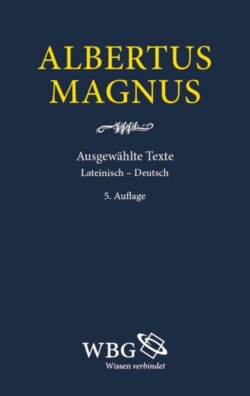Читать книгу Ausgewählte Texte - Albertus Magnus - Страница 6
LEBEN UND WERK DES HL. ALBERTUS MAGNUS
ОглавлениеVon WILLEHAD PAUL ECKERT
Wenigen Menschen erkennt die Geschichtsschreibung den Beinamen der Große zu. In der Regel sind es Persönlichkeiten des politischen Lebens. Die Fragwürdigkeit der Einschätzung als der Große wird auch bei diesen wenigen Persönlichkeiten nur zu oft deutlich, wenn der politischen die moralische Größe nicht entspricht. Dem Schwaben Albert von Lauingen wurde als einzigem Wissenschaftler der Beiname der Große zuerkannt, und er verdient ihn wirklich. Freilich bei Lebzeiten hat man ihn noch nicht so genannt, sondern erst im 14. Jahrhundert. Auch ist die Frage gestattet, was mit dem Prädikat „Magnus“ gemeint ist. Bernhard Geyer, dem die Editio Coloniensis zu einem guten Teil verdankt wird, macht darauf aufmerksam, daß das Magnus zunächst wohl in der Wortverbindung magnus in philosophia oder magnus philosophus vorkam, bis dann die Beiworte gestrichen worden sind und nur das Magnus übrigblieb. Magnus in philosophia oder magnus philosophus wurden in dem Sinne gebraucht, wie im Matthäus-Evangelium (5, 19) der treue Gesetzeslehrer als groß im Himmelreich bezeichnet wird. Aber dann müßte die Verknappung auf die Bezeichnung Magnus eben doch im Sinne einer Hervorhebung des Außerordentlichen dieses Mannes und Heiligen interpretiert werden. Daß der Beiname Magnus auf einem Mißverständnis beruhen könnte, wie Bernhard Geyer ebenfalls zu bedenken gibt, einer Verlesung aus Magistri, scheint mir wenig wahrscheinlich, auch wenn zuzugeben ist, daß die in den Handschriften im Mittelalter üblichen Kürzungen Verlesungen nahelegen. Auch die Vermutung, daß die Bezeichnung, die Dante im ›Convivio‹ III, 5 wählt, De la Magna, das heißt aus Alemania oder Deutschland, in Magnus umgedeutet worden sei, hat m. E. etwas Gezwungenes. Tatsächlich ist Albert groß als Lehrer. Er war wirklich magnus in philosophia, weil er durch seine Aristotelesrezeption das philosophische Studium in so breitem Umfange für die mittelalterliche Theologie, insbesondere die Theologie seines Ordens, ermöglicht hat. Er war freilich nicht nur groß in der Philosophie, sondern bedeutender noch in seinen naturwissenschaftlichen Studien. Die eigentliche Größe aber dürfen wir darin sehen, daß er die sehr unterschiedlichen Wissensgebiete, die er beherrschte, zu einer Synthese zu bringen vermochte. Er war kein Polyhistor, kein Enzyklopädist, aber ein universal gebildeter Mensch. Einen Doctor universalis nannten ihn die Späteren. Sie treffen damit das Richtige, da in dem Beiwort universalis sowohl das Weitausgreifende, das Umfassende seines Wissens ebenso bezeichnet wird wie das Vermögen, zu einer Synthese zu gelangen.
Er selbst nennt sich zunächst Fr. Albertus de Lauging. So ist er urkundlich und auf einem eigenen noch in Abdruck erhaltenen Siegel bezeugt. Dieses Siegel führte er als Professor der Theologie. In späteren Jahren bezeichnete er sich als Albertus Coloniensis; denn Köln wurde ihm zur Wahlheimat. Viele Jahre seines Lebens hat er in dieser Stadt zugebracht, in ihr ist er gestorben und hat er sein Grab gefunden. Als Albert von Köln wird er auch in Dantes ›Divina Comedia‹, und zwar im zehnten Gesang des Paradiso bezeichnet. Welche Wertschätzung er schon zu Lebzeiten besaß, wird aus den Worten seines Schülers Ulrich von Straßburg deutlich, der ihn in seiner ›Summa de bono‹ als einen „vir in omni scientia adeo divinus ut nostri temporis stupor et miraculum congrue vocari possit“ bezeichnet – als einen Mann, der in aller Wissenschaft geradezu göttlich war, so daß man ihn als das Staunen unserer Zeit und ein wirkliches Wunder bezeichnen konnte.
Gerne wüßten wir etwas Näheres über seine Herkunft und seine Jugend. Doch wir sind bei ihm wie bei vielen mittelalterlichen Persönlichkeiten auf Vermutungen und Schlußfolgerungen angewiesen. Nicht einmal das genaue Geburtsdatum steht fest. Die Angaben schwanken zwischen 1193 und 1207. Wahrscheinlich ist, daß er um 1200 oder ein wenig davor geboren wurde. Denn nach den ältesten Zeugnissen war er bei seinem Tode 1280 „octogenarius et amplius“, d.h. achtzig Jahre oder ein wenig älter. Man sollte dieses Zeugnis freilich nicht als völlig exakte Angabe werten, sondern nur als eine Annäherung an das wirkliche Alter. Immerhin ist von dieser Altersangabe ein Rückschluß möglich auf eine Geburt um 1200 oder ein wenig davor. Nach der von Heinrich von Herford um 1350 verfaßten Weltchronik stammt Albert ex militaribus. Das spricht für eine ritterbürtige Herkunft. Alberts Vater und seine Verwandten, so ein Onkel in Padua, waren anscheinend Ministeriale, Dienstmannen im Dienste der Staufer. In staufischem Dienst standen die Lauinger Stadtherren. Wir gehen mit der Vermutung wohl nicht fehl, daß auch Alberts Vater, der sich von Lauingen nennt, im Auftrag der Staufer in Lauingen Herrschaftsrechte ausgeübt hat. Wer war dieser Vater? Einige Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß wir in Marquard von Lauingen, der 1225 dem Orden der Predigerbrüder bei seiner Niederlassung in Augsburg behilflich war, indem er den Dominikanern ein Grundstück schenkte, den Vater Alberts des Großen vor uns haben. Dieser Marquard von Lauingen war in Augsburg begütert. Hat Albert also in Augsburg die Schule besucht? In Augsburg jedenfalls konnte er leichter Schulunterricht als in Lauingen erhalten. Aber wir bewegen uns im Bereich der Vermutungen. Wohl schimmert später in seinen Werken Erinnerung an Kindheit und Jugend durch, wenn er vom Fischreichtur der Donau berichtet oder uns andere Beobachtungen aus dem Tier- und Pflanzenreich mitteilt. Doch reichen die beiläufigen Hinweise nicht für eine Rekonstruktion der Kindheit- und Jugendjahre. Fischen und Jagen waren Vergnügen und Sport der Jugend ritterlichen Standes. Der Jagd mit dem Falken, die mehr und mehr zu einem fürstlichen Privileg werden sollte, wandte auch später Albert der Große seine besondere Aufmerksamkeit und Beobachtungskunst zu. Zum jungen Mann herangereift, ging Albert nach Italien. Noch gab es keine Universitäten in Deutschland. Bis zur Gründung der ersten deutschen Universitäten sollten mehr als anderthalb Jahrhunderte verstreichen. Die Universität Padua hatte sich Ansehen durch das Studium der Rechtswissenschaft und der Medizin erworben, beides Disziplinen, mit denen sich der junge Schwabe beschäftigte. 1222 erlebte Albert das schwere Erdbeben, das Brescia heimsuchte. Dann besuchte er Venedig, die übrige Zeit war er zum Studium in Padua. In dieser Zeit machte er sich mit der antiken, vor allem der griechischen philosophischen und naturwissenschaftlichen Literatur, soweit sie in lateinischen übersetzungen vorlag, vertraut. Nach der Überlieferung war er noch ein iuvenis, ein junger Mann, als er Jordan von Sachsen, den Generalmeister des Predigerordens und Nachfolger des hl. Dominikus, kennenlernte und sich unter dem Eindruck seiner Predigten zum Eintritt in den Orden entschloß. Das spricht für einen Eintritt im Jahre 1223 noch in Padua. Freilich ist auch dieses Datum ebensowenig unumstritten wie der Ort der Aufnahme in den Orden. Aber immerhin spricht für das Jahr 1223 und den Ort Padua einige Wahrscheinlichkeit. Nach der Überlieferung machte sich Albert seinen Entscheid nicht leicht. Selbstzweifel quälten ihn, ob er dem einmal gewählten Beruf sein Leben lang die Treue zu halten vermöge. Die Hellsichtigkeit Jordans erkannte die Gründe für diese Selbstzweifel und vermochte sie zu beheben. Der Eintritt in den Predigerorden wurde für das weitere Leben des Schwaben entscheidend. Der Predigerorden war zu dieser Zeit noch eine junge Gründung. Er verdankte sein Entstehen der gleichen Armutsbewegung, der auch der Orden des hl. Franziskus, der Orden der Minderbrüder, angehört und der auch die Orden der Augustinereremiten und der Karmeliter zuzurechnen sind. Eine reich gewordene Kirche war vielen Menschen des hohen Mittelalters bereits ein Ärgernis geworden. Sie sehnten sich nach einer Kirche der apostolischen Einfachheit und Armut. Da sie dies in der eigenen Kirche nicht fanden, suchten sie ihr Heil bei anderen Gemeinschaften, nicht zuletzt der der Waldenser. In Südfrankreich hatte zudem die Sekte der Katharer, nach ihrem Hauptort Albi auch Albigenser genannt, einen großen Anhang gewonnen. Der Dualismus ihres Glaubens, der schroff den guten Gott und die böse Welt, die vom Gegengott beherrscht wird, gegenüberstellte, hatte ebenso anziehend gewirkt wie die Einfachheit des Lebens ihrer Prediger. Den an ihrer Kirche Zweifelnden ein Heimatrecht zu schaffen, sie in ihrer Kirche wieder heimisch werden zu lassen, war die Absicht des h1. Dominikus, als er die Predigergemeinschaft von San Romano in Toulouse 1206 gründete. Sie wurde 1216 von Papst Honorius III. als Orden der Predigerbrüder bestätigt. Da ein Jahr zuvor das vierte Laterankonzil die Neugründung von Orden verboten hatte, falls diese nicht eine bereits bestehende Ordensregel übernähmen, hatte sich Dominikus entschlossen, für seinen neuen Orden die Regel des h1. Augustinus zu wählen und diese durch eigene Satzungen zu ergänzen. Das Neuartige seines Ordens lag darin, daß die alte Devise ora et labora, bete und arbeite, jetzt so verstanden wurde, daß die eigentliche Arbeit des Predigerbruders sein Studium war. Dieses Studium war allerdings kein Selbstzweck. Es stand vielmehr im Dienst der Erschließung der Glaubenswahrheiten. Wahrheit also war und ist das Stichwort, dem der Orden verpflichtet ist. Seine Aufgaben umschreibt er mit der Forderung laudare, benedicere, praedicare – Gott loben, in seinem Namen segnen, seine Wahrheit künden. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, sandte gleich nach der Bestätigung des Ordens der h1. Dominikus den größten Teil seiner Mitbrüder in die beiden Universitätsstädte Bologna und Paris. Bologna pflegte das Studium der Rechtswissenschaft, Paris war berühmt durch sein theologisches Studium. Aus den Studenten der Universitäten rekrutierte sich auch in den folgenden Jahren ein nicht geringer Teil des Nachwuchses des Ordens. Jordan von Sachsen berichtet in einem seiner Briefe, daß er in Padua einmal nicht weniger als 30 Studenten für den Orden gewonnen habe. Eine so große Zahl konnte unmöglich in dem verhältnismäßig kleinen Kloster des Ordens in Padua untergebracht werden. Sie mußte auf mehrere Klöster verteilt werden. So wurde Albert der Große nach Deutschland gesandt in das Kölner Kloster, das seit 1221 bestand. So läßt sich auch jene Tradition, nach der Albert in Köln das Ordensgewand genommen hat, mit der paduanischen verbinden. In Padua wurde er als Predigerbruder eingekleidet, sein Noviziat machte er in Köln. Schon bald wurde Albert eine Lehrtätigkeit übertragen. Zu den Besonderheiten des Predigerordens gehörte es, daß neben dem Amt des Oberen, des Priors, das zweitwichtigste Amt im Konvent das des Lesereisters war, des Lektors in S. Theologia. Zwei Aufgaben hatte der Lesereister zu erfüllen. Er mußte den Ordensnachwuchs in den Anfangsgründen der Theologie unterrichten, nicht selten sogar die gesamte theologische Ausbildung leiten, und er mußte seine Mitbrüder in der Lösung praktischer Seelsorgsfragen unterweisen. Wenn wir die Ausbildungsjahre für Albert im Orden auf etwa vier bezifern, ergibt sich als Anfang für eine eigene Lehrtätigkeit das Jahr 1227/28. Von da an war er als Lesemeister in den Konventen seines Ordens zu Freiburg, Hildesheim, Regensburg und Straßburg tätig. In diesen Jahren arbeitete er an seiner Schrift ›De natura boni‹. Daneben setzte er das Studium der aristotelischen Schriften und das der arabischen Kommentare, das er bereits in Padua begonnen hatte, fort. Diese Lehrtätigkeit dauerte bis 1240 oder 1242. Anscheinend vermochte Albert bei seinen Mitbrüdern ein großes Ansehen zu gewinnen. Die Überlieferung weiß zu berichten, daß er nach dem Tod Jordans von Sachsen an dem Generalkapitel seines Ordens 1238 in Bologna teilgenommen habe und ihm die Stimmen der deutschen Wähler und ihrer Verbündeten zugefallen seien. Sein Gegenkandidat war Hugo von St. Cher. Keiner der bei den Kandidaten erreichte jedoch die notwendige Stimmenmehrheit. Aus der deswegen notwendig werdenden zweiten Wahl ging als Kompromißkandidat der Spanier Raymund von Pennaforte als Sieger hervor. Läßt sich diese Überlieferung auch nicht beweisen, so ist sie dennoch ein wertvolles Indiz für das Ansehen, das Albert inzwischen unter seinen Mitbrüdern gewonnen hat. Auch macht sie bereits deutlich, was ja für das Leben Alberts des Großen wirklich zutraf, daß er mehr war als nur ein Stubengelehrter, daß er fähig und willens war, in seinem Orden leitende Ämter zu übernehmen.
Für seine wissenschaftliche Laufbahn aber bedeutete die Berufung nach Paris den entscheidenden Wendepunkt. 1243/44 ist Albert nach Paris übergesiedelt, hat dort über die Sentenzen des Petrus Lombardus gelesen. 1245/46 wurde er zum Doctor in S. Theologia promoviert. Das bedeutete, daß er damit dem Professorenkollegium der theologischen Fakultät der Universität Paris angehörte. Dem Predigerorden waren früh schon zwei Lehrstühle an dieser Fakultät zugefallen. Der Eintritt eines Theologieprofessors in den Orden ermöglichte diesem, fortan dessen Lehrstuhl für sich zu behaupten. Damit war freilich sehr schnell eine Konfliktsituation zwischen Welt- und Ordensgeistlichen an der Universität Paris gegeben, dies um so mehr, als die Ordensgemeinschaft als solche bessere, weil sorgenfreie Lebensbedingungen auch für ihre Studenten zu bieten vermochte, als es den Weltgeistlichen möglich war. Erst durch die Gründung von Bursen für unbemittelte Studenten, wie Robert von Sorbon eine stiftete, die später so berühmte Sorbonne, wurde die Konkurrenzsituation gemildert. Als Albert seine Lehrtätigkeit begann, war sie allerdings noch ebensowenig zu spüren, wie die Konkurrenz innerhalb der Orden, insbesondere der Franziskaner und Dominikaner. Wegen des Ansehens, das ein Doctor Parisius als Gelehrter genoß, war der Orden bestrebt, möglichst vielen seiner Mitbrüder die Chance zu einer Promotion an der Pariser Universität einzuräumen. Er begrenzte daher die Lehrtätigkeit der Magistri bzw. der Doctores in S. Theologia auf jeweils drei Jahre. Den einen der beiden Lehrstühle reservierte er jeweils einem französischen Dominikaner, den anderen einem nichtfranzösischen. Somit war auch Alberts Tätigkeit als Professor an der Pariser Universität auf drei Jahre begrenzt, 1245–48. Aus dem letzten Jahr liegt die erste urkundliche Bezeugung Alberts vor. In der Pariser Universitätsurkunde vom 15. Mai 1248 bezeichnet er sich als Fr. Albertus Theutonicus. Mit anderen Pariser Professoren unterzeichnete er ein Dekret gegen den Talmud. In Paris hatten die ersten Talmudverbrennungen stattgefunden. Die talmudfeindliche Haltung der Universität Paris sollte noch nachwirken bis in den Streit um die Erhaltung oder Verurteilung der Bücher der Juden, der unmittelbar vor Beginn der Reformation zwischen Pfefferkorn und Reuchlin geführt wurde. Albert erweist sich als Kind seiner Zeit, wenn er der Talmudverurteilung zustimmt. Aber der gleiche Gelehrte erweist sich als zum virtuellen Dialog mit jüdischen Denkern befähigt. Insbesondere setzt er sich mit dem ›Führer der Unschlüssigen‹ des Moses Maimonides auseinander. Maimonides liefert ihm Argumente für die Frage nach der Schöpfung in der Zeit und der Vereinbarkeit dieses Glaubenssatzes mit der philosophischen Einsicht. Aber auch sonst nutzt Albert gerne das Werk des Moses Maimonides. In Paris hatte bereits Peter Abaelard Theologie als Wissenschaft im aristotelischen Sinne gelehrt. Zwar gab es auch schon zuvor ein Verständnis von Theologie als Wissenschaft, aber erst jetzt setzte sich das Verständnis von Theologie als Wissenschaft im aristotelischen Sinne durch, d.h. also Wissenschaft wie die anderen, in ein System zu bringen mit den profanen Wissenschaften. Dann mußte das Verhältnis von Philosophie und Theologie bedacht werden, dann mußte man sich darüber klarwerden, daß das Studium der Philosophie auch für die Theologie nicht folgenlos bleiben konnte, daß vielmehr von der Philosophie aus auch die Theologie mitbestimmt wird. Dann galt es, ein philosophisches System zu finden, das allumfassend war. Dies war gegeben in den Werken des AristoteIes. Diese Werke in ihrer Gesamtheit zu erschließen und sie auch für den Theologen fruchtbar zu machen, erkannte Albert als seine Lebensaufgabe. Er verschrieb sich ihr, obwohl er sich damit zahlreichen Anfeindungen aussetzte. Das aristotelische Denksystem war ein offenes. Das reizte ihn. Darum zog es ihn zu den Werken des Aristoteles, aber auch der Denker, die sich ebenfalls der aristotelischen Methode bedienten, wie z.B. Moses Maimonides. Jetzt wird uns verständlich, wieso Albert den Talmud ablehnen, aber einen jüdischen Denker rezipieren konnte. Neben den Werken des Maimonides interessierten ihn aber auch die Schriften eines neuplatonisch orientierten jüdischen Denkers wie Avencebrol. Dessen ›Fons vitae‹ las er ebenso wie den ›Führer der Unschlüssigen‹ des Maimonides. Aristotelische und neuplatonische Werke empfand er überhaupt nicht als so gegensätzlich, daß das Studium des einen das des anderen ausgeschlossen hätte, im Gegenteil. Darum konnte er im ›Liber de causis‹ die Vollendung der aristotelischen Metaphysik sehen. Erst Thomas von Aquino sollte aufgrund der ›Elementatio theologica‹, des Hauptwerkes von Proklos, in der lateinischen Übersetzung des Wilhelm von Moerbeke, erkennen, daß der ›Liber de causis‹ in Wahrheit ein Konzentrat aus diesem Werk ist. Auch die Schriften jenes Theologen, der seine Identität hinter dem Namen des Apostelschülers Dionysius Areopagita zu verbergen wußte, um seinem Werk damit den Erfolg zu sichern, schätzte Albert hoch ein. Gleichwohl liegt sein eigentliches Verdienst für die Philosophie in der Erschließung der aristotelischen Schriften. Wie freilich Aristoteles zu deuten war, blieb umstritten. Mußte eine authentische Interpretation nicht die Widersprüche zwischen philosophischer und theologischer Einsicht schmerzhaft spürbar machen? Daß das Studium des Aristoteles zu Ergebnissen führen könnte, die mit dem Glauben nicht zu vereinbaren waren, zu einem Pantheismus etwa, war die Furcht Roms. Zum mindesten einige der Pariser Professoren schienen durch ihre Lehre die Berechtigung dieser Furcht zu beweisen. So erklären sich die Aristotelesverbote Roms, die mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder ausgesprochen wurden. Sie galten bemerkenswerterweise nur für die Universität Paris, betrafen also nicht das Aristotelesstudium an anderen Orten. Nur in Paris schien die Konfliktsituation gegeben zu sein. Wollte man einerseits offenen Ungehorsam vermeiden, aber andererseits auch nicht die Fähigkeit der verstandesmäßigen Einsicht preisgeben, so war dies nur möglich, wenn sich die Vereinbarkeit von philosophischem und theologischem Studium beweisen ließ, wenn es gelang, die Schriften des Aristoteles so zu interpretieren, daß sie zumindest nicht im Widerspruch zu den Aussagen des Glaubens standen; das war es, was sich Albert und später sein Schüler Thomas von Aquino zum Ziel setzten. Wie erfolgreich er darin war, erfahren wir aus dem Munde des ihm wenig wohlgesonnenen Franziskanertheologen Roger Bacon, der von ihm, freilich sehr übertreibend, behauptet, er gälte in Paris als Autorität. Die Absicht des hl. Albert, das gesamte aristotelische Schrifttum zum geistigen Eigentum des Abendlandes zu machen, stößt auf Widerspruch. Dieser Widerspruch erhebt sich sowohl außerhalb als innerhalb seines Ordens. Sein Zeitgenosse, der hl. Bonaventura, ist davon überzeugt, daß die Theologie dominierend sein muß, die Philosophie nur eine Dienstfunktion haben kann. Sein heilsgeschichtliches Denken veranlaßt ihn zu dieser Position. Das Menschenbild, das die Philosophie zeichnet, ist falsch, wenn sie von der Heilsgeschichte absieht. Es gibt den Menschen nicht in sich, sondern nur bestimmt durch die Zeit vor oder nach der Erbsünde, die Zeit vor oder nach der Erlösung. Philosophie, die vorgibt, den Menschen unabhängig von seiner heilsgeschichtlichen Situation zu zeichnen, führt in die Irre. Daher sind die großen Philosophen Aristoteles sowie Avicenna für Bonaventura Irrlehrer. Albert aber und in seinem Gefolge Thomas von Aquino vertrauen darauf, daß die Verstandeseinsicht Richtiges begreift. Der Mensch kann also auch unter Absehen von seiner heilsgeschichtlichen Situation grundsätzlich richtig erfaßt werden. Die Ereignisse der Heilsgeschichte verändern nicht grundsätzlich die Natur des Menschen. Freilich darf die Erkenntnis, die auf dem Wege des Verstandes, also mit den Mitteln der Philosophie möglich ist, nicht im Widerspruch zur Glaubenserkenntnis stehen. Zwar schreibt der Glaube der Philosophie nicht die Ergebnisse vor, aber er wirkt doch als ihre regula negativa. Das heißt, er zeigt die Grenzlinien auf, die Philosophie nicht überschreiten darf, wenn sie nicht in die Irre gehen will. Albert und Thomas sind davon überzeugt, daß eine Harmonie zwischen philosophischer und theologischer Erkenntnis möglich ist. Für eine glückliche Stunde in der Geistesgeschichte der Menschheit stellen sie diese Harmonie sogar her. Aber sie wird noch zu ihren Lebzeiten wieder in Frage gestellt. Zu Beginn der 70er Jahre bricht der Kampf erneut aus. Die Vertreter der philosophischen Richtung treten für den authentischen Aristoteles ein. Sie leugnen zwar nicht die Offenbarungswahrheiten, halten aber die Aporie zwischen Glaubenseinsicht und philosophischer Erkenntnis für unaufhebbar. Thomas von Aquino sollte während seiner zweiten Lehrtätigkeit in Paris direkt in den Streit verwickelt werden. Für Albert aber sollte es sich um Fragen handeln, die ihn bereits innerlich nicht mehr tangierten, denen er durch seine spätere Tätigkeit im Grunde sehr ferngerückt war. Die Gefahr von innen war durch die Abneigung des Ordens gegeben, sich auf ein philosophisches Studium als solches einzulassen. Zwar waren durch den Eintritt von Studenten und Professoren philosophische Gedanken notwendigerweise rezipiert worden, denn die philosophisch Gebildeten konnten ja nicht einfach nach ihrem Ordenseintritt ihre Bildung vergessen oder verdrängen. Aber im Ausbildungsgang des Ordens spielte die Philosophie während der ersten Jahrzehnte eine geringe Rolle. Ja, das Studium der Philosophie erschien sogar als Ablenkung vom Eigentlichen. Hauptaufgabe des Professors der Theologie war die Auslegung der Heiligen Schrift. Das Studium sollte der Vorbereitung auf die Verkündigung dienen. Zu verkünden galt es das Wort Gottes. Also warum denn sollte sich der Student zersplittern, mit Fragen beschäftigen, die ihn vom Eigentlichen nur ablenkten. Albert aber schien eine solche Argumentation eher ein Zeichen für Denkfaulheit als für Frömmigkeit zu sein. Unmutig konnte er sich bei solchen Streitreden gegen die Philosophie an die Gesinnung der Athener erinnert fühlen, die Sokrates den Schierlingsbecher gereicht und Aristoteles in die Verbannung getrieben haben. Mit seiner Ansicht, daß die Philosophie die jeweilige Theologie mitbeeinflusse, daß daher das Studium der Philosophie notwendig sei, drang Albert schließlich in seinem Orden durch. Gemeinsam mit Peter von Tarantaise und Thomas von Aquino erarbeitete er für das Generalkapitel von Valenciennes 1259 eine Studienordnung, die der Philosophie einen legitimen Platz einräumt. Seither ist sie fest in das Programm der Ausbildung des Nachwuchses aufgenommen. Nicht nur die Akten der Generalkapitel, sondern auch die der Provinzkapitel enthalten Bestimmungen über ihr Studium.
Inzwischen hatte freilich Albert der Große seine Lehrtätigkeit in Paris längst beendet. Nach dem dreijährigen Kurs, den er seit 1245 gegeben hatte, wurde er jetzt, 1248, mit dem Aufbau eines Generalstudiums in Köln betraut. 1248 war aber auch das Jahr der Grundsteinlegung des gotischen Kölner Doms. Die Legende sieht in Albert den Erfinder seines Plans. Sie hat nur insofern recht, als sich die Architektur theologischen Denkens mit der Baukunst vergleichen läßt. Albert hat in seinen Werken zwar Elemente zu einer Schönheitslehre vorgetragen, aber nie eine eigentliche Kunsttheorie entwickelt, noch Interesse für Kunstwerke im einzelnen bezeugt. Wohl berichtet er von den Ausschachtungsarbeiten für die Legung der Fundamente des Chores des gotischen Doms, weil dabei antike Marmorfußböden entdeckt wurden. Aber sein Interesse ist doch mehr ein archäologischhistorisches als ein eigentlich kunsthistorisches. Was aber bewog den Orden zur Gründung von Generalstudien außerhalb Paris? Es war sein rasches Wachstum, das diesen Entscheid als wünschenswert erscheinen ließ. Selbst wenn nur die Elite der Studenten für das Studium in Paris ausgewählt wurde, reichten doch die Unterbringungsmöglichkeiten nicht. Darum also errichtete der Orden in vier seiner Provinzen, darunter in der deutschen Ordensprovinz je ein Generalstudium. Das in Köln gegründete darf in etwa als ein Vorläufer der am Ende des 14. Jahrhunderts gegründeten Universität verstanden werden. Allerdings unterschieden sich die Generalstudien von den Universitäten schon dadurch, daß ihnen das Promotionsrecht fehlte. Mit dem Pariser Studium hatten die Generalstudien aber ihre Internationalität gemeinsam. Nur der wissenschaftlich überdurchschnittlich begabte Nachwuchs der jeweiligen Ordensprovinz sollte für das Generalstudium ausgewählt werden. Für die anderen mußte das jeweilige Hausstudium genügen. Dafür sollte jede andere Ordensprovinz ebenfalls das Recht haben, zwei besonders begabte Studenten an das Generalstudium zu entsenden. Da die Predigerbrüder, die Dominikaner, von Almosen lebten, keine Landwirtschaft betrieben, anfänglich auch nur wenigen Grundbesitz in der Stadt hatten – später allerdings erbten sie Grundrenten –, war die wirtschaftliche Basis für die Errichtung eines Generalstudiums in Köln schmal. Aus den Akten der Generalkapitel des Ordens ergibt sich, daß die Anfänge des neuen Studiums in Köln tatsächlich mit großen Schwierigkeiten verbunden waren. Schon deswegen war eine Begrenzung der Studentenzahlen notwendig. Wenn trotzdem von Anfang an das Studium in Köln einen internationalen Charakter besaß, wenn es trotz der wirtschaftlichen Notlage schnell an Ansehen gewann, so verdankte es dies dem Ansehen, das sein erster Leiter, Albert der Große, besaß. Die Internationalität des Kölner Studiums schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts ist uns nicht zuletzt durch den Dominikaner Petrus von Dacien bezeugt, der gemeinsam mit einigen Mitstudenten, Mitgliedern verschiedener Ordensprovinzen, zu der frommen Christina von Stommeln pilgerte und über seinen Besuch bei ihr anschaulich berichtete. Der bedeutendste der ausländischen Studenten am Kölner Generalstudium war zweifelsohne der hl. Thomas von Aquino. Wann er Alberts Schüler wurde, ist nicht sicher festzustellen. Nach der einen Tradition wurde er vom Ordensmeister an das Pariser Studium 1245 entsandt und studierte dort bereits unter Albert dem Großen, nach der andem Tradition aber wurde er – ohne den Umweg über Paris – gleich nach Köln delegiert. In diesem Falle hätte sein Studium erst 1248 begonnen. Wie dem auch sei: unbezweifelbar ist jedenfalls, daß Thomas von Aquino in Köln unter Albert dem Großen studiert hat, daß dieser seine Begabung früher als andere erkannte und ihn daher entscheidend förderte. Der Empfehlung des hl. Albert verdankte wenige Jahre später Thomas seine Berufung nach Paris, um dort als Baccalaureus zu lesen und den Grad eines Magisters der hl. Theologie zu erwerben. Legenden ranken sich um das Verhältnis von Lehrer und Schüler. Sie wissen zu berichten, daß die Mitstudenten dem Aquinaten wegen seiner Schweigsamkeit den Spitznamen „Stummer Ochse von Sizilien“ gaben, Albert aber dagegen Einspruch erhob und voraussagte, daß der so Verspottete mit seinem Gebrüll die Welt erschüttern werde. über den unerwarteten Anblick eines Roboters in der Zelle seines hochverehrten Lehrers sei Thomas so erschrocken gewesen, daß er in seiner Bestürzung das Kunstwerk mit einem Stock zerschlagen habe. Der Wahrheitskern dieser Legende ist, daß die größere Kraft zur Synthese, die Thomas zu eigen war, innerhalb des eigenen Ordens zwar nicht sofort, wohl aber im Laufe des 14. Jahrhunderts über die Universalität des hl. Albert den Sieg davontrug. Daß Thomas von Aquino ein sehr aufmerksamer Schüler des hl. Albert war, läßt sich übrigens auch sehr gut mit einem Hinweis auf die Reportatio, die Vorlesungsnachschrift, belegen, die mit großer Wahrscheinlichkeit aus seiner Feder stammt. Die Nationalbibliothek in Neapel bewahrt die Vorlesungsmitschrift des Dionysiuskommentars, den Albert vielleicht schon 1247 in Paris begonnen, sicher aber in Köln 1248 vorgetragen hat. Aus der gleichen Feder stammt die Nachschrift der Erklärungen, die Albert nach 1248 zur aristotelischen Ethik in Köln vortrug. Einer der vertrautesten deutschen Schüler Alberts war Ulrich von Straßburg, später Provinzial der deutschen Ordensprovinz. Von ihm sind Briefe an den verehrten Lehrer und Freund erhalten geblieben. Als Gelehrter verfaßte Ulrich eine ›Summa de bono‹.
Wie in Paris, so war es auch am Kölner Generalstudium die wichtigste Aufgabe für Albert, die Heilige Schrift auszulegen. Daneben aber setzte er seine Aristoteleskommentare fort. Jetzt stand er auf dem Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Laufbahn. Zwei Autographe blieben Köln erhalten, sind heute kostbarer Besitz des Historischen Archivs der Stadt, der Matthäuskommentar und die Tierbücher, Belege der universalen Bildung des Gelehrten. Als Kommentator bevorzugte Albert die Form der Paraphrase. Unvermittelt schließt die eigene Ausführung an die Vorlage an, in den Handschriften zuweilen schwer von ihr zu unterscheiden. Erst die neueren Editionen haben in manchen Fällen wirklich deutlich gemacht, was Alberts eigene Meinung, was nur Wiedergabe der Vorlage ist. Auch bedarf es nicht selten erst eines geduldigen, sorglichen Lesens, bis klar ist, was nur als Denkmodell zu gelten hat, was die wirkliche Meinung des Autors ist. So wichtig seine Leistung als Philosoph ist, sein Bestes gibt er in der Naturwissenschaft. Vor allem die Tier- und Pflanzenkunde zieht ihn an. Zwar vereinbart sich mit seiner grundsätzlich rationalen Einstellung nur schwer sein Vertrauen gegenüber den elementaren Kräften der Magie – ein Magier, ein Doktor Faustus war er freilich nicht –, doch teilt er diese Neigung mit vielen mittelalterlichen Denkern. Auch ist es überraschend festzustellen, daß er trotz seiner Grundentscheidung für die Eigenbeobachtung, die es ihm möglich macht, manches als sicher Geltendes in den Bereich der Fabel zu verweisen, zuweilen zu leicht Fremdberichten Vertrauen schenkt, sich als allzu leichtgläubig erweist. Auch darin ist er Kind seiner Zeit. Insoweit ist er tatsächlich noch nicht ein Naturwissenschaftler im modernen Sinn. Aber er unterscheidet sich doch schon erheblich von seinen Vorgängern und Zeitgenossen, auch den eigenen Mitbrüdern, den Enzyklopädienverfassern Vinzenz von Beauvais und Thomas von Cantimpré, die trotz mancher richtiger Einzelbeobachtung Buchgelehrte bleiben, dem antiken Vorbild verhaftet sind. Albert aber nimmt die Bücher der Antike zwar als Vorlage, läßt sich aber im allgemeinen von ihnen nicht das Urteil vorschreiben, beobachtet selbständig, wagt das Experiment. Er setzt die Experimente sinnvoll ein, nimmt dazu die Materialien aus dem Alltäglichen, stellt z.B. Experimente mit Hühnereiern an. Seine Beobachtungsgabe war freilich stärker als seine Reflexion. Darin lag eine Grenze. Als Theoretiker folgt er unbedenklich Aristoteles und Avicenna. Aber in den Beobachtungen war er wirklich eigenständig. Der unscheinbare Schwamm fand ebenso sein Interesse wie die höchst entwickelten Pflanzen und Tiere. Die Lebensäußerungen des Menschen setzte er – darin ein echter Biologe – immer wieder in Parallele zu den entsprechenden der Tierwelt. Wertvoll ist für uns, daß er die antiken Tier- und Pflanzennamen mit den in seiner Zeit gebräuchlichen verglich; denn so gibt er uns zugleich Aufschluß über Fauna und Flora seiner Zeit. Manche der Tierarten, die er in Deutschland beobachten konnte, sind in der Neuzeit verschwunden, ausgerottet worden. Hier sind uns die Aufzeichnungen des hl. Albert ganz und gar unentbehrlich. Zukunftweisend waren seine Versuche zur Systematik. Erst die Neuzeit sollte ihn da übertreffen. Albert fragt nach den Zielursachen, die die Naturvorgänge bestimmen, stellt fest, daß die Natur immer nur auf eine Wirkweise angelegt ist, so daß die Schwalbe ihr Nest jeweils auf die gleiche Weise baut, die Spinne ihren Faden ebenfalls stets auf die gleiche Weise zieht. Allein dem Menschen ist die Freiheit zur Variation gegeben. Darin liegt der Vorzug des Menschen. Freilich ist damit auch die Verantwortung gegeben, die der Freiheit geschuldet ist. Von den Tierbüchern, den ›De animalibus libri XXVI‹, Alberts sind die ersten neunzehn Aristotelesparaphrase, das 20. und 21. Buch sind selbständige Abhandlungen Alberts, während er für die Schilderung der einzelnen Tierarten in den Büchern XXII–XXVI die Schrift ›De natura rerum‹ (Über die Natur der Dinge) seines Mitbruders Thomas von Cantimpré als Vorlage benutzt. Diese letzten fünf Bücher übersetzte der Straßburger Arzt Walter Hermann Ryff (t 1548) ins Deutsche und ließ seine Übersetzung 1545 in Frankfurt drucken. Wie in der Tier-, so suchte auch in der Pflanzenkunde Albert von einem aristotelischen Werk auszugehen. Die im Mittelalter als Werk des Aristoteles geltende Pflanzenkunde ist freilich in Wahrheit von Nikolaus von Damaskus verfaßt worden, der erst in der Zeit des Herodes des Großen lebte. Freilich hat dieser viel aristotelisches Gedankengut verwertet. Alberts ›De vegetabibilibus libri VII‹ sind teils Kommentar der Pflanzenkunde des Nikolaus von Damaskus, Buch 1 und 4, teils gänzlich selbständige Arbeit, bei der er sich nur auf seine Beobachtung verläßt. Die Legende läßt Albert dem König Wilhelm von Holland mitten im Winter gelegentlich seines Besuches im Kölner Dominikanerkloster einen blühenden Garten vorzaubern. Der Magus ist es, der die Gemüter bewegt. Doch bedarf es der Mär nicht, Alberts Verdienste als Pflanzenkundler zu rühmen. Er wußte um Schönheit und Nutzen der Pflanzen, gab Ratschläge für den Ackerbau, die Anlage von Nutzwäldern und Ziergärten. Der mittelalterliche Garten, so wie ihn der große Schwabe beschreibt, ist freilich, verglichen mit den von dem jüngeren Plinius geschilderten antiken, verglichen auch mit den neuzeitlichen blumenreichen Gärten, recht bescheiden, fast arm. Er ist der freien Natur angenähert. Wiese, ein stein gefaßter Brunnen in der Mitte, Bäume am Rande! Albert achtet auf die klimatischen Bedingungen, bedenkt die Gesetze der Ökologie, ist darin wieder ganz modern. überdies legte er, Theorie und Praxis verbindend, für sein Kölner Kloster einen botanischen Garten an.
Nicht nur als Gelehrter, sondern auch als Mensch, der guten Rat weiß, gewann Albert Ansehen, mehr noch Autorität. Seinem Urteil schenkte man Vertrauen, seinem Schiedsspruch beugte man sich. Bisher sind neunzehn schiedsrichterliche Tätigkeiten des großen Schwaben bekannt geworden. Davon sind zwölf Schiedssprüche urkundlich erhalten. Seinem Schiedsspruch unterwarfen sich ebenso die politischen Parteien – das Wort cum grano salis verstanden – der Bürgerschaft und des Erzbischofs von Köln, wenn es um die Abgrenzung der jeweiligen Rechtsansprüche ging, als auch die einzelnen miteinander streitenden Bürger wie etwa in Würzburg, als durch den Bau einer Scheune dem Nachbarhaus das nötige Sonnenlicht genommen wurde. Der endgültige Text des Schiedsspruchs ist gewiß ein Gemeinschaftswerk, an dem auch die streitenden Parteien mitbeteiligt waren. Er kann Albert somit nicht alleine zugeschrieben werden. Wie groß aber tatsächlich sein Einfuß auch auf die endgültige Textgestalt war, läßt sich dort sehr gut erweisen, wo der Vorentwurf, der aus seiner Feder stammt, erhalten ist. Das gilt gerade für seine erste Kölner Friedensvermittlung 1252. Das Motiv: Pro bono pacis – Wirken für die Wiederherstellung des Gutes des Friedens –, mit dem er seine Schiedswirkung am 17. April 1252 begründet, zieht sich wie ein roter Faden durch seine gesamte schiedsrichterliche Tätigkeit. Die die Bürgerschaft als ganzes wie den einzelnen bewegenden Streitfälle wirken lähmend. Die im Streit zwischen dem Erzbischof als Landesherrn und der Kölner Bürgerschaft verhängten Interdikte unterbanden den öffentlichen Gottesdienst. Das war schlimm genug, wenn auch die Waffe des Interdikts, weil so häufig angewandt, allmählich stumpf zu werden begann. Schlimmer noch war aber, daß der Groll sich, je länger und schwerer der Streit war, desto tiefer in die Herzen nistete, den Menschen an das Irdische band, den Aufschwung der Seele zu Gott verhindern mußte. Albert war Dominikaner, Predigerbruder, Seelsorger und Priester. Dieser Aspekt seiner Berufung und seines Berufes darf nicht übersehen werden, will man ihn recht verstehen. Auch als Gelehrter blieb er zuerst und zuletzt Seelsorger. Das war der Grund, der ihn die Gelehrtenstube verlassen und in die Streitfälle mit seinem Schiedsspruch eingreifen ließ. Er war sich klar darüber, daß er einen Kompromiß vorschlagen mußte, es vermeiden mußte, daß die eine über die andere Partei restlos triumphierte, wenn das Gut des Friedens erreicht werden sollte. Eine völlige Niederlage würde keine Partei verwinden. Groll bliebe zurück. Gerade das aber wollte Albert vermeiden. Auch so noch blieb mancher Friedensschluß recht fragil, gefährdet und zerbrechlich. Immer waren die Einsicht und das Augenmaß für das Mögliche, die auf beiden Seiten vonnöten waren, Voraussetzung für einen über den Tag hinaus dauernden Friedensschluß. Die Schiedssprüche, die Albert der Große zwischen dem Kölner Erzbischof als Landesherrn und der Stadt Köln fällen mußte, sind in ihrer ständigen Wiederholung ein Zeichen für die Schwierigkeit, einen dauernden Frieden, einen Ausgleich zwischen den Ansprüchen beider Seiten zu erzielen. Es war dies nicht nur eine Sache des mangelnden guten Willens der Parteien, sondern die Schwierigkeit, einen dauerhaften Kompromiß zu erzielen, lag auch in der Dynamik der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung, die im Widerspruch zu den Versuchen der Festschreibung der überkommenen Macht- und Rechtsverhältnisse stand. Der Streit zwischen der Stadt Köln und dem Erzbischof Konrad von Hochstaden, demselben, der 1248 den Grundstein zu dem gotischen Dom gelegt hatte, wurde 1252 durch dessen Versuch ausgelöst, die bisher umlaufende höherwertige Münze einzuziehen und durch eine geringwertigere zu ersetzen. Die Kölner Bürger sahen ihren Handel dadurch gefährdet, glaubten darüber hinaus ihre Freiheit bedroht. In seinem Vorausspruch erkannte Albert das grundsätzliche Einspruchsrecht der Stadt gegen eine Münzverschlechterung an, gestand aber für den gegenwärtigen Fall dem Erzbischof das Recht zu, die bisher umlaufenden Münzen einzuziehen und eine Neuprägung vorzunehmen. Er begründete dies seinerseits mit dem Hinweis auf die Abgegriffenheit und dadurch bereits gegebene Verschlechterung der umlaufenden Münzen. Es sei daher notwendig, „daß zu einer einzigen Umschrift und zu einem Bilde zurückgekehrt und deren Aussehen so deutlich und klar gestaltet werde, daß von nun an leicht von jedem eine fremde Fälschung erkannt werde“. Um der Stadt ihr grundsätzliches Recht zu wahren, ließ Albert die in Vergessenheit geratene Einrichtung der Münzproben wiederaufleben. Seine Vorschläge wurden in den endgültigen Text des Schiedsspruchs aufgenommen, an dem außer ihm noch der päpstliche Legat Hugo von St. Cher, Dominikaner gleich ihm, mitwirkte. Am berühmtesten aber wurde der sogenannte „Große Schied“ von 1258, in dem Albert den Ausgleich der politischen und wirtschaftlichen Interessen zwischen der Stadt Köln und dem Erzbischof Konrad von Hochstaden vermittelte. Wichtig für die künftige Entwicklung wurde, daß die Stadt, obwohl sie Konrad von Hochstaden als Stadtherrn anerkannte, dem sie sich unterwarf, dennoch in der Ausfertigung des Schiedsspruchs als gleichberechtigter Partner erscheint. Daß für Konrad die Stadt Krone und unverzichtbarer Besitz seiner Landesherrschaft war, ist verständlich. Immerhin besaß er ein Gespür für das politisch Mögliche. Dies jedoch sollte seinen Nachfolgern, Engelbert 11. von Falkenburg und Siegfried von Westerburg, fehlen. Erzbischof Konrad von Hochstaden beließ nach einer „Revolution von oben“, die die Zünfte begünstigte, den neuen zünftlerischen Gewalthabern in der Stadt Köln den äußeren Schein der Selbständigkeit. Engelbert 11. suchte auch diesen der Stadt zu nehmen. Die Parteien in der Stadt einigten sich, die Patrizier, die 1259 vertrieben waren, kehrten zurück. Die alten Geschlechter übernahmen das Regiment. überdies gewann die Stadt im Rheinland zahlreiche Verbündete. Der Erzbischof mußte sich zur Sühne bereitfinden, 1263. Nachhaltiger und für ihn verhängnisvoller war sein erneuter Streit mit der Stadt, bei dem er in die Gefangenschaft des Grafen von Jülich, des Verbündeten der Stadt, geriet. Dreieinhalb Jahre mußte er als Gefangener auf Burg Nideggen ausharren. Diesen schweren Konflikt zu beheben, wurde ebenfalls Albert der Große ausersehen. Es war der Anlaß zu seiner Rückkehr nach Köln.
Die Lehrtätigkeit in Köln fand nämlich eine langjährige Unterbrechung. Wie Albert um seines Rates willen vom Landesherrn ebenso wie von der Stadt geschätzt wurde, so vertrauten sich auch seine Mitbrüder seinem Urteil an und schätzten seine Autorität. 1254 nahm der schwäbische Gelehrte als Vicarius provinciae am Provinzkapitel in Worms teil. Hier wurde er zum Provinzialprior der deutschen Ordensprovinz gewählt. Die Ordensprovinz Teutonia reichte im 13. Jahrhundert von Osterreich und der Schweiz im Süden bis zu Holland und Belgien im Norden, erstreckte sich des weiteren bis zur Ostsee. Im Westen reichte die Provinz bis zum Elsaß bzw. im Nordwesten wieder bis Belgien, im Osten bis Sachsen und Thüringen. Die Zahl der Neugründungen nahm rasch zu. Hatte die Provinz bei ihrer Gründung 1221 nur zwei Niederlassungen, die Konvente in Friesach und Köln besessen, so sollte sie gegen Ende des Jahrhunderts an die hundert Klöster zählen. Hinzu kamen zahlreiche Frauenklöster, die sich der Seelsorge der Dominikaner unterstellten. Der Provinzial mußte also ein weitausgedehntes Gebiet mit zahlreichen Niederlassungen regieren. Praktisch hieß das für ihn, daß er dauernd auf Reisen sein mußte. Eine feste Niederlassung gab es an sich nicht für ihn, sondern er visitierte Kloster nach Kloster. Fast jährlich fanden Generalkapitel statt, an denen er teilnehmen mußte. Jährlich mußte er auch das Provinzkapitel einberufen. Albert war fortan dauernd unterwegs. Um es noch genauer zu sagen, er durchwanderte Deutschland von Süden nach Norden, von Osten nach Westen und umgekehrt. Bis in sein Alter verzichtete er auf einen Wagen. Die weiten Wege legte er zu Fuß zurück. Was er sich selbst zumutete, verlangte er auch von anderen. Da verriet sich das Knorrige seiner Natur. Bei all seiner persönlichen Liebenswürdigkeit konnte er dennoch ausgesprochen hart und streng sein. Prioren, die zum Provinzkapitel zu Pferde ritten, entsetzte er ihres Amtes und ließ sie bei Brot und Wasser fasten. Aber umgekehrt verlangte er von niemandem etwas, was er nicht selbst auf sich nahm. Als die Beschwerden des Alters ihm die Fußreisen verunmöglichten, benutzte er einen Stellwagen. Bequem war das bestimmt auch nicht; denn ein derartiger Wagen war ungefedert.
Noch waren die Zeiten der Krise fern, die im 14. Jahrhundert auch im Dominikanerorden schmerzlich spürbar wurden. Dennoch zeigte sich bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts, daß der ursprüngliche Enthusiasmus nachgelassen hatte. Die Kehrseite des raschen Wachstums waren gewisse Ermüdungserscheinungen. Während die ersten Predigerbrüder die Armutsfrage sehr streng nahmen, gab es jetzt doch schon Ordensmitglieder, die Geld annahmen und für sich verwandten. Albert wollte den ursprünglichen Ordensgeist erhalten wissen; denn er war überzeugt, daß nur die Predigt wirksam sein kann, die durch das Lebenszeugnis des Predigers gedeckt ist. Darum heißt es in einem seiner Briefe an seine Mitbrüder, die er als Provinzial verfaßte: „Damit nicht das Laster persönlichen Besitzes das heilige Gelübde unserer Armut besudele, ist es mein Wille, daß kein Bruder Geld oder andere Dinge verwalte, die nach seinem Gutdünken oder zu seinem oder eines anderen Vorteil verwandt werden, auch dann nicht, wenn sein Vorgesetzter weiß, wo dieses Geld und diese Dinge sich befinden und wie sie verwaltet werden.“ Von den Mitbrüdern erwartete er, daß sie wenigstens einmal im Jahr ihren Seelenzustand ihrem jeweiligen Prior offenbarten, damit dieser seine Gemeinschaft wirklich kenne. Am charakteristischsten ist wohl seine Predigt, die er zur Einführung der Dominikanerinnen in das Kloster Paradies bei Soest hielt. Diese Predigt fand 1255 statt. Er forderte strenge Absonderung von der Außenwelt. Er forderte ein Leben der Buße und Treue gegenüber den Ordensregeln. Dann werde sich die Wahrheit des Wortes Paradies für jede einzelne Schwester erweisen. Dann sei das Paradies bei Soest ein Versprechen, das ewige Paradies zu erlangen.
Obwohl Albert seine Pflichten als Provinzial sehr streng nahm, seine Hauptsorge somit der Seelsorge an seinen Mitbrüdern galt, fand er dennoch auf seinen Reisen stets Zeit zum Studium. So gering sein persönliches Gepäck sein mußte, so durfte doch niemals Schreibmaterial fehlen. So setzte er seine Studien fort. Seine zahlreichen Wanderungen verband er mit sorgfältiger Beobachtung der Natur, insbesondere der Lebensvorgänge. Diese seine Beobachtungen an Tieren und Pflanzen und ihren Umweltbedingungen notierte er sorgfältig. Er ließ sie in seine späteren Schriften einfließen. Hier muß eine Eigentümlichkeit seines Arbeitens erwähnt werden. Werke, wie das über die Tiere, beschäftigten ihn viele Jahre. Immer wieder kehrte er zu ihnen zurück, ergänzte, änderte, gestaltete um. Die vieljährige Beschäftigung mit dem gleichen Stoff barg freilich die Gefahr in sich, daß seine Studien ausuferten. Tatsächlich hat Albert diese Gefahr nicht immer gemeistert. So erklären sich z.B. die Wiederholungen in seinen Tierbüchern. So hat er sich in seiner Schrift ›De animalibus‹ gleich an zwei Stellen zu den Pferden und ihren Krankheiten geäußert, nämlich einmal im 7., dann im 22. Buch. Aber es gibt nicht nur Wiederholungen, sondern sogar Widersprüche. Zu einer letzten Redaktion ist es gerade bei den Tierbüchern nicht mehr gekommen. Konnte er seine zahlreichen Reisen zur Naturbeobachtung mit ausnutzen, so muß doch in anderer Hinsicht gesagt werden, daß die Verwaltungstätigkeit, die jetzt auf ihm lastete, ihn den aktuellen philosophischen und theologischen Fragestellungen auf die Dauer entfremden mußte. Gegen Ende seines Provinzialates, 1257, wurde er an den Hof Papst Alexanders IV. nach Anagni gerufen. Inzwischen war nämlich der Konflikt zwischen Welt- und Ordens geistlichen an der Universität Paris offen ausgebrochen und wurde in scharfer Form ausgetragen. Hauptwortführer der Partei der Weltgeistlichen als Professoren war Wilhelm von Saint-Amour, Kanonikus von Beauvais. Er sprach den Ordensgeistlichen grundsätzlich das Recht auf universitären Unterricht ab. Nach seiner Meinung sollten sie sich auf die monastische Theologie beschränken. Es galt nun zu zeigen, daß die Mendikantenorden nicht in das Schema der alten rein monastischen Orden paßten, daß sie Kontemplation und Aktion miteinander verbanden, ja, daß bei ihnen die Vita contemplativa die Vita activa freisetzte, die Vita activa wieder in die Vita contemplativa mündete. Die Verbindung monastischer Lebensformen mit einem apostolischen Programm mußte als gültige Lebensform dargetan werden. Es galt das Recht auf Seelsorge und Studium zu verteidigen. Neben seinem Schüler Thomas von Aquino hat sich vor allem Albert als Vorkämpfer für das Recht seines Ordens auf Studium und Seelsorge am Hof von Anagni verdient gemacht. überdies wirkte er als Lesemeister an der päpstlichen Kurie. Auf Bitten des Papstes und der Kardinäle hielt er eine Vorlesung über das Johannes-Evangelium und die Apostelbriefe. Auch beteiligte er sich an einer öffentlichen Disputation gegen die Lehre des Averroes von der Einheit des Intellektes; denn immer mehr Wissenschaftler glaubten die These der Einheit des Menschengeschlechtes nur dann festhalten zu können, wenn sie von einem allen gemeinsamen Intellekt ausgingen. Albert wie Thomas haben dieser These widersprochen. Die Lehrtätigkeit erwies sich als die eigentliche Berufung des Heiligen. Wenn er sich auch den Verwaltungsaufgaben des Provinzialates nicht entziehen wollte, so kann ihm doch die Berufung als Lesereister in Anagni nicht unwillkommen gewesen sein. Darum hielt er sich auch nicht ungerne mehr als ein halbes Jahr am päpstlichen Hof auf. Das Generalkapitel in Florenz trug diesem Umstande Rechnung und entband ihn am 27. Mai 1257 von seinem Amt. Nach Beendigung seiner Lehrtätigkeit in Anagni kehrte Albert nach Köln zurück, um hier wieder die Leitung des Generalstudiums zu übernehmen. In diese zweite Kölner Periode fällt der bereits erwähnte Große Schied, den Albert zwischen Konrad von Hochstaden und der Stadt Köln vermittelte. Jedoch abermals wurde er aus seiner Lehrtätigkeit herausgerufen. In Regensburg war ein ofener Konflikt zwischen dem Bischof Albert von Pietengau und der Stadt ausgebrochen. Die Bürgerschaft verlangte die Absetzung des Bischofs und strengte gegen ihn bei der päpstlichen Kurie einen Prozeß an. Papst Alexander IV. konnte sich den Wünschen der Stadt nicht verschließen. Er wünschte sich einen seeleneifrigen Bischof, seine Wahl fiel auf Albert den Großen. Der Ordensgeneral Humbert von Romans erfuhr frühzeitig von den Plänen des Papstes und schrieb Albert einen Brief, indem er ihn dringend beschwor, die Ernennung zum Bischof nicht anzunehmen. Er fürchtete die Abwanderung der Elite seines Ordens in kirchliche Ämter wie das eines Bischofs oder Weihbischofs, wenn Albert dazu das Beispiel gäbe. So heißt es in seinem Brief: „Wer von uns und allen Mendikanten wird hinfort der Übernahme kirchlicher Würden widerstehen, wenn Ihr jetzt unterliegt? Wird man nicht vielmehr Euer Beispiel zur Entschuldigung anführen? Welcher Laie wird nicht Ärgernis nehmen an Euch und allen Mendikanten und sagen, wir liebten nicht die Armut, wir trügen sie nur so lange, bis wir sie abschütteln könnten?“ Der Ordensgeneral sparte auch nicht mit dem Hinweis auf die Schwierigkeit, die das Amt des Bischofs gerade in Deutschland mit sich bringe, weil dort mit dem geistlichen auch das weltliche Regiment verbunden war: „Überlegt ernstlich in Eurem Herzen, wieviel Verwirrung, wieviel Schwierigkeiten die Kirchenregierung in Deutschland mit sich bringt! Wie schwer ist es dort, als Kirchenfürst Gott und den Menschen es recht zu machen! Wie wird Eure Seele es ertragen können, den ganzen Tag in weltliche Geschäfte verwickelt zu sein, in steter Gefahr der Sünde zu leben, Eure Seele, die mit ganzer Kraft die hl. Wissenschaft und ein reines Gewissen liebt?… Welchen Erfolg Ihr aber als Bischof haben werdet, ist ungewiß.“ Schließlich wählt der Generalmeister eine krasse Formulierung, um Albert vor der Annahme des Amtes zu warnen: „Lieber sähe ich meinen vielgeliebten Sohn auf der Totenbahre als auf dem Bischofsstuhl, und nicht sollen meine übrigen Brüder aus diesem Leben scheiden voll Trauer, weil sie an Standhaftigkeit in solchen Fällen nicht mehr zu glauben vermochten. Im Geiste knie ich vor Euch und beschwöre Euch bei der Demut der unbefleckten Jungfrau und ihres Sohnes, verlaßt nicht den Stand der Demut!“ Albert jedoch glaubte, dem Papst noch mehr Gehorsam als seinem Ordensmeister zu schulden. Daher nahm er die Ernennung an. Im Ernennungsbrief vom 5. Januar 1260 hatte der Papst seine Wahl mit den Worten begründet: „Da Du am Quell der göttlichen Offenbarung Dich labst, mit den heilbringenden Wassern der Wissenschaft, so daß Dein Herz erfüllt ist und Du ein sicheres Urteil besitzt in allem, was Gott betrifft, so setzen wir die feste Hoffnung in Dich, daß die Kirche von Regensburg, die in geistlicher und zeitlicher Hinsicht so stark zerrüttet ist, durch Dich geheilt und alle ihre Schäden durch Deine eifrigen Bemühungen behoben werden.“ Im März des gleichen Jahres ließ sich Albert in Köln zum Bischof weihen und siedelte nach Regensburg über. Es gelang ihm, die Vermögensverhältnisse seines Bistums in relativ kurzer Zeit zu konsolidieren. Aber sein einfaches Auftreten wirkte befremdend. Auch als Bischof lebte Albert so, wie er es als Ordensmann, als Mitglied eines Mendikantenordens gewohnt war. Er erhielt daher den Spitznamen des Bischofs mit dem Bundschuh. Hatte nicht doch der Ordensgeneral richtiger gesehen? Albert schien seinen Warnungen im nachhinein recht zu geben. Auffallend ist jedenfalls, daß er bereits nach anderthalb Jahren resignierte. Inzwischen war Urban IV. Papst Alexander IV. gefolgt. Der neue Papst war ein Freund der Studien. Ihn bat Albert zwischen Ende Februar und Anfang Mai 1262 um Enthebung von seinem Bischofsamt. Der Papst entsprach diesem Wunsch. Mit der Niederlegung seiner Amtswürde verlor Albert jedoch nicht alle seine Vorrechte. Die Weihe verblieb ihm. Er hat in der Folge zahlreiche Kirchen geweiht. Es blieb ihm auch das Eigentumsrecht, auch wenn er ins Kloster zurückkehrte. Er konnte über sein Vermögen frei disponieren. Er verwendete es zugunsten der Kölner Dominikanerkirche, für die er den gotischen Chor errichten ließ. Papst Urban IV. wollte es vermeiden, daß der Rücktritt Alberts wie ein Eingeständnis des Scheiterns aussah. Er ernannte ihn daher am 7. Februar 1263 zum Legaten und Kreuzzugsprediger. Freilich die Zeit der Kreuzzüge hatte bereits ihren Höhepunkt überschritten. Zwar ist bis gegen Ende des Mittelalters die Aufforderung zum Kreuzzug niemals ganz aufgegeben worden. Zwar konnten noch Pius II. und Nikolaus von Kues 1463 an die Einladung zu einem Kreuzzug gegen die Türken denken. Aber im Grunde war das nicht mehr als ein Nachhall. Schon Albert der Große mußte erfahren, daß die Kreuzzugspredigt nicht mehr die rechte Resonanz fand. Wohl sehen wir ihn als Kreuzzugsprediger wieder auf der Wanderschaft Deutschland von West nach Ost, von Nord nach Süd durchqueren. Einige Daten mögen das belegen. Am 5. Mai 1263 weilte er im Kloster Polling, am 10. Mai in Augsburg, am 13. Mai in Donauwörth, am 27. Mai in Würzburg, am 5. Juni in Frankfurt, am 28. Juni abermals in Würzburg; die nächstgrößere Station ist dann Köln, 25. August. Im Herbst ist er in Brandenburg, gegen Ende des Jahres in Freiburg i. Br. Auch im darauffolgenden Jahr muß Albert weitläufige Reisen bewältigen. Zum letzten Mal nennt er sich in einer Urkunde vom 25. August, ausgestellt in Mainz, „vom apostolischen Stuhl bestellter Prediger des Kreuzes in Deutschland und Böhmen zur Unterstützung des Heiligen Landes“. Mit dem Tod Papst Urbans IV. am 2. Oktober des gleichen Jahres ist auch dieser päpstliche Auftrag für ihn beendet. Albert zieht sich für die nächsten Jahre in das Würzburger Dominikanerkloster zurück. Daß die Wahl gerade auf dieses Kloster fällt, hängt damit zusammen, daß dort sein leiblicher Bruder, Heinrich von Lauingen, lebte. In diesen Jahren schlichtete er eine Reihe Streitfälle. 1267 begibt sich Albert nach Straßburg. Hier lebte einer seiner vertrautesten Schüler, Ulrich von Straßburg. Albert suchte die Nähe des Freundes. Im Straßburger Dominikanerkloster scheint er Vorlesungen gehalten zuhaben. Unzweifelhaft setzte er auch hier seine wissenschaftlichen Studien fort. Erst jetzt vollendete er seine vor Jahrzehnten bereits begonnene Aristotelesparaphrase. Er schreibt die Kommentare zur aristotelischen Logik, Metaphysik, Ethik und Politik. Außerdem fand er noch Zeit, Kommentare zu Büchern der Heiligen Schrift zu verfassen. Insbesondere beschäftigte er sich mit den Büchern der Propheten und den Evangelien. Sein Ansehen als Wissenschaftler ist so groß, daß ihn der Ordensmeister 1269 nochmals als Professor der Theologie an die Universität Paris entsenden möchte. Doch Albert fühlt sich zu alt für dieses Amt. Auch hat er wohl ein Gespür dafür, daß ihn die Fragen, die jetzt dort diskutiert werden, nicht mehr berühren. Jetzt erst ist die Harmonie zwischen Glauben und Wissen grundsätzlich in Frage gestellt. Jetzt entflammt erneut auch der Streit zwischen Ordens- und Weltgeistlichen. Albert spürt, daß ein Jüngerer an seiner Stelle nach Paris gehen muß. Er empfehlt die Neuberufung seines einstigen Schülers, Thomas von Aquino. Dieser Empfehlung folgt der Orden.
Einem anderen Ruf konnte sich jedoch Albert nicht verschließen. Gegen Ende des Jahres 1270 bat der Generalmeister Johann von Vercelli Albert „flehentlich, daß Ihr Euren so würdigen und nützlichen Plan mit der erwünschten und den Brüdern so notwendigen Wirkung ausführen und die Stadt Köln besuchen wollt, zumal da Eure Anwesenheit der Klerus jener Stadt herzlich herbeisehnt und fordert, wo Ihr die Ströme des Euch anvertrauten heiligen Brunnens mit vielfacher Förderung der Brüder auf andere ableiten und sehr vielen nützen könntet“. Die Formulierung ist eigentümlich vage gewählt, weil der Ordensgeneral sich bewußt war, daß seine Bitte rechtlich unzulässig war. Noch dauerte der Streit zwischen der Stadt und dem auf Burg Nideggen gefangengehaltenen Erzbischof Engelbert 11. an – den Konflikt hatten wir bereits schon früher erwähnt. Noch lag das Interdikt über der Stadt. Der Ordensgeneral durfte ein Mitglied des Ordens nicht in die gebannte Stadt schicken. Erst recht war er, wie Hugo Stehkämper neuerdings betont hat, als Unbeteiligter nicht berechtigt, einen anderen Unbeteiligten aufzufordern, in einen Streit einzugreifen, der als Rechtsfall an der päpstlichen Kurie verhandelt wurde. Aber der Ordensgeneral und Albert stimmten in der grundsätzlichen Erwägung miteinander überein, daß es hier aus seelsorglicher Verantwortung heraus zu handeln galt. Das Gut des Friedens zu vermitteln, war Albert ein Herzensbedürfnis. So verschloß er sich den Wünschen des Generalmeisters nicht und kehrte nach Köln zurück. Tatsächlich gelang es ihm, den tiefeingefressenen Haß des Erzbischofs gegen die Stadt abzubauen, darüber hinaus Engelbert II. zum Eingeständnis zu bewegen, daß seine Politik gescheitert war. So konnte er abermals den Frieden vermitteln. Seither nahm Albert seinen ständigen Wohnsitz im Kölner Dominikanerkloster.
Auch in seinem letzten Lebensjahrzehnt hat Albert noch zahlreiche Weihehandlungen vorgenommen. Dazu mußte er weite Reisen unternehmen. Unter anderem hat er 1275 den Hauptaltar der Kirche der Abtei St. Vitus in Mönchengladbach eingeweiht. Der Chor dieser Kirche, ein Juwel der Gotik, ist ein Werk des Kölner Dombaumeisters Gerhard. Die wichtigste Reise aber, die Albert unternahm, war die zum Konzil von Lyon, 1274. Hier setzte er sich für die Wahl Rudolfs von Habsburg zum deutschen König ein, trug dadurch bei zur Überwindung der kaiserlosen Zeit. Drei Jahre später, 1277, indizierte der Pariser Bischof Stephan Tempier u.a. auch einige Sätze des Aquinaten. Albert hatte sich mit den fraglichen Sätzen nicht näher beschäftigt. Zwar hatte er 1270 bereits aus Anlaß einer Anfrage eines seiner in Paris studierenden Schüler, Ägidius von Lessines, auf die damals umstrittenen averroistischen Thesen Bezug genommen. Doch zeigen seine Ausführungen, daß er tatsächlich über die Problemstellung und die Lage in Paris nur unvollständig unterrichtet war. Daher stößt der Bericht, den im Informationsprozeß über das Leben des Aquinaten Bartholomäus von Capua gibt, daß Albert seinen Schüler zu entlasten von Köln nach Paris gereist sei, auf einige Skepsis. Bartholomäus von Capua spricht aus der Distanz der Jahrzehnte. Er ist außerdem kein unmittelbarer Zeuge, sondern stützt seine Aussagen auf die Zeugen berichte anderer, die Thomas näher gekannt haben. Für den Bericht über die Parisreise Alberts des Großen beruft er sich auf Hugo Borgognoni, der mehrmals Prior der Dominikaner in Lucca war. Dieser will Albert nach Paris begleitet haben. Der Bericht, den Bartholomäus von Capua unter Berufung auf Hugo von Lucca gibt, ist immerhin so fesselnd geschrieben, daß er hier in seinem wichtigsten Abschnitt mitgeteilt sein soll: „Es erhob sich ein Geraune, die Schriften des Bruders Thomas würden in Paris bekämpft. Daher sagte Bruder Albert, er selbst wolle dorthin gehen, um diese Schriften zu verteidigen. In ihrer Furcht wegen seiner Altersschwäche und wegen des weiten Weges rieten die Predigerbrüder ihm aber eine Zeitlang von diesem Weg ab … Schließlich aber sagte Bruder Albert, der Erzbischof oder Bischof von Regensburg war, er wolle zur Verteidigung so edler Schriften unbedingt nach Paris gehen … Als Bruder Albert in Paris war, fand eine Zusammenkunft im Generalstudium statt. Er bestieg die Lehrkanzel der Predigerbrüder und legte den Satz aus: ‚Welches Lob dem Lebenden, wenn er von den Toten gelobt wird‘. Dann erklärte er, Bruder Thomas sei der Lebende, die anderen die Toten, und er stimmte rühmend und preisend das Lob des Bruders Thomas an und erklärte, er sei bereit, bei einer Prüfung durch erfahrene Leute, die Schriften des Bruders Thomas als durch ihre Wahrheit und Heiligkeit leuchtend zu verteidigen.“ Bernhard Geyer wird man seiner Beurteilung dieses Berichtes in der Lebensskizze, die er für die Reihe ›Die großen Deutschen‹ schrieb, zustimmen dürfen, nämlich daß die Tendenz ofenkundig ist, Albert „für die thomistische Doktrin als Kronzeugen anzuführen“. Was Albert intendierte, war die Verteidigung des Untadeligen in der Lehrerpersönlichkeit des Aquinaten.
In der letzten Lebenszeit zog sich Albert ganz von jeder öffentlichen Wirksamkeit zurück, ließ sich auch nicht mehr besuchen. Er wollte nur noch Gott allein leben. Im Januar 1279 verfaßte er sein Testament. Aus ihm geht hervor, daß der Chor der Predigerkirche noch nicht vollendet war. Zur Ausstattung des Chores vermachte er seine sämtlichen Wertsachen dem Kölner Dominikanerkloster. Dazu hinterließ er ihm außerdem noch seine bischöflichen Gewänder und Geräte sowie seine Bücher. Je ein Legat bestimmte er zugunsten der Dominikanerinnenklöster in Augsburg, Gmünd bei Esslingen und Würzburg. Zu Testamentsvollstreckern bestellte er u.a. auch seinen leiblichen Bruder Heinrich von Lauingen, Prior des Würzburger Dominikanerklosters. Am 15. November 1280 starb Albert in seiner Zelle im Kölner Dominikanerkloster. Drei Tage später wurde sein Leichnam in einem Holzsarg vor den Stufen des Hauptaltars der Predigerkirche beigesetzt. Zwar setzte eine Verehrung schon bald ein, aber erst 1483 wurden die Gebeine Alberts des Großen in ein neues Hochgrab übergeführt, das für ihn in der Kölner Dominikanerkirche errichtet wurde. Ein Jahr später verlieh Papst Innozenz VIII. anläßlich des Generalkapitels der Dominikaner in Rom den Konventen von Köln und Regensburg die Erlaubnis, einen Altar zu Ehren Alberts zu errichten und ihn als Seligen zu verehren. Die vollständigste und beste Biographie des Mittelalters verfaßte um 1486 der Kölner Dominikaner Petrus de Prussia. Vier Jahre später erarbeitete der Dominikaner Rudolf von Nimwegen eine neue Lebensbeschreibung, die im wesentlichen auf der vorangehenden des Petrus de Prussia beruht. Sie erlangte im Orden offizielle Geltung. Die Seligsprechung erfolgte erst 1622, die Heiligsprechung 1931. Zehn Jahre später erklärte Papst Pius XII. Albert zum Patron der Naturwissenschaften.
Die lange Dauer, die es brauchte, bis Albert als Heiliger von seiner Kirche rezipiert wurde, ist kennzeichnend für das Schicksal seiner Nachwirkung. Wohl hat Albert eine Reihe Schüler gehabt, die er nachhaltig beeinflußte. Ulrich von Straßburg haben wir bereits erwähnt. Möglicherweise hat auch Meister Eckhart Albert persönlich kennengelernt. Teil des Opus tripartitum sollte ein philosophisches Thesenbuch sein, das Opus propositionum. Dabei hatte Meister Eckhart die Absicht, von Thesen des Proklos auszugehen. Einer seiner Schüler, der Dominikaner Berthold von Moosburg, hat sich dadurch anregen lassen, einen Kommentar zur ›Elementatio theologica‹ des Proklos zu verfassen. In ihr entwickelte er eine konsequente Einheitsmetaphysik. Berthold von Moosburg hat dabei reichlich Gebrauch von den Schriften Alberts des Großen gemacht. In seiner Bibliothek befanden sich eine Reihe Bücher, die der Heilige verfaßt hat, u.a. besaß er das Autograph der Tierbücher Alberts des Großen, das heute das Historische Archiv der Stadt Köln bewahrt. Der Besitzervermerk ist noch erhalten. Gleichwohl setzte sich auch unter den deutschen Dominikanern bereits des 14. Jahrhunderts die Doktrin des Aquinaten durch. In der Promotionsliste der Doktoren der Theologie an der Universität Köln, die der Dominikaner Servatius Vankel im 15. Jahrhundert anfertigt, werden die Schulrichtungen ausdrücklich vermerkt. Die Dominikaner finden sich ausschließlich in der Schule der Thomisten. Die Weltpriester haben sich verschiedenen Schulen angeschlossen, darunter auch der der Albertisten. Es gab in Köln sogar Bursen der albertistischen Richtung. Der bedeutendste Vertreter einer Theologie albertistischer Richtung war im 15. Jahrhundert Heymericus de Campo, bei dem Nikolaus von Kues hörte. Es gibt sogar Verbindungen zwischen den Albertisten an der Universität Köln und an der Universität Krakau. Dennoch muß man sagen: Der Albertismus ist Episode geblieben.
Schuld daran trug u.a. auch die Arbeitsweise Alberts selbst. Seine Werke erwiesen sich als umfangreich, sogar als allzu umfangreich, ließen zuweilen ein letztes Ausgefeiltsein vermissen. So bedeutsam seine theologische Summe war, so wurde sie dennoch von der des Aquinaten übertroffen. Das Werk des Schülers verdrängte mit innerer Notwendigkeit das Werk des Lehrers. Nur ein Bruchteil wurde übersetzt. Die populärsten Schriften sind Albert überhaupt zu Unrecht zugeschrieben worden. Sie haben dazu beigetragen, ihn als den Magus erscheinen zu lassen, weniger als den Sanctus. Dabei gehören übrigens zu diesen pseudoalbertinischen Schriften auch ausgesprochen fromme Werke, darunter einige mariologische. Allzu lange blieb das Werk des Heiligen unentdeckt. Die großen Editionen von Borgnet und Jammy haben daran nichts zu ändern vermocht, zumal sie mit mancherlei Unvollkommenheiten, ja Fehlern befrachtet waren. Erst die kritischen Neuausgaben erlauben ein genaues Kennenlernen des Werkes des Heiligen, insbesondere die Editio Coloniensis, die Bernhard Geyer begründet hat, trägt zur Revision unserer Kenntnis des Gesamtwerkes bei. Dem deutschsprachigen Leser vermittelten bereits einige neuere Anthologien einen Zugang zur Gedankenwelt Alberts des Großen. Vor allem muß die Anthologie genannt werden, die 1948 Rhaban Liertz vorgelegt hat. Sie hat allerdings den Nachteil, daß sie auf jeden Quellennachweis verzichtet. Eine Nachprüfung ist dadurch außerordentlich erschwert. Hinzu kommt, daß Liertz vielfach nur paraphrasiert, also keine wörtliche Übersetzung liefert. Für die Anthologie, die hier vorgelegt wird, wurden die in den ›Benutzten Quellen‹ aufgeführten Editionen herangezogen.
Berücksichtigt werden alle Aspekte des Werkes, Theologie, Philosophie wie Naturlehre. So soll die Universalität Alberts deutlich werden.