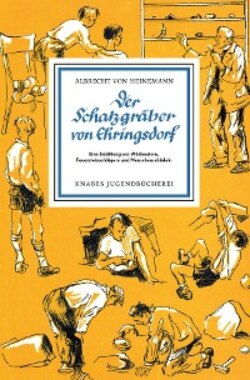Читать книгу Der Schatzgräber von Ehringsdorf - Albrecht von Heinemann - Страница 9
Der Weg in die Tiefen der Erde
ОглавлениеGroßvater Fischer stopfte sich aus einem abgeschabten ledernen Tabaksbeutel eine neue Pfeife, tat einen langen, genießerischen Zug und setzte dann seine Erzählung fort: »Ich stand nun also eines schönen Tages mit meinen Brüdern und ein paar Hilfsarbeitern unternehmungslustig da, um meine Entdeckungsreise in die Tiefen der Erde anzutreten. Ich kannte ja unsere Steinbrüche schon gut genug, um zu wissen, dass ich im Laufe der Zeit da unten manchen interessanten Fund würde machen können, und eine leise Vorahnung sagte mir sogar, dass ich vielleicht auch so glücklich sein würde, dem Urmenschen, der einmal in unserer Ehringsdorfer Landschaft gelebt hatte, auf die Spur zu kommen. Das wollte ich meiner Lebensarbeit als einfacher Steinbrecher zum großen, erstrebenswerten Ziel setzen. Ob ich es wohl erreichen würde?
Damals — es war vor mehr als fünfzig Jahren — gab es erst wenige von unseren modernen technischen Hilfsmitteln für die Erdarbeiten. Wir mussten also beim ersten Ausschachten zunächst einmal mit Spitzhacken und Schaufeln den Mutterboden abtragen und ihn mit Handkarren in die nächstgelegenen, schon ausgeräumten und nicht mehr betriebenen Steinbrüche fortschaffen. Ebenso ging es mit dem darunterliegenden Abraum von wertlosem Gestein. Das war eine mühselige Arbeit und kostete manchen Tropfen Schweiß, denn wir waren dabei ja nur auf unsere Hände und Arme angewiesen. Heute kommt man schneller damit vorwärts. Die großen Greifer und Bagger, wie ihr sie an unseren Baustellen beim Ausschachten sehen könnt, leisten natürlich unvergleichlich viel mehr. Aber die gab es damals noch nicht, und wir hätten im Anfang unserer Arbeit auch gar nicht Geld genug gehabt, um eine so teure Hilfskraft anschaffen zu können.
Die Schwierigkeiten wurden beim Fortschreiten der Abbauarbeiten noch dadurch erhöht, dass im Gegensatz zu anderen Steinbrüchen, die meistens nach einer Seite offen sind und dadurch leichtere Transportmöglichkeiten für die Beförderung von Steinen und Abraum bieten, unser Unternehmen schachtartig von der Erdoberfläche in die Tiefe getrieben werden musste.
Nachdem wir uns etwa sechs Meter tief in die Erde hineingearbeitet hatten, wobei ich eine ganze Menge von allerlei gewöhnlichen Schneckenhäusern gefunden hatte, trafen wir unter einer neuen Erdschicht auf eine Ablagerung von bläulich schwarzem Tuffsand und darunter auf die erste Bank von gelbgrauem Stein, in die an verschiedenen Stellen eine Erdschicht von etwa 25 cm Stärke eingelagert war. Sie sah ganz schwarz aus und wurde an der Sonne steinhart. Nun fand ich auch schon Tierzähne, Rehgehörne und Knochenreste.
Wir hatten noch nicht allzu lange an der Anlage des Steinbruchs gearbeitet, da erhielten wir den ersten wissenschaftlichen Besuch. Die Erforscher der Urgeschichte wussten längst die Weimarer Umgebung zwischen Ehringsdorf und Taubach als eine reiche Fundgrube für ihre Sammlungen zu schätzen, denn ich war ja nicht der Erste, der in diesem historisch so wichtigen Boden auf Entdeckungen ausging. Die Herren Gelehrten hatten seit langer Zeit ein wachsames Auge auf unsere Heimatgegend, und wenn hier ein neuer Steinbruch aufgemacht wurde, dann waren sie schnell da, angelockt wie die Wespen vom Honigtopf, um sich einen möglichst großen Teil der zu erwartenden Funde für ihre Forschungszwecke zu sichern.
Da erschien also eines schönen Tages ein dicker, gemütlicher Herr an unserer Arbeitsstelle und begrüßte mich freundlich:
›Guten Morgen — ich möchte gern Herrn Fischer sprechen.‹
›Der bin ich selbst‹, sagte ich, ›was wünschen Sie?‹
›Ich bin‹, sagte der Dicke, ›der Doktor Wild von der Landesanstalt für Vorgeschichte in Halle und habe gehört, das Sie hier einen neuen Steinbruch in Betrieb genommen haben. Da wollte ich ihn mir gern mal ein bisschen ansehen.‹
›Ja, Herr Doktor‹, entgegnete ich, ›das ist ganz schön und gut und Sie sollen mir herzlich willkommen sein. Aber hier gibt es einstweilen noch nicht viel zu sehen. Wir sind bis jetzt nicht sehr tief gekommen und haben zunächst auch nichts Neues gefunden, was Sie interessieren wird und was zu zeigen sich lohnt.‹
›Macht nichts, Herr Fischer — macht gar nichts‹, antwortete mir mein hartnäckiger Besucher. ›Was nicht ist, kann noch werden. Sie wissen ja, die Forschung muss viel Kleinarbeit leisten. Dabei ist jede, auch die kleinste und dem Laien unbedeutend erscheinende Einzelheit von Wert und Wichtigkeit.‹
Der gute Mann war nicht davon abzubringen, sich einmal genau bei uns umsehen zu wollen. Was konnte ich dagegen machen? Wir mussten ja die gelehrten Herren bei ihren Untersuchungen unterstützen, soweit wir konnten. Mein gemütlicher Gast begann also, in aller Seelenruhe, zwischen Erde und Steinen mit einer Behendigkeit herumzuklettern, die man seiner Körperfülle gar nicht zugetraut hätte. Er sah sich dabei überall aufmerksam um, und ich wurde im Stillen schon ein wenig ärgerlich und ungeduldig, denn ich hatte den Tag gerade eine Menge zu tun und war nicht ganz einverstanden damit, dass mir der neugierige Bücherwurm gerade in diesem Augenblick in die Quere kam. Aber es half nichts — ich musste mich fügen. Eigentlich freute es mich auch wieder, dass die Männer der Wissenschaft so großes Interesse für unsere Arbeit zeigten, auf die sie nicht verzichten können.
Denn schließlich sind die Urgeschichtsforscher auch auf uns angewiesen. Wenn sie, die in ihren Studierstuben und Hörsälen der Universitäten immer nur zwischen ihren Büchern lebten und zu körperlicher Betätigung keine Zeit fanden, mit eigenen Händen hier metertief in der Erde die viele Zentner schweren Steine hätten losbrechen, ausbuddeln und durchsuchen sollen, dann wäre wohl nicht viel dabei herausgekommen. Da mussten schon andere, kräftigere Kerle zupacken, als sie es waren.
Aber wenn die Professoren und Doktoren der Paläontologie, wie sie ihre Wissenschaft mit einem schrecklich gelehrten griechischen Namen bezeichnen, auf der einen Seite die Kraft unserer geübteren und leistungsfähigeren Körper brauchten, so hatten wir Arbeiter andererseits ihre besonderen Fachkenntnisse und größeren Erfahrungen in der Ausgrabungstechnik nötig für die Beurteilung all der Dinge, auf die wir in der Erde stießen. So wenig sie bei ihrer Forschungstätigkeit auf die Hilfe der starken Steinbrecher und Arbeiterfäuste verzichten konnten, so wenig durften wir werktätigen Menschen mit unserer ungenügenden Schulübung ihre Ratschläge, Hinweise und Aufforderungen zur Vorsicht und Aufmerksamkeit überhören, wenn nicht mancher Fund, von dessen Wert wir keine Vorstellung haben konnten, zerstört werden und damit einer Erhaltung für die Zukunft verloren gehen sollte.
Als mich der Gelehrte nach vielen gut gemeinten Ermahnungen zu größter Behutsamkeit und genauer Beobachtung bei allen künftigen Funden wieder allein gelassen hatte, machte ich mich von neuem an meine Arbeit.
Wir hatten eine gelbgraue Steinschicht durchbrochen und kamen nun mit einem Felsengebilde in Berührung, in dem der Steinbrecher einen sehr unbequemen Feind seiner Arbeit sieht und das er ›Pariser‹ nennt.«
»Pariser?«, fragte Rudi erstaunt. »Woher kommt denn der Name?«
»Ja«, antwortete der Großvater Fischer, »das fragst du mit gutem Recht. Glaub aber nur ja nicht, dass dieser von uns oft verwünschte Stein etwas mit der Hauptstadt Frankreichs zu tun hätte. Du weißt ja, dass wir Thüringer gern so reden, wie uns der Schnabel nun einmal gewachsen ist, und dass wir uns manche Ausdrücke und fremde Wörter mundgerecht zu machen wissen. So haben die Weimarer Steinbrecher den Namen ›Pariser‹ aus dem Wörtchen ›porös‹ gebildet, das so viel wie durchlässig bedeutet und eine Eigenschaft dieses Steins bezeichnet. Dabei ist aber der Pariser ein zäher und oft sehr harter Bursche. Er ist nach der neuesten Auffassung der Geologen entstanden aus sogenannter Fließerde, die, wie ihr Name schon andeutet, in der Ehringsdorfer Gegend von den Höhenzügen um Belvedere in die tiefer gelegene Umgebung durch Wasser und Wind abgeschwemmt wurde. Diese Gesteinsschicht deutet den Beginn der letzten Eiszeit an. Das aus ihr gebrochene Steinmaterial ist als Baustoff nicht zu gebrauchen, und wir mussten es aus mehr als zehn Meter Tiefe mit Handkarren herausschaffen. Es war hart mit den darunterliegenden Schichten verwachsen und machte uns daher schwer zu schaffen.«
»Sagen Sie doch bitte, Herr Fischer«, fragte Rudi, »wie haben Sie damals eigentlich diese starken Steinbänke auseinandergekriegt, als Sie noch keine modernen Werkzeuge wie etwa das Pressluftgerät hatten?«
»Gut, dass du danach fragst, Rudi — das muss ich euch noch erklären. An dem Arbeitsvorgang hat sich im Großen und Ganzen gegen damals nur das geändert, dass jetzt mit dem Presslufthammer anstatt bloß mit der Hand gearbeitet wird. Dadurch erspart der Steinbrecher viel Zeit und Kraft. Die Sache war die: In den abzubauenden Stein wurden mit Hammer, Spitze und Bohrer Löcher in je zehn Zentimeter Entfernung voneinander durch die ganze Stärke der Steinbank hindurchgetrieben. In diese hängte der Steinbrecher zwei halbrunde Eisen ein, die fast das ganze Loch ausfüllten. Zwischen sie setzte er in jedes Loch einen Stahlkeil, der mit dem Hammer gleichmäßig straff angezogen wurde. Dadurch entstand ein starker Druck, der den ganzen Stein unter Spannung setzte und ihn schließlich mit lautem Schlag auseinandertrieb, als wäre er mit einem großen Messer sauber auseinandergeschnitten worden. Aber es kam auch manchmal vor, dass der auf diese Art angebohrte Stein nicht von der Stelle wich, auf der er angewachsen war. So ging es mir auch bei der Werkbank, von der ich eben erzählen wollte. Sie war so glashart, dass ich mit dem Meißel und dem gewöhnlichen Handwerkszeug nichts an ihr ausrichten konnte. Da musste also eine Sprengung helfen.«
»Großvater«, unterbrach Klaus den Alten, »erzähl doch mal, wie eine solche Sprengung am Stein eigentlich gemacht wird.«
»Das wollte ich eben tun, Klaus. Ihr müsst daran denken, Jungens, dass ich immer noch von der Zeit vor fünfzig Jahren spreche, in der wir nur wenig von den Hilfsmitteln wussten, die heute die Arbeit im Steinbruch erleichtern. Was jetzt zum Beispiel ein Mann allein mit dem Kompressor in einer halben Stunde schafft, um ein Bohrloch im harten Felsgestein anzulegen, damit hatten damals drei kräftige Arbeiter einen halben Tag lang zu tun. Sie benutzten dazu einen großen und starken Stahlbohrer, den einer von ihnen führte, während die beiden anderen im gleichen Takt mit ihren zwanzig Pfund schweren Hämmern darauf schlugen. Nach jedem Schlag musste das Bohrloch mit einem besonders dazu konstruierten, löffelartigen Gerät von dem Abfall an kleineren Steinen, der beim Bohren entstanden war, gereinigt werden. Nach vier Stunden hatten die Männer ein Loch von 1,60 Meter Tiefe geschaffen. Dabei mussten die letzten zehn Zentimeter trocken gebohrt werden, damit beim Einführen der Zündschnur und des Pulvers keine Pulverkörnchen an den feuchten Wänden des Bohrloches hängen blieben und die Wirkung des Sprengschusses stören konnten.
Das Bohrloch wurde dann mit der Zündschnur und einer 20 Zentimeter hohen Säule von Schwarzpulver gefüllt, auf die ein Papierpfropf gesetzt wurde, der bei der Sprengung die etwa noch an den Wänden des Bohrloches haftenden Pulverkörnchen mit hinunternehmen sollte. Auf diesen Pfropfen kam eine bis an den Rand des Bohrloches reichende Schicht von festgestampftem, trockenen Lehm oder Sand. Das Bohrloch wurde an seinem Ausgang an der Oberfläche des zu sprengenden Steines mit Reisig abgedeckt, um zu verhindern, dass bei der Sprengung die Steinbrocken allzu weit in die Gegend flogen. Außer Schussweite wurde ein Mann mit einer Glocke aufgestellt, um die in der Nähe arbeitenden Leute oder zufällig vorübergehenden Passanten zu warnen.
Dann schnitt der Sprengmeister die Zündschnur zurecht. Er muss dabei genau berechnen, wie lang sie sein muss, um die Pulverladung nicht eher zur Explosion zu bringen, als bis er in Deckung gegangen ist. Nach einigen Minuten hat die glimmende Zündschnur die Sprengladung erreicht. Mit kurzem, wuchtigem Schlag oder mit einem kanonenschussartigen Knall — je nachdem, ob der zu sprengende Stein frei steht oder noch in die unteren Schichten hineinreicht — reißt die Kraft des Pulvers den Felsen aus seiner Lage und macht den Weg zur weiteren Arbeit an ihm frei.
Ich will euch von den Sprengungen noch etwas mehr erzählen, denn es passieren dabei allerlei teils heitere, teils auch recht ernste Dinge. Eines Tages hatten wir wieder eine Sprengung vorbereitet. Das Bohrloch war fertig angelegt, mit Pulver gefüllt und mit Reisig abgedeckt. Der Mann mit der Glocke gab sein Warnungssignal, die Zündschnur glimmte schon, und jedermann brachte sich in Deckung. Auf einmal knallte die Explosion wie der Abschuss eines schweren Geschützes. Reisig und Steinbrocken flogen zischend, schwirrend und pfeifend durch die pulverqualmerfüllte Luft. Mehrere Felsstücke durchschlugen das Dach des Unterkunftsraumes der Arbeiter, von denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Trotz des Unheil verkündenden Getöses war die Sache glimpflicher abgelaufen, als wir schon befürchtet hatten.
Kurze Zeit nach der Sprengung klingelte in unserem Büro das Telefon, und man rief mich an den Apparat. Die Stimme des Geschäftsführers in einem benachbarten Kalkwerk, der mein Schulkamerad gewesen war, klang mir vorwurfsvoll entgegen:
›Höre mal, Robert — heute hast du mit deinem Meisterschuss sogar den alten Wilhelm Tell übertroffen.‹
›Wieso, Oskar?‹, fragte ich erstaunt zurück. ›Wie meinst du das?‹
›Na, wenn du gerade mal Zeit hast, komm doch rüber und sieh dir die Bescherung bei uns einmal an. Da wirst du staunen!‹
Neugierig geworden, machte ich mich gleich auf den kurzen Weg in die Nachbarschaft. Da war alles in heller Aufregung. Ein Steinbrocken von erheblicher Größe war über 300 Meter weit durch die Luft geflogen, hatte das gläserne Oberlichtdach des Kontors durchschlagen und den friedlich über ihren Kontobüchern sitzenden Angestellten einen ganz gehörigen Schrecken eingejagt. Aber auch hier war außer dem zertrümmerten Glasdach und einem zerbrochenen Aktenständer zum Glück kein Schaden angerichtet worden. Die Reparaturkosten konnten wir durch eine Steinlieferung ausgleichen.
Ein anderes Mal kam ich selbst bei der Vorbereitung einer Sprengung weit weniger glücklich davon.
Es war an einem bitterkalten Wintertag. Der strenge Frost von 20 Grad zwang uns zu Sprengungen am Gestein. Ich hatte mit zwei Mann als Zuschlägern das Bohrloch fast fertig ausgelegt und sagte nun zu den Leuten:
›Halt — Männer, setzt mal eure Hämmer in Ruhe!‹
Nun hatten die beiden sich wegen der schneidenden Kälte die Köpfe dick vermummt und der eine von ihnen mochte deshalb meinen Zuruf nicht verstanden haben. Ich hockte vor dem Bohrloch und stützte mich, um besseren Halt zu haben, mit der rechten Hand auf den Kopf des Bohrers, als plötzlich der zwanzig Pfund schwere Hammer des Zuschlägers haarscharf an meinem Kopf vorbeisauste und auf meine Hand herunterschmetterte. Ihr könnt euch denken, dass mir Sterne vor den Augen tanzten und ich die Engel im Himmel pfeifen hörte, als ich aus der Tiefe des Steinbruchs an die Erde hinaufstieg. Das war buchstäblich ein schwerer Schlag für mich gewesen, denn die Hand blieb für immer verstümmelt. So wurde ich mit 29 Jahren schon zu einem halben Invaliden. Immerhin hatte dieses Unglück für mich auch wieder eine gute Seite: Ich fand nun mehr Zeit, mich eifriger als bisher um die prähistorischen Funde in unserer Ehringsdorfer Heimaterde zu kümmern.
Aber davon erzähle ich euch morgen weiter, denn heute ist es zu spät dazu geworden, und es heißt jetzt für euch: Marsch, ins Bett!«
Die Jungen maulten ein wenig, denn sie hätten gern noch etwas mehr gehört. Aber Klaus wusste, dass der Großvater unerbittlich auf Ordnung im Hause hielt und keinen Widerspruch gegen seine Entscheidungen duldete. Da war also nichts zu machen. Rudi warf einen scheuen Blick auf die verkrüppelte rechte Hand des alten Mannes, und ein fröstelndes Gefühl lief ihm den Rücken hinunter, als er an die schlichten Worte dachte, mit denen der Erzähler von seinem Unfall berichtet hatte. Ohne sich recht klar darüber zu sein, empfand er etwas von dem Heldenmut eines harten und schweren Arbeiterlebens, das in stiller Selbstverständlichkeit abläuft und nicht viel Aufhebens macht von den Bedrohungen und Gefahren, die täglich über seinem Wege hängen.
Nachdenklich machte er sich auf den Heimweg.