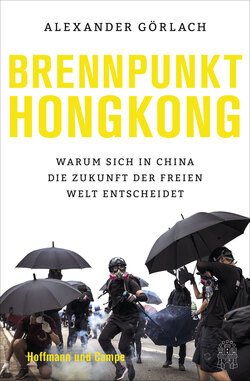Читать книгу Brennpunkt Hongkong - Alexander Görlach - Страница 4
Einleitung: Hongkongs Kampf für Demokratie
ОглавлениеWer zum ersten Mal nach Hongkong kommt, dem bleibt vor Staunen der Mund offen stehen. Hunderte schlanke Hochhäuser ragen dicht an dicht in den Himmel. Sie heben und senken sich mit den Hügeln, auf denen sie errichtet sind. Manche der Wolkenkratzer sind von oben bis unten mit pastellfarbenen Streifen angestrichen, das soll gefällig sein fürs Auge und von der Enge ablenken, die typisch ist für Hongkong. Zwischen den Hochhäusern liegen schmale Innenhöfe, einige von ihnen sind mittlerweile weltberühmt, weil sich Menschen davor ablichten und die Fotos auf Instagram präsentieren. Wer das Foto schießt, muss in die Hocke gehen, um die gewaltigen, nach oben strebenden Betonmassen einzufangen. Man erkennt auf diesen Bildern, dass sich hinter den Fenstern nur sehr kleine Apartments befinden. Ihre Bewohner hängen die Wäsche an Gitter vor den Fenstern zum Trocknen auf, wie man es aus den engen Sträßchen des europäischen Südens kennt. Jeder Zentimeter zählt in Hongkong, einer der am dichtesten besiedelten Städte der Welt. Die Mieten sind entsprechend teuer, jede noch so kleine Fläche wird ausgebeutet.
Was man auf den Instagram-Fotos nicht sehen kann, ist das tropische Klima, das in Hongkong herrscht. Es legt einen nassen Dunst über die Stadt und auf die Haut. Die Menschen ächzen unter der Schwüle. Nur klimatisierte Räume machen das Leben zwischen März und November erträglich. Hongkonger bewegen sich deshalb lieber nicht auf den Straßen, sondern zwei Stockwerke darüber: Sie wandeln durch klimatisierte Shoppingmalls, die es in jedem Haus gibt und die durch Brücken miteinander verbunden sind. Wer Hongkong besucht, sollte nicht auf Google Maps als Orientierungshilfe hoffen, sondern muss in einem langwierigen und bisweilen frustrierenden Prozess lernen und sich einprägen, welches Haus mit welchen anderen Häusern verbunden ist, um von A nach B zu gelangen. Die funktionalen Wandelgänge sind überdacht, sodass man auch bei tropischen Regenfällen trockenen Fußes durch die Stadt gehen kann. Hongkong ist eben anders als andere Städte.
Ich habe die Metropole zum ersten Mal im Spätsommer 2017 besucht, als Gastwissenschaftler an der City University of Hong Kong. Es war der erste Besuch von vielen in einem akademischen Jahr, während dem ich erforschen wollte, wie die Demokratien von Hongkong und Taiwan mit dem Aufstieg der autokratischen Volksrepublik China in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft umgehen. Taiwan und Hongkong, so sollte ich in den folgenden Monaten lernen, sind sehr verschieden, was die Umstände ihrer Situation betrifft: Hongkong ist zwar ein Teil der Volksrepublik China, aber ausgestattet mit demokratischen Sonderrechten, und Taiwan funktioniert quasi unabhängig wie ein Nationalstaat mit einem eigenen Parlament und einer eigenen Regierung, mit einer eigenen Währung, einem eigenen Militär und eigenen Pässen. Peking freilich betrachtet die demokratische Inselrepublik als eine abtrünnige Provinz. Nachdem Xi Jinping im Jahr 2012 Generalsekretär der Kommunistischen Partei und im Jahr darauf Präsident der Volksrepublik China geworden ist, verschärfte er die Gangart seines Landes gegenüber den zwei benachbarten Demokratien so drastisch, dass die beiden mittlerweile untereinander mehr Gemeinsamkeiten teilen, als sie dies mit China tun.
In den akademischen Jahren vor meinem Besuch in Taiwan und Hongkong habe ich an der Harvard University im US-Bundesstaat Massachusetts zum Zustand der liberalen Demokratie und ihrer Zukunft gearbeitet. In der Regel sprechen wir ausschließlich über westliche Länder, wenn wir über Demokratie nachdenken. Dabei greifen wir viel zu kurz. Denn was wir heute »liberale Demokratie« nennen, gibt es nicht nur innerhalb der europäischen oder der atlantischen Welt. Taiwan, Südkorea und Japan sind ebenfalls Kinder einer demokratischen Entwicklung, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika sowohl über den Atlantik als auch über den Pazifik Bahn brach.
Im Westen argumentieren manche, dass unsere heutige Form der Demokratie, die auf den Menschenrechten gründet, sich aus den Quellen des Christentums und der Aufklärung speise. Für jene, die so sprechen, scheint es zwischen unserer liberalen demokratischen Kultur und anderen Kulturen einen unüberbrückbaren Graben zu geben. Nur ein Tag in Hongkong oder in Taiwan belehrt jeden eines Besseren. Ob jemand bei minus 20 Grad im neuenglischen Cambridge bibbert oder bei plus 40 Grad auf Hongkongs Straßen schwitzt, ob etwas in lateinischen oder in chinesischen Schriftzeichen zu lesen ist, ob vor dem Hintergrund von Kirchtürmen oder von spargelschlanken Hochhäusern: Demokratie funktioniert überall auf der Welt.
Am Flughafen gewinnen Reisende einen ersten Eindruck von dem Ort, den sie besuchen. Der Hongkonger Flughafen gibt einen kleinen Ausblick auf das, was einen in der Stadt und darüber hinaus in ganz Ostasien erwartet: effiziente Prozesse, penible Hygienevorschriften und absolute Pünktlichkeit. Das bedeutet: Es gibt keine langen Schlangen bei der Einreise, jede Toilette ist sauber, und der Hochgeschwindigkeitszug in die Innenstadt fährt auf die Sekunde genau ab. Wer der Meinung ist, dass solche Akkuratesse nur in Nichtdemokratien möglich ist, weil Sauberkeit im öffentlichen Raum fast schon wie ein diktatorischer Einschnitt in die persönliche Entfaltung wirkt, dem sei versichert, dass schmutzige Bahnsteige und dreckige Toiletten keineswegs das unausweichliche Schicksal einer Demokratie sein müssen. Allein um mit eigenen Augen zu sehen und zu erleben, was für eine Auswirkung eine funktionierende Umwelt auf den Alltag haben kann, hat es sich schon gelohnt, die USA mit ihrer maroden Infrastruktur in Richtung Ostasien zu verlassen.
Jedes Mal, wenn ein Zug während meines Jahres in Hongkong und Taiwan pünktlich den Bahnhof verließ (also jedes Mal, wenn ich eine Reise antrat), dachte ich an Deutschland und seine Bahn, in deren Statistiken ein Zug noch als pünktlich geführt wird, wenn er weniger als sechs Minuten Verspätung hat. Dort, wo ich zu Gast war, würde man das nicht mit sich machen lassen. Im November 2017 kündigte ein führender Manager der japanischen Bahn nach einer öffentlichen Entschuldigung seinen Job, weil ein Zug in seiner Verantwortung 20 Sekunden zu früh abgefahren war! Kurz nach meiner Ankunft in Taiwan, im August 2017, trat der Energieminister des Landes zurück, weil ein Blackout den Norden der Insel für knapp vier Stunden vom Stromnetz trennte. In unseren Breiten gibt es eine solch konsequente Übernahme von Verantwortung nicht mehr. Hier gilt es umgekehrt schon als eine legitime Reaktion, gerade dann im Amt bleiben zu wollen, wenn man etwas verpatzt hat, um zu zeigen, dass man Verantwortung für seine Fehler übernimmt.
Aber Demokratien in Ostasien unterscheiden sich nicht nur durch Effizienz, Hygiene und Pünktlichkeit von denen des Westens. In dieser Weltregion, vor allem aber in Hongkong und Taiwan, besteht der Hauptunterschied darin, dass die Demokratien in unmittelbarer Nachbarschaft zur Volksrepublik China, einer kommunistischen Diktatur, bestehen müssen. Peking mischt sich heftig in die inneren Angelegenheiten der beiden ein, da die Nomenklatura und ihr Präsident, Xi Jinping, darauf beharren, dass Taiwan und Hongkong Teile Chinas seien.
Hongkong ist in der Tat ein Teil Chinas, aber durch die vertragliche Regelung »ein Land, zwei Systeme« wird die Finanzmetropole zu einer demokratischen Sonderzone mit eigener Gerichtsbarkeit, unabhängiger Presse und freier Wissenschaft. Und auch Taiwan und die Volksrepublik haben eine Vergangenheit miteinander, aber sie haben sich nach dem chinesischen Bürgerkrieg, der vor über 70 Jahren endete, maximal voneinander entfernt: Taiwan ist heute eine liberale Demokratie, die Volksrepublik ist es nicht. Beide Demokratien, Hongkong und Taiwan, haben deshalb, Zugverspätungen hin oder her, mit Deutschland und den USA mehr gemeinsam als mit China. Die Volksrepublik hat keinen Beleg dafür, dass Taiwan chinesisch ist, und was Hongkong betrifft, so bricht sie die vertraglich gegebenen Zusagen stets aufs Neue. An beiden Orten haben sich deshalb, vor allem angetrieben von Studierenden, Protestbewegungen gebildet, die sich gegen das Vorgehen Chinas wehren.
In Hongkong war die Erinnerung an die Massendemonstrationen von 2014, die als Regenschirmbewegung in die Geschichte eingingen, während meines Aufenthalts noch frisch. Damals wollte Peking seine Kandidaten für die Position des Chief Executive, dem politischen Führer Hongkongs, auf den Wahllisten der Stadt durchdrücken, was klar gegen die vertraglichen Abmachungen verstieß, die 1997 im Zuge der Rückgabe der britischen Kronkolonie an die Volksrepublik China getroffen wurden. Um sich gegen das von der Polizei eingesetzte Pfefferspray und Tränengas zu schützen, spannten die Demonstrierenden Schirme auf und gaben so der Bewegung ihren Namen.
Im selben Jahr geschah das Gleiche in Taiwan: Die regierende chinafreundliche Partei KMT wollte durch eine weitreichende wirtschaftliche Kooperation die Insel so eng an die Volksrepublik binden, dass es über kurz oder lang aufgrund der dadurch entstehenden wirtschaftlichen Abhängigkeit zu einer politischen Übernahme gekommen wäre. Das zumindest befürchteten die Studierenden, die das Parlament, den Legislativ-Yuan, in Taiwans Hauptstadt besetzten. Ihre Protestbewegung trägt den Namen der Sonnenblume. Sie war schon das Symbol der Demokratiebewegung vor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert, als sich der Inselstaat friedlich von einer Diktatur zur Demokratie wandelte.
Der in Hongkong lehrende Politikwissenschaftler Brian Fong erklärt die Protestbewegungen, die in Hongkong und Taiwan als Reaktion auf Pekings übergriffiges Verhalten losgetreten wurden, mit seiner »Zentrum-Peripherie-Theorie«. Sie besagt, dass Fliehkräfte an der Peripherie entstehen, sobald das Zentrum gegenüber jener Peripherie härtere Töne anschlägt und so unter Druck setzt. Nach Brian Fong bedeutet das, dass Präsident Xi selbst verantwortlich ist für die Unabhängigkeitsbestrebungen, die an beiden Orten in Chinas Peripherie Bedeutung gewinnen. Gerade weil Hongkong und Taiwan verschieden gelagerte Fälle sind, die sich seit 2014 in dieselbe Richtung entwickeln, erscheint Fongs These plausibel. Hier verdichtet sich bereits jene Systemfrage, von der dieses Buch handelt: Worin besteht der hauptsächliche Unterschied zwischen einer freien, demokratischen Welt und einer unfreien, autokratischen? Es wird ersichtlich, dass sich die Menschen dort, wo sie die Wahl haben zwischen Demokratie und dem anderen Modell, für das unter anderem Präsident Xi steht, immer für die Demokratie entscheiden.
Im Sommer 2019 forderte die chinesische Führung die Hongkonger erneut heraus. Ein sogenanntes Auslieferungsgesetz sollte dazu dienen, die unabhängige Justiz, die Hongkong zugebilligt ist, auszuhebeln. Nach dem Gesetz müsste jeder an die Volksrepublik ausgeliefert werden, der von China benannt wird. Bis zu zwei Millionen Menschen demonstrierten über Monate gegen dieses Auslieferungsgesetz, das die von Pekings Gnaden regierende Chief Executive Carrie Lam durchsetzen sollte. Im Juli 2019 war auch ich, zum zweiten Mal seit dem Ende meines dortigen Forschungsaufenthalts, zurück in Hongkong. Obwohl nur eine kurze Zeit vergangen war, hatte sich die Stadt merklich verändert: Bleierne Schwere und Pessimismus bestimmten das Leben in der Stadt. Gleichzeitig lag eine »Wer, wenn nicht wir«-Dringlichkeit in der Luft, mit der sich die Demonstrierenden gegen jene Ohnmacht und Unterdrückung wehrten, in die Carrie Lam sie bugsieren sollte. Auf den Straßen standen sich die beiden Welten – die beiden Systeme – gegenüber: auf der einen Seite die Demonstranten und auf der anderen die Hongkonger Polizei und jene Schlägertrupps, von denen die Demonstranten behaupteten, sie seien von Peking gesteuert.
Der Ausbruch der Coronakrise hat diese Konfrontation nicht etwa verringert, sondern noch verschärft. In Hongkong mag es keine Demonstranten mehr geben, aber schon längst tobt der argumentative Streit darüber, ob eine Demokratie oder eine Autokratie besser in der Lage sei, eine Pandemie zu bekämpfen. Als chinesische Sicherheitskräfte die Stadt Wuhan am 23. Januar 2020 abriegelten und ihre Einwohner für zwei Monate in eine strenge Quarantäne befahlen, äußerten einige Stimmen, dass ein solches Vorgehen in Demokratien nicht möglich wäre. Doch bereits Ende März, als China begann, seine Ausgangsperren zu lockern, befand sich der Rest der Welt auch in Quarantäne und belegte damit eindrucksvoll, dass man Menschen nicht wegsperren muss, sondern sie mit guten Argumenten durchaus davon überzeugen kann, für ein hohes Gut – die Gesundheit der Mitmenschen – auf ihre anderen Freiheiten für eine bestimmte Zeit zu verzichten.
Ich schreibe dieses Buch, während ich in New York im Lockdown sitze. Seit meiner Rückkehr aus Hongkong und Taiwan arbeite ich als Senior Fellow am Carnegie Council for Ethics in International Affairs und forsche weiter an meinem Thema, der Zukunft der Demokratie. New York ist zum Epizentrum der Krise in den Vereinigten Staaten geworden, mit abertausenden Erkrankten und mindestens 16000 Toten. Hier wurden noch spät Coronapartys gefeiert, trotz ausdrücklicher Aufforderung der Behörden, dass die Menschen sich sozial distanzieren sollten, um die exponentielle Ausbreitung des hoch ansteckenden Virus zu verhindern. Ähnliches wurde aus Berlin berichtet, wo ich noch eine knappe Dekade vor meinem Weggang in die USA gewohnt hatte. Solches Verhalten wäre in der Volksrepublik nicht toleriert worden, sagen Freunde des autokratischen Regierungsstils. Aber wer so einseitig denkt, sieht nicht, dass die Menschen in allen demokratischen Ländern die Vorgaben ihrer Regierungen akzeptierten und für mindestens zwei Monate in Quarantäne lebten. Für die Protestdemonstrationen in Deutschland, die ein Ende der Sicherheitsmaßnahmen fordern, haben 80 Prozent der Deutschen kein Verständnis.
Was bedeutet diese Entwicklung für den Kampf um Hongkong? Im September 2020 soll ein neuer Legislative Council, ein neues Parlament, gewählt werden. Bei den letzten Lokalwahlen im Herbst 2019 zum District Council haben alle chinafreundlichen Parteien verloren. 17 von 18 Distrikten gingen damals an demokratische Kräfte. In einem Bericht nach Peking, der an die Öffentlichkeit gelangte, versprach Carrie Lam, das Vertrauen der Bürger durch ein gutes Management der Coronakrise zurückgewinnen zu wollen. Es wird entscheidend sein, mit welchen Instrumenten sie das zu bewerkstelligen versuchen wird. Sollte sie auf Maßnahmen setzen, mit denen Demokratien ihre Bevölkerungen in der Krise zum Handeln bewegen, würde dies das demokratische Lager stärken. Wahrscheinlicher ist also, dass sie einen anderen Weg geht. In der Volksrepublik arbeiten die Parteistrategen bereits mit Hochdruck daran, Präsident Xi und seine Nomenklatura als diejenigen zu positionieren, die China mit starker Hand vom Coronavirus befreit haben. Sie schrecken nicht davor zurück, Fakten ganz bewusst zu manipulieren. Einem Geheimdienstbericht in den USA zufolge soll Peking die Welt über das wahre Ausmaß des Ausbruchs in China weitestgehend im Unklaren gelassen und mit falschen Zahlen operiert haben.
Der Grund, dieses Buch zu schreiben, ist in seinem Untertitel zusammengefasst: Warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet. In der gegenwärtigen Situation des Systemkonflikts zwischen freien Demokratien und unfreien Autokratien geschieht in der Peripherie der Volksrepublik Entscheidendes. Menschen gehen für die Demokratie auf die Straße und ermutigen damit auch Demokraten in anderen Ländern. Diese Inspiration wird, vor allem im Westen, dringend gebraucht, denn dort sehnen sich immer mehr Menschen nach starken Männern, nach populistischen Strongmen, die nicht lange fackeln.
Die Volksrepublik ihrerseits wird dem demokratischen Treiben in Hongkong und auf Taiwan nicht tatenlos zuschauen. Während der Proteste im Jahr 2019 herrschte Angst in der Finanzmetropole, die in der Sonderverwaltungszone stationierte chinesische Volksbefreiungsarmee könnte aus den Kasernen ausrücken und Hongkongs Sonderstatus beerdigen. Während meines Aufenthalts auf Taiwan im Herbst 2017 war bereits darüber diskutiert worden, ob die Volksrepublik in der Lage wäre, die Insel einzunehmen. Diese Diskussion wurde aufgrund einiger Provokationen Pekings in der Luft und zur See gegenüber dem Eiland losgetreten. Auf dem XIX. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas wenig später wurde Xi deutlich: Man werde keine Unabhängigkeit Taiwans akzeptieren und gegebenenfalls die Waffen sprechen lassen.
Seine Kriegsdrohung wurde in weiten Teilen der Welt, auch vom deutschen Außenminister Heiko Maas, kritisiert. Wenn es China gelänge, die Demokratie in Hongkong und im benachbarten Taiwan zu zerstören, dann hätte das eine enorme Strahlkraft für das autokratische Modell. Für uns Europäer, für uns Deutsche, ist es daher alles andere als unwichtig, was in der nächsten Zeit auf der anderen Seite der Welt geschehen wird. Mit Hongkong steht nicht etwa nur ein global wichtiger Finanz- und Handelsplatz zur Disposition. Vielmehr sind diejenigen, die demokratische Ideale hochhalten und Politik auf Basis der Menschenrechte verfolgen, miteinander verbunden: in beiden Teilen Amerikas, in Europa, in Asien. Die regelbasierte internationale Ordnung, die von Demokraten erbaut und von demokratischen Idealen inspiriert ist, braucht für ihren Fortbestand die Demokratie in Ostasien.
In Abwandlung des lateinischen Diktums Ut Roma cadit, mundus cadit, fällt Rom, dann fällt die ganze Welt, lässt sich sagen: Fällt Hongkong, dann fällt auch Taiwan. Wenn erst einmal diese beiden gefallen sind, dann wird auch unserer Freiheit die Totenglocke läuten.