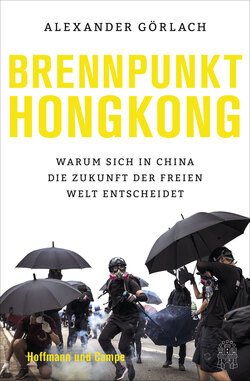Читать книгу Brennpunkt Hongkong - Alexander Görlach - Страница 5
Der Zustand der Demokratie in der Welt: die autokratische Herausforderung
ОглавлениеVor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert machten zwei Bücher Furore, Francis Fukuyamas Das Ende der Geschichte und Samuel P. Huntingtons Kampf der Kulturen. Die Autoren, beide amerikanische Politikwissenschaftler, formulierten darin ihre Antwort auf einen unglaublich einschneidenden historischen Moment, den Untergang der Sowjetunion. Fukuyama sah eine neue Morgenröte anheben, ein demokratisches Zeitalter. Nach dem Ende des Kommunismus habe die Demokratie unter Beweis gestellt, die stärkere Kraft zu sein. Nun würden sich alle Länder Schritt für Schritt für diese Regierungsform entscheiden. Nachdem die alte Blockkonfrontation zerfallen sei, die bis dato die Weltgeschichte geprägt habe, zuletzt durch die Gegenstellung von Freiheit und Kommunismus, sei die Geschichte, die der Mensch nur in systematischen Auseinandersetzungen erfahren könne, zu einem Ende gekommen. Auch Huntington sah einen neuen Äon heraufziehen, den einer multipolaren Welt. Verschiedene Kulturkreise würden nun mit- und gegeneinander um die Vorherrschaft in der neuen Zeit wetteifern. Diese Kulturwelten bestünden jeweils aus einem Anführer und aus einer Vielzahl von Unterstützern. So würde die westliche Kulturwelt, zu der unter anderem Europa, Kanada und Australien gehören, von den USA angeführt.
In den vergangenen drei Jahrzehnten haben wir uns angewöhnt, aufkommende Konflikte mithilfe einer der beiden Schablonen zu verstehen und zu deuten. Dass die Autoren mit ihren Gedanken nicht unrecht hatten, wird allein dadurch belegt, dass ihre Buchtitel inzwischen zu geflügelten Worten geworden sind, die wir verwenden, ohne dass wir dafür zwingend das betreffende Buch gelesen haben müssen.
Fukuyama und Huntington legen offen, dass der Systemkonflikt der entscheidende Treiber des Politischen ist. Das mag für manche banal klingen, aber der dieser Behauptung zugrunde liegende Zusammenhang ist es bei weitem nicht: Es geht den Menschen eben nicht nur um »Good Governance«, also darum, gut regiert zu werden. Dieses Streben haben auch Menschen in Nichtdemokratien. In Demokratien ist das Streben mehr, es ist ein Anspruch. Eine gute Regierung wollten auch die Völker der mittelalterlichen Christenheit, die es gelegentlich für sich in Anspruch nahmen, einem gesalbten Haupt die Gefolgschaft zu versagen. Der von Gottes Gnaden eingesetzte König verlor seine Legitimität, wenn er den Pflichten zum Schutze seiner Untertanen nicht gerecht wurde. Good Governance war auch schon in der Welt, lange bevor die Frontstellungen des 20. Jahrhunderts die Geschehnisse der Vergangenheit restlos überlagerten.
In einem Systemkonflikt geht es um Weltanschauung, um Überzeugung und Glauben, um normative Setzung. Fukuyama und Huntington beschreiben in diesem Sinne – und nebenbei bemerkt in bester Gesellschaft mit Joachim von Fiore, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx und Oswald Spengler – eine spekulative Abhandlung der Weltgeschichte. Sie sprechen nicht darüber, wie die Welt ist, sondern wie sie sein sollte. Eine Idealisierung, die aufgrund ihres Aufforderungscharakters große Wirkung auf die Realpolitik gehabt hat. Auf der Seite der Regierten beispielsweise sehen wir, in den vergangenen Jahren verstärkt, dass Bürgerinnen und Bürger bereit sind, für die Idee – manche würden sagen für die Utopie – einer Welt, wie sie sein sollte, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, materielle und ideelle. So wurde vor dem Brexit immer wieder festgestellt, dass Befragte in Großbritannien den Ausstieg aus der Europäischen Union befürworteten, auch wenn es für sie persönlich einen ökonomischen Nachteil bedeuten würde. Das (falsche) Versprechen der Brexiteers – ein zu neuer Stärke gelangtes Großbritannien, das sich im Systemwettstreit mit der EU behaupten und zu neuer globaler Relevanz aufsteigen würde – elektrisierte die Menschen mehr als die laue Routine und abgeklärte Sprache eines europäischen Apparates, der durchaus in der Lage ist, Good Governance für die 550 Millionen Europäerinnen und Europäer abzugeben.
Dass dieser Systemkonflikt Mutter und Haupt aller politischen Klassifizierungen ist, zeigt die neue Frontstellung zwischen »liberaler« und »illiberaler« Demokratie. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, dass es sich hierbei nicht um gleichberechtigte Antagonisten eines Gegensatzes handelt, sondern dass die Bezeichnung »illiberal« vielmehr bewusst von den Anhängern des Illiberalen eingesetzt wird. Damit führen sie ihre undemokratische Vorstellung als eine gleichberechtigte Variante der Demokratie ein, was sie nicht ist. »Illiberal« soll einen Systemkonflikt der Marke »Wir gegen die« behaupten, der die Menschen fesselt und ihnen gleichzeitig Wert und Relevanz zuspricht. Man muss also konstatieren, dass Samuel Huntington eher recht hatte, weil die Eliminierung des Systemkonflikts, wie sie von Francis Fukuyama zugunsten einer Welt, die nur noch einen Zustand kennt, nämlich den der Demokratie, prophezeit wurde, meines Erachtens nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Gleichzeitig hatte Fukuyama aber recht, wenn er vermutete, dass die Demokratie sich nach dem Niedergang des Sowjetimperiums im Aufwind befinden würde. Und dass es sich so viele ihrer Widersacher bis auf den heutigen Tag zur Lebensaufgabe machen, sie zu bezwingen, belegt einmal mehr ihre Macht. Viel Feind’, viel Ehr’!
Die Welt ist wieder zweigeteilt: in Demokratien und in Nichtdemokratien. Wir erleben heute exakt eine solche Entgegensetzung wie die, von der Fukuyama glaubte, dass sie überwunden würde. Huntington allerdings liegt falsch mit seiner Idee von sieben relevanten Kulturkreisen, die miteinander im Wettstreit liegen sollten. Das entspricht nicht der Welt, in der wir jeden Tag aufwachen. Sicher, es gibt Konflikte zwischen den USA und China, zwischen der EU und der Türkei, zwischen Japan und Korea. Aber all diese Spannungen lassen sich nur in dem größeren Kontext analysieren und verstehen, der die involvierten Parteien entweder dem Lager der Demokratie oder dem der Nichtdemokratie zuordnet.
Die Nichtdemokraten möchten es als einen lapidaren Unterschied erscheinen lassen, wenn sie sich mit dem Etikett »illiberal« versehen. Dabei verbergen sich unter dem neuen Begriff alte Bekannte, denen man lieber nicht begegnen möchte: die Diktatur, die Despotie, die Autokratie. Ganz anders verhält es sich im Lager der liberalen Demokratie: Man kann sich das attributive Adjektiv im Grunde sparen, denn jede Demokratie ist heute liberal. Aber wir sind in der Auseinandersetzung mit den Illiberalen mittlerweile gezwungen, das Adjektiv zu gebrauchen, um deutlich zu machen, auf welcher Seite wir stehen.
»Liberal« soll hier jene Ausprägung der Demokratie bezeichnen, in der wir heute leben. Was heißt das? Man kann den gesamten demokratischen Weg so verstehen: als Postulat einer Beteiligung aller am Politischen, das in der Theorie zwar schon in der Antike aufgestellt, aber in der Praxis bis in die jüngere Vergangenheit nicht eingelöst wurde. So errangen Frauen erst vor einem Jahrhundert das Wahlrecht. Chinesen wurde dieses Recht noch viel länger vorenthalten, genauso Afroamerikanern und anderen Minderheiten. Liberal ist also zum »neuen Normal« geworden und bezeichnet einen politischen Zustand, den die meisten von uns nicht mehr aufgeben wollen würden. Illiberal bedeutet im Umkehrschluss ein Modell, das seinen Anhängern beispielsweise verspricht, Frauen das Wahlrecht zu entziehen.
Als ein weiteres Kennzeichen des Illiberalen machen seine Propagandisten das Mehrheitsprinzip aus. Eine Demokratie sei nämlich nur dann eine, sagen sie, wenn die Mehrheit über die Minderheit herrscht. Wenn 95 Prozent der Bevölkerung heterosexuell sind, dann haben sich, nach ihrer Logik, die fünf Prozent Homosexuellen gefälligst hintanzustellen. Für diese Minderheit wird keine Politik gemacht, weil Politik nur etwas für eine Mehrheit sei. Am Ende meinen sie mit illiberal eine homogene Gesellschaft, die sich durch gleiche »Rasse«, Sprache, Religion, Kultur, Sitte und Moral auszeichnen soll. Eine solche Gesellschaft gibt es nicht. Schon in der vordemokratischen Welt waren die Imperien ein Vielvölkergemisch, in dem unterschiedlich gesprochen und zu verschiedenen Göttern gebetet wurde. Und ob Habsburger oder Osmanen: Beide versuchten den Minderheiten in ihrem Reich eine gewisse Autonomie einzuräumen, die sich mit der Herrschaftsausübung der Zentralgewalt vertrug.
Eine konforme Identität, ein Wir, besteht dann am besten, wenn es die Anderen gibt, an denen sie sich abarbeiten kann (»Mia san mia!«). Je abstrakter diese Anderen sind, desto besser lassen sie sich im Systemkonflikt instrumentalisieren. Illiberale der Gegenwart haben unter anderem transsexuelle Menschen als ihre Lieblings-Anderen ausgemacht. Die Menschheit, sagen sie, bestehe aus Männern und Frauen. Sie seien die beiden Geschlechter und bewegten sich, die Disposition der Geschlechtsmerkmale belege dies, aufeinander zu. Die behauptete Binarität wird unter Umständen noch dem lieben Gott in die Schuhe geschoben, der die Welt so geschaffen habe. Sensibilität gegenüber Menschen, die sich nicht in dieses simple Weltbild einordnen lassen? Fehlanzeige.
Illiberale sind Autokraten. Ein Autokrat ist, definitionsgemäß, einer, der ohne Beschränkung Politik betreiben kann. Beschränkung meint hier, dass der Autokrat selbst der Gesetzgeber ist und weder von Gesetzen noch von einer Verfassung in seiner Herrschaftsausübung in die Schranken gewiesen werden kann. »Die Stände, das bin ich«, soll der Sonnenkönig Ludwig XIV. gesagt haben, der als absolutistischer Monarch gilt. In der landläufigen Übersetzung von »L’état, c’est moi« – »Der Staat bin ich« – kommt das pointierter zum Ausdruck. Ein Autokrat ist ein Absolutist. Der demokratische Verfassungsstaat ist der Gegenspieler der Autokratie. Dort bestimmen Gesetze die Abläufe und nicht der Wille einer Person. Darüber hinaus haben jede und jeder Einzelne für sich, als Bürgerin und Bürger, eine Rolle und eine Bedeutung, die von nichts anderem abhängt als von ihrer Staatsbürgerschaft, die sie normalerweise nicht ablegen können und die ihnen auch nicht entzogen werden darf. In einem so konstituierten regelbasierten Gemeinwesen gibt es kein Oben und kein Unten im Sinne einer Mehrheit, die alle Minderheiten unterdrückt und dominiert. Eine Bürgerin oder ein Bürger werden in einer Demokratie eben nicht nach bestimmten Kriterien wie Rasse, Geschlecht oder Religion klassifiziert und in eine Art Kastensystem gepfercht. Indem eine Bestimmung zwischen »wir« und »die« unterbunden ist, ist es auch nicht relevant, wer an der Spitze der Nahrungskette steht, da niemand mehr verspeist wird.
Der Krieg aller gegen alle, von dem der Staatstheoretiker und Philosoph Thomas Hobbes im Leviathan 1651 spricht, beschreibt jenen (idealisierten, modellhaften) Urzustand des Faustrechts, in dem der Stärkste die anderen dominiert. Dieser stete Kampf, so Hobbes, zermürbt die vielen und raubt dem Gemeinwesen sein Potenzial. Denn an einem Tag obsiege ich im Kampf, aber schon am nächsten bin ich damit beschäftigt, nicht von einem anderen überwältigt zu werden, und am dritten Tag wiederum unterwirft mich ein anderer. Am vierten Tag dann geht das Spiel von vorne los. Um Angst und Unsicherheit zu überwinden, fordert Hobbes den Austritt aus diesem rauen und harten Naturzustand. Regeln und Gesetze orientieren sich an objektiveren Maßgaben als an der physischen Stärke, die es dem einen ermöglicht, sich über den anderen zu erheben. Der Mensch will nach Hobbes den Naturzustand allein schon deshalb überwinden, weil er niemals alle Situationen vorhersehen kann, in denen er als Gewinner oder als Verlierer vom Platz geht.
Der Autokrat muss sich deshalb eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft zur Komplizin machen. Jene, die er am ehesten für bereit hält, seiner binären Weltanschauung (»Wir gegen die«) zu folgen. Das müssen nicht immer diejenigen sein, denen es ökonomisch besonders schlecht geht, wie eine landläufige Vermutung nahelegt. Gerade bei dem bereits erwähnten Brexit-Votum beispielsweise hat sich gezeigt, dass sich Angehörige aller sozioökonomischen Schichten von der Rhetorik der Befürworter eines EU-Austritts haben begeistern lassen.
Autokratie ist der Rückfall in den Naturzustand, den Thomas Hobbes beschreibt. Nicht nur er, auch Jean-Jacques Rousseau und John Locke haben ihre Theorie einer guten und gerechten Gesellschaft auf dem Ausgang aus dem Naturzustand begründet. Das Faustrecht – das Recht des Stärkeren – generiert, so die Denker, Angst sowohl bei den Beherrschten als auch bei den Herrschern selbst, denn sie könnten ebenfalls von einem noch stärkeren Herrscher eines Nachbarreiches niedergerungen werden.
Bereits in der Antike hat man versucht, sich auf gewisse gemeinsame Grundsätze der Kriegsführung zu verständigen, um Schwächere vor Stärkeren zu schützen. Der Stärkere sollte die Schwäche seines Nachbarn nicht ohne Not ausnutzen dürfen und ihn überfallen, seine Ernte niederbrennen, Reichtümer rauben, Frauen verschleppen und Männer versklaven. Wer einer so in Bedrängnis geratenen Nation zu Hilfe eilt, sagt der heilige Augustinus, der tut ein gutes Werk. Der Krieg, den er gegen den Unterdrücker führt, wird dadurch ein »gerechter Krieg«.
Der römische Politiker und Redner Cicero pocht darauf, dass es Regeln geben muss, auch und gerade im Krieg, an die sich alle Parteien gebunden fühlen. Er spricht in De officiis von einem Band, das alle Glieder der Menschheitsfamilie miteinander verbinde. Unser natürlicher Empfindungsapparat sei so ausgestattet, dass er die Ebenbürtigkeit jedes Mitmenschen wahrnehmen könne und somit alles Entmenschlichende zu unterbleiben habe. Cicero setzt sich deshalb für ein strenges Folterverbot ein. Aber wir wissen, dass bis zum heutigen Tag gefoltert wird. Die Folter ist leider seit jeher ein erprobtes Mittel der Kriegsführung. Umso wichtiger ist es, uns zu vergegenwärtigen, dass wir mit Cicero einem der ersten Vertreter der Menschenrechte begegnen. Er macht deutlich, dass die Menschenrechte zu verbindlichen Regeln antreiben, die es einzuhalten gilt, um die Würde jedes Einzelnen zu schützen.
Unsere heutige Demokratie und die von den Demokratien in der Epoche seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs miteinander aufgebaute Weltordnung verwirklichen Ciceros Postulat. Unsere Verfassungs- und Rechtsordnungen gründen auf der Anerkennung der Menschenrechte. Das Faustrecht, das Recht des Stärkeren, das Autokraten, die sich selbst gerne als Strongmen, als starke Männer, feiern, zum Taktgeber des Politischen verklären möchten, ist darin nicht vorgesehen.
Ciceros Setzung ist keine religiöse. Das ist wichtig zu betonen, denn im Diskurs über den Ursprung der Menschenrechte wird auch darüber gesprochen und diskutiert, welche Rolle andere Quellen – unter anderem das Christentum – bei ihrer Festlegung gespielt hätten. Ich denke, es ist unstrittig, dass die christliche Anthropologie, die Lehre vom Menschen, bei der Ausformulierung des Menschenrechtsgedankens eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat.
Wie Ciceros wichtige Forderungen stammt auch der Grundsatz pacta sunt servanda aus der römischen Zeit: Verträge müssen eingehalten werden. Denn nur so kann Verlässlichkeit zwischen Menschen gestiftet und erhalten werden. Wenn wir heute von der regelbasierten internationalen Gemeinschaft sprechen, dann haben wir auch immer Cicero im Ohr: Wer einen Vertrag bricht, begeht ein Vergehen. Cicero geht sogar noch weiter, wenn er fordert, dass niemand seinen Feind belügen dürfe. Die Menschen schuldeten sich, schreibt er, selbst im schlimmsten aller Konflikte aufgrund des gemeinsamen Bandes, das sie qua ihres Menschseins verbindet, einen bestimmten Umgang, der durch nichts aufgehoben werden kann.
Der Friedensvertrag nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg, während dessen sich die verfeindeten Parteien unerbittlich niedergemetzelt hatten, wurde ausdrücklich unter der Bedingung geschlossen, dass sich alle Parteien verpflichten, ihn nicht zu brechen. In der Eingangsformel des Friedensvertrages wird festgehalten, dass er geschlossen wird, als ob es Gott nicht gäbe: Etsi deus non daretur. Religion, so haben die Parteien eingesehen, war die Ursache für die Polarisierung, die zum Krieg geführt hatte. Sie kann also nicht das Heilmittel gegen die Krankheit des Krieges sein, den sie selbst verschuldet hat. Der Vertrag gilt als erste Errungenschaft des neuzeitlichen internationalen Rechts.
Für die »Wir-gegen-die-Anderen«-Mobilisierung, von der wir bereits als Kennzeichen autokratischer Politik gesprochen haben, funktionieren Religion und Nation als die zwei Schlüsseltreiber. Der Autokrat versichert dem Wir Zugehörigkeit und Identität, indem er immer wieder auf die gemeinsame Religion innerhalb seiner Nation hinweist. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Xi Jinping predigt in der Volksrepublik China einen Kommunismus mit chinesischen Charakteristika. Damit begünstigt er die Han, Chinas größte Ethnie, neben der es 55 andere anerkannte Minderheiten gibt. Zu diesen Charakteristika gehört die Lehre des Konfuzius, die in einer der Kommunistischen Partei genehmen Fassung die Herrschaft der Partei mit den Mitteln des Kaiserreichs legitimieren soll. Auch der indische Premierminister Narendra Modi propagiert ein vollständig hinduistisches Indien und billigt damit unter anderem die Diskriminierung von rund 200 Millionen Muslimen, die in der größten Demokratie der Welt Tür an Tür mit Angehörigen anderer Religionen leben. Und in Ungarn hat Premierminister Viktor Orbán in der Coronakrise alle Macht an sich gerissen und damit die Verfassung endgültig ausgehebelt. Er sprach davor schon lange und ausgiebig darüber, dass Ungarn eine christliche Nation sei, die keine muslimischen Flüchtlinge aufnehmen und sich so der Islamisierung des Abendlands in den Weg stellen werde. Ähnliches geschieht in Polen, auch dort wurde die Verfassung ausgehebelt. Die Brexit-Befürworter in Großbritannien spielten ebenfalls mit der Angst vor Einwanderung. Und in den USA kommt es seit der Amtseinführung von Donald Trump zu Hasskriminalität gegenüber Minderheiten wie Afroamerikanern und Lateinamerikanern oder zuletzt Ostasiaten, die der Präsident für die Coronakrise verantwortlich gemacht hat. Der »Anführer der freien Welt« beleidigt regelmäßig behinderte Menschen und hat im Sommer 2019 vier weiblichen Kongressabgeordneten zugerufen, sie sollten gefälligst dahin zurückgehen, wo sie hergekommen seien. Wohlgemerkt, alle vier Frauen – Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley und Rashida Tlaib – sind US-Amerikanerinnen, aber Trump polemisierte mit seiner Einlassung gegen die Einwanderungsgeschichte ihrer Familien und sicherte sich somit Zuspruch bei seiner rassistischen und frauenfeindlichen Basis.
Für den demokratischen Nationalstaat ist es weder entscheidend, welches Geschlecht ein Mensch hat, ob er weiblich oder männlich ist, jung oder alt, christlich oder jüdisch, reich oder arm, gesund oder behindert, hetero- oder homosexuell, sondern einzig und allein, dass sie oder er Staatsbürger sind. Menschenwürde, Verfassungsordnung und Staatsbürgerschaft sind die Trinität der Demokratie, die heute von ihren Gegnern als liberal bezeichnet wird. Die Legitimation des Nationalstaats liegt einzig darin, dass er in der Lage ist, diese drei Grundsätze zu garantieren und zu verteidigen. Ein Staat, der diese seinen Bürgerinnen und Bürgern vorenthält, kann kein legitimer Staat sein. Der demokratische Nationalstaat hingegen, dem einige bereits die Totenmesse gelesen haben, ist der stärkste Teilnehmer auf dem Marktplatz des Politischen. Demokratische Nationalstaaten brauchen gegenüber anderen Demokratien kein »Wir gegen die Anderen«. In der Diplomatie werden demokratisch verbundene Nationen als like-minded countries, als Gleichgesinnte, bezeichnet. Man kann auch einfach sagen, dass sie Freunde sind. Hongkong, Taiwan, Südkorea, Japan, die Mongolei, Deutschland, Frankreich, die USA, Südafrika, Uruguay – all diese Länder sind durch gemeinsame Ideale miteinander verbunden. Jedes dieser Länder hat seine Geschichten, Kulturen, Sprachen, Küchen, die zusammen zu einer jeweils eigenen Identität gewachsen sind. Das Entscheidende aber ist, dass die klassischen Trennungsparameter Nation und Religion nicht als exklusiv betrachtet werden, sondern sich der demokratische Verfassungsstaat, ganz im Sinne seiner antiken Vordenker, über das Recht und seine Anerkennung definiert.
Die Europäische Union ist, in ihrer Idealform, genau das: Sie weitet die Souveränität ihrer Bürgerinnen und Bürger über die Grenzen der Herkunftsländer dieser Menschen aus. Die Brexit-Befürworter in Großbritannien, die behaupteten, dass die EU ihnen ihre Souveränität nähme, haben frech gelogen: Noch nie hatte eine Bürgerin, ein Bürger so viele Möglichkeiten wie in der Europäischen Union. Ein Engländer kann in Spanien leben und arbeiten, ein Italiener in Österreich und ein Franzose in Polen. Die Souveränität der Menschen, die als Bürger die Adressaten der Verfassung sind, hat sich durch diese länderübergreifende Einheit um ein Vielfaches vergrößert – und das im buchstäblichen Sinne. Auch für Gäste gelten die Menschenrechte und das Versprechen der Rechtsstaatlichkeit. Wenn ein Japaner in den Niederlanden Urlaub macht, dann muss er nicht fürchten, ohne Anwalt und Verfahren im Gefängnis zu landen oder gar Folter ausgesetzt zu sein. Diese demokratischen Grundsätze gelten für alle, die im Verbund der Demokratien befreundet sind, für Spanier, die nach Taiwan fliegen, genauso wie für Südkoreaner, die nach Italien kommen, oder für Deutsche, die nach Hongkong reisen. Umso mehr zeigt sich, um was für eine scheußliche Übergriffigkeit es sich bei dem oben erwähnten Auslieferungsgesetz handelt, das China in Hongkong unter Carrie Lam durchsetzen wollte: Nicht nur die Bewohner Hongkongs, sondern auch alle Besucher könnten jederzeit nach China ausgeliefert werden, wenn die Volksrepublik – die kein Rechtsstaat ist und die Menschenrechte nicht anerkennt – dies einfordern sollte.
Wenn Xi Jinping »einmal Chinese, immer Chinese« sagt, dann ruft er damit alle Angehörigen der Han-Ethnie auf, stets auf das zu hören, was »das Mutterland« vorgibt. Damit ignoriert der kommunistische Machthaber die internationale Ordnung und ihr Recht und setzt auf Spaltung. In Singapur ist die Mehrheit der Staatsbürger chinesischer Abstammung. Würden diese Xi Jinping Folge leisten, wären sie keine Bürger Singapurs mehr. Ein Bürgerkrieg wäre die Folge. Genauso geht der türkische Machthaber Recep Tayyip Erdogan vor, wenn er deutsche Bundestagsabgeordnete türkischer Herkunft ordinär duzt und öffentlich anpöbelt. Als Türken hätten sie der türkischen Sache zu dienen. Wladimir Putin wiederum ist der Einzige, der versucht, das System von innen heraus auszuhöhlen. Er lässt auf der Krim russische Pässe verteilen und auf diese Weise über Nacht Ukrainer zu Russen machen. Jetzt ist er auch für sie zuständig und kann jederzeit behaupten, die russische Präsenz in der kriegsgebeutelten Zone diene allein dem Schutz russischer Staatsbürger.
In Polen und Ungarn machten sich die Autokraten daran, die Verfassung auszuhebeln, indem sie die Kontrolle über die obersten Gerichte ergriffen oder mittels Verfassungsänderungen den demokratischen Charakter ihrer Nationen zerstörten. Der ungarische Machthaber Orbán hat sein Land in den vergangenen Jahren so umgebaut, dass es ihm ein Leichtes war, sich in der Coronakrise mit solch einer umfassenden Macht auszustatten, dass es für Ungarn eigentlich unmöglich geworden ist, weiterhin Mitglied in der Europäischen Union zu bleiben. In dem Land hängen, vorschriftswidrig, seit Jahren schon keine europäischen Fahnen mehr an öffentlichen Gebäuden. Der Abschied aus dem Verbund der Freunde ist ein Abschied auf Raten.
Die Dreifaltigkeit der Demokratie – Menschenwürde, Verfassungsordnung und Staatsbürgerschaft – wirktnicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Denn der demokratische Staat existiert, wie wir gesehen haben, nur deshalb, weil er seinen Bürgerinnen und Bürgern garantieren kann, dass auf seinem Territorium die Menschenrechte anerkannt werden und jede staatliche Aktivität sich auf die Verwirklichung jener fairen und gerechten Gesellschaft richtet, die diese Menschenrechte einfordert.
Der 2009 verstorbene Soziologe und liberale Denker Ralf Dahrendorf nannte zwei Komponenten, die bei der Verwirklichung der demokratischen Idee essenziell sind: civil rights und social rights, Bürgerrechte und soziale Rechte. Sie sollen verbürgen, dass die Menschenwürde, von der die Verfassung spricht, ihr Dasein nicht als eine leere Hülle fristet. Menschenwürde als Postulat muss konkrete Auswirkungen haben. Unter civil können wir Rechte wie das Wahlrecht oder das Recht auf freie Meinungsäußerung verstehen. Unter social Zugang zu Bildung oder zu einer allgemeinen Gesundheitsversorgung. Die Anerkennung der Gleichheit aller verpflichtet zur gleichen Behandlung aller. Man kann nicht bürgerliche Rechte hochhalten, wenn keine sozialen Rechte mit ihnen einhergehen. Für die demokratische Nation bedeutet das, dass allen Bürgerinnen und Bürgern gleiche Teilhabe zusteht. Denn nur wer zur Schule gehen und einen Arzt aufsuchen kann, der hat die Möglichkeit, sich im Gemeinwesen zu etablieren und einzubringen. Teilhabe ist in der Praxis, was Souveränität in der Theorie ist. Diese Teilhabe ist ebenso die praktische Seite der Würde, die jedem Menschen in einer Demokratie zugesprochen wird. Über Teilhabe am Arbeitsmarkt erhalten Menschen Akzeptanz und ein soziales Umfeld. Nicht zuletzt erwirtschaften sie dort das, was sie zum Leben brauchen. Die Akzeptanz einer Demokratie beginnt genau dann zu erodieren, wenn in diesem Nukleus das Zueinander dieser Komponenten nicht mehr harmonisch ist. Kein fairer Zugang zu Gesundheitsversorgung und Ausbildung oder Arbeitslosigkeit verhindern die Teilhabe. Francis Fukuyama schreibt in Identität: Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet, dass sich in der gegenwärtigen Zeit immer mehr Menschen entwürdigt fühlen. Wenn die Teilhabe unmöglich gemacht wird, wenn die Bürgerin oder der Bürger zu einer bloßen Nummer im Jobcenter wird, dann trifft das jeden Menschen hart in seinem Kern.
Francis Fukuyama weist damit auf einen Zusammenhang hin, der für den Aufstieg der Autokraten elementar ist: So auf sich selbst zurückgeworfen, wird für den Menschen die Emotion wichtiger als das nationale Argument. Es mag ja sein, dass der technologische Wandel zuerst Arbeitsplätze vernichtet, bevor neue entstehen. Es mag auch sein, dass es dafür Belege, Zahlen und Beispiele aus anderen Ländern oder der Vergangenheit gibt. Wenn man aber selbst von Arbeitslosigkeit heimgesucht wird und nicht weiß, wie man die nächste Miete, den Strom oder die Handyrechnung bezahlen soll, dann ist jeder mit sich allein.
In der Finanzkrise des Jahres 2008 verloren Hunderttausende US-Amerikaner ihr Zuhause. Etliche von ihnen zogen bei ihren Eltern, Geschwistern oder anderen Verwandten ein, in ein Gästezimmer oder in den dafür hergerichteten Keller oder auf den Dachboden, um nicht auf der Straße zu landen. Unter Präsident Barack Obama wurden die Banken gerettet, jene Hausbesitzer aber ohne mit der Wimper zu zucken in die Obdachlosigkeit geschickt. Das Gefühl der Entwürdigung – jede und jeder, die ihr Haus verloren haben, kennen es. In solch einem Moment steht die Akzeptanz der demokratischen Grundordnung auf dem Spiel. Denn wenn die Verfassungen von der unantastbaren Würde des Menschen tönen und diese in den Mittelpunkt staatlichen Handelns rücken, aber Entwürdigung das Gefühl der Stunde ist, dann ist die Einheit von bürgerlichen und sozialen Rechten zerbrochen. Für die, die so von der Krise getroffen wurden, wird die Rede von der Demokratie schal und leer.
Auch die Covid-19-Pandemie wird die Demokratien vor eine ähnliche Herausforderung stellen. Durch das Virus erleidet die Weltwirtschaft Schiffbruch. In den USA meldeten sich Ende März, Anfang April 2020 bereits rund zehn Millionen Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenrate, die in den USA vor der Pandemie bei 3,5 Prozent lag, könnte Schätzungen zufolge bis auf 30 Prozent steigen, was sogar die Zahlen der Großen Depression 1929 übertreffen würde! Immerhin gibt es in vielen Ländern der Welt, darunter befinden sich auch die USA und Deutschland, während dieser Krise finanzielle Hilfestellungen nicht nur für die Banken, sondern auch für die Bürger.
Im Jahr 2008 gab es die solidarische Hilfe, die wir einander aufgrund des uns verbindenden menschlichen Bandes schulden, nicht. Barack Obama, der seinen Wahlkampf mit dem Slogan »Yes, we can!« geführt hatte, lieferte nicht. Die Wahl Donald Trumps im Jahr 2016 kann als eine direkte Konsequenz aus diesem Versäumnis verstanden werden. In einem Moment, in dem das demokratische Narrativ brüchig geworden ist, konnte Trump mit einem einwanderungsfeindlichen Wahlkampf und dem Schlachtruf »Make America Great Again« die entwürdigten Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. Aber Trump hatte wenig Konkretes anzubieten. Und auch wenn einige Kommentatoren darauf hinwiesen und ergänzten, dass eine von Trump angekündigte Steuererleichterung für Konzerne sehr wahrscheinlich nicht mehr Geld in den Taschen der gebeutelten amerikanischen Mittelklasse bedeuten würde, waren viele Wählerinnen und Wähler dennoch bereit, einen alten weißen Mann zu wählen, von dem sie sich erhofften, dass er ihnen ihre Würde und ihren Stolz als Amerikaner wiedergeben würde. Sollte dies Opfer bedeuten, so sei’s drum. Die Logik folgt demselben Muster wie im Brexit-Verfahren.
Die Krise des Jahres 2008 hat auf besonders starke Weise gezeigt, welche desaströsen gesellschaftlichen Verwerfungen damit einhergehen, wenn civil rights und social rights aus dem Lot geraten. Aber alle Demokratien der westlichen Welt haben, in dem einen oder anderen Maß, während der vergangenen 30 Jahre Defizite aufgebaut. Zwar steigt die Produktivität in den Ländern aufgrund zunehmender Automatisierung und Digitalisierung, jedoch macht sich dies nur im Bruttoinlandsprodukt bemerkbar und nicht in den Portemonnaies der Haushalte. Infolgedessen können sich Menschen über die Zeit weniger leisten, und es entsteht ein Gefühl der Entkoppelung, des Abgehängtseins. Damit einher geht die Angst davor, wie viele Arbeitsplätze der technologische Fortschritt in den kommenden Jahren vernichten wird. Unter den Stichwörtern künstliche Intelligenz und Robotik subsumieren viele Menschen ihre Sorgen, alsbald ohne Job dazustehen und von Maschinen ersetzt zu werden. Auch wenn eine zunehmende Automatisierung immer noch die meisten Arbeitsplätze wegrationalisiert, so gibt es bereits Untersuchungen, die zeigen, dass sowohl in Arztpraxen als auch in Bankfilialen und Rechtsanwaltskanzleien aufgrund des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in Zukunft viele Jobs verloren gehen werden. Erstmals seit der Industrialisierung erfasst diese Welle nicht nur Menschen, die mit ihrer körperlichen Kraft ein Auskommen haben, sondern auch Menschen mit sogenannten White-Collar-Jobs, also mit bessergestellten Bürotätigkeiten.
Die Angst, von diesem Wandel heimgesucht zu werden, hat die Mittelschicht erreicht. Unsicherheit greift um sich. In einer Umfrage der Uni Göttingen, die sich an Anhänger der rechtsgerichteten Pegida wandte, gaben etliche der Befragten an, dass es ihnen heute genauso gut oder sogar besser ginge als vor zehn Jahren. Sie hätten aber Angst, dass dies in Zukunft nicht mehr so sein könnte, Angst um sich selbst, um ihre Kinder und Enkelkinder. (Die Studie konnte nicht genügend Probanden befragen, um am Ende als repräsentativ zu gelten. Die Universität entschied sich gemäß Angaben von Spiegel online dennoch zur Veröffentlichung, weil auch die gemachten Stichproben einen gewissen Einblick zuließen.)
In seinem Buch Der Zukunftsschock: Strategien für die Welt von morgen hat Alvin Toffler bereits vor einem halben Jahrhundert beschrieben, was in einer solchen Situation geschieht: Wenn der (technologische) Wandel dermaßen Fahrt aufnimmt, dass selbst die Eliten in einem Land ihn nicht mehr erklären können, dann werden die Menschen unsicher und ängstlich. Kurz darauf finden sich Populisten und Hardliner ein, die die Ängste der Menschen instrumentalisieren und für ihre Zwecke ausnutzen. Dann wiederum sind die Menschen bereit, eine Wir-gegen-die-Argumentation anzunehmen. Ein Anderer – ein Sündenbock – wird gebraucht, der als Grund für die Misere, in der man sich befindet, herangezogen werden kann. Der französische Philosoph René Girard hat zum Thema des Sündenbocks gearbeitet. Seiner Auffassung nach – er hat alle antiken Erzählungen studiert, in denen ein Sündenbock vorkommt – führt ein gemeinsamer Sündenbock verfeindete Menschen und Gruppen wieder zusammen. Im Gegensatz zum biblischen Sündenbock, der mit der Sünde des Volkes beladen zum Verenden in die Wüste geschickt wird, wird der Girard’sche Sündenbock durch Tötung aus der Welt geschafft. Auch und gerade in der Coronakrise tritt dieses Motiv verstärkt auf: Donald Trump nannte Covid-19 mehrfach »das chinesische Virus«, um von seinen eigenen Verfehlungen und denjenigen seiner Administration abzulenken und stattdessen »die Chinesen« als die Verursacher der weltweiten Plage an den Pranger zu stellen.
Autokraten, Populisten, Strongmen – die Begriffe (und wer dahintersteckt) mögen verschieden sein. Alle drei aber nutzen die Unsicherheit und Ängste von Menschen aus mit dem Ziel, sich selbst an die Macht zu bringen und dort zu halten. Um das zu bewerkstelligen, zerstören sie die Säulen, die ich als Trinität der Demokratie beschrieben habe. Sie diskreditieren Journalisten, Künstler und Wissenschaftler und denunzieren all jene als »Experten« und »Elite«, die in einer Gesellschaft für Pluralität und Diversität stehen.
Demokratien sind gleich doppelt in Gefahr: von innen durch jene, die sich als Alternative zur etablierten Demokratie positionieren, und von außen durch jene, die sich zugunsten ihrer Gefolgschaft in den demokratischen Ländern engagieren und dort die öffentliche Meinung korrumpieren und Wahlen manipulieren.
Weder Fukuyama noch Huntington haben sich die Weltordnung der Gegenwart in dieser Weise ausgemalt, als sie nach dem Ende des Kalten Krieges in Stanford und Harvard ihre Bücher schrieben. Huntington würde sich besonders wundern: Er hat eine konfliktreichere Welt heraufziehen sehen. Der westlichen Welt prophezeite er, dass ihre Macht insgesamt geringer werden würde, wobei der Einfluss der Vereinigten Staaten von Amerika durchaus verhindern würde, dass der Westen auf Abwege geriete. An einen Präsidenten wie Donald Trump, der erklärtermaßen ein Freund von Autokraten und Autokratie ist, hätte Huntington in seinen kühnsten Träumen nicht gedacht. Trump liebt das Faustrecht mehr, als er internationale Abkommen schätzt. (Es ist nicht so, dass die USA vor ihm nicht auch schon hemdsärmelig aufgetreten wären, aber kein US-Präsident vor ihm hat so wenig Respekt vor der Verfassung und den Institutionen der USA gehabt wie Donald Trump.)