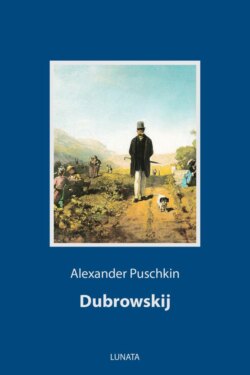Читать книгу Dubrowskij - Alexander Puschkin - Страница 8
Drittes Kapitel
ОглавлениеEs verging einige Zeit, aber das Befinden des armen Dubrowskij war noch immer schlecht. Die Anfälle von Wahnsinn hatten sich zwar nicht mehr wiederholt, aber seine Kräfte nahmen von Tag zu Tag ab. Er vernachlässigte seine gewohnten Beschäftigungen, verließ selten sein Zimmer und grübelte oft Tag und Nacht. Die gute alte Jegorowna, die einstige Wärterin seines Sohnes, wurde nun zu seiner Pflegerin. Sie pflegte ihn wie ein kleines Kind, erinnerte ihn an Essen und Schlafen, fütterte ihn und brachte ihn selbst zu Bett. Andrej Gawrilowitsch gehorchte ihr in allen Dingen, ließ aber sonst niemand zu sich. Er war nicht imstande, an seine Geschäfte und an die Wirtschaft zu denken, und die Jegorowna hielt es für notwendig, den jungen Dubrowskij, der in einem der Garde-Infanterieregimenter diente und sich in Petersburg aufhielt, über alles zu benachrichtigen. So riß sie ein sauberes Blatt aus dem Wirtschaftsbuche heraus und diktierte dem Koch Chariton, dem einzigen Mann, der in Kistenjowka zu schreiben verstand, einen Brief, den sie am gleichen Tage nach der Stadt zur Post schickte. Es ist aber Zeit, den Leser mit dem eigentlichen Helden unserer Geschichte bekannt zu machen. Wladimir Dubrowskij war in einem Kadettenkorps erzogen worden und dann in die Garde als Kornett eingetreten. Der Vater wandte alles auf, um seinem Sohne anständige Mittel zur Verfügung zu stellen, und der junge Mann bekam von zu Hause mehr, als er eigentlich erwarten durfte. Da er leichtsinnig und ehrgeizig war, erlaubte er sich kostspielige Liebhabereien: er spielte Karten, machte Schulden, dachte nicht an die Zukunft und sagte sich mitunter, daß er wohl früher oder später eine reiche Heirat machen würde.
Eines Abends, als mehrere Offiziere auf seinen Sofas lagen und seine Pfeifen rauchten, reichte ihm sein Kammerdiener Grischa einen Brief, dessen Aufschrift und Siegel den jungen Mann nicht wenig überraschten. Er öffnete ihn schnell und las folgendes:
»Unser gnädiger Herr, Wladimir Andrejewitsch! Ich, deine alte Wärterin, wage es, dir über die Gesundheit deines Vaters zu berichten. Es geht ihm sehr schlecht, manchmal weiß er nicht, was er spricht, und sitzt den ganzen Tag wie ein dummes Kind da. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Komme schneller zu uns, mein lieber Falke, wir wollen dir nach Pessotschnoje Pferde entgegenschicken. Man sagt, das Landgericht schickt zu uns seine Beamten, um uns dem Kirila Petrowitsch Trojekurow zu übergeben, weil wir, wie er sagt, ihm gehören; wir gehören aber von jeher euch, etwas anderes haben wir auch nie gehört. Du könntest darüber in Petersburg unserem Väterchen, dem Zaren, melden, er wird es nicht dulden, daß uns Unrecht geschieht. Ich verbleibe deine treue Magd Arina Jegorowna Busyrojowa.«
Wladimir Dubrowskij las diese wenig verständlichen Zeilen einige Mal hintereinander mit ungewöhnlicher Erregung. Er hatte seine Mutter in der frühesten Kindheit verloren und kannte seinen Vater fast nicht, da er schon im achten Lebensjahre nach Petersburg gebracht worden war. Trotzdem hing er an ihm mit romantischer Liebe und liebte das Familienleben um so mehr, je weniger er von seinen stillen Freuden gekostet. Der Gedanke an die Möglichkeit, den Vater zu verlieren, zerfleischte ihm schmerzhaft das Herz, und die Lage des armen Kranken, die er nach dem Briefe der Wärterin ahnte, erfüllte ihn mit Entsetzen. Er stellte sich seinen Vater vor, wie er einsam im entlegenen Dorfe, von der dummen Alten und der leibeigenen Dienerschaft gepflegt, daliegt ... bedroht von Unheil und ohne Hilfe in körperlichen und seelischen Qualen dahinsiechend. Wladimir warf sich sträfliche Nachlässigkeit vor. Als er von seinem Vater lange keine Nachricht erhalten, hatte er gar nicht daran gedacht, sich selbst zu erkundigen, und geglaubt, der Vater sei verreist oder mit der Wirtschaft beschäftigt. Am gleichen Tage fing er an, sich um einen Urlaub zu bemühen, und saß schon nach zwei Tagen mit seinem treuen Grischa im Postwagen.
Wladimir Andrejewitsch näherte sich der Station, von der er nach Kistenjowka abbiegen mußte. Sein Herz war von traurigen Vorahnungen erfüllt; er fürchtete, seinen Vater nicht mehr am Leben zu finden; er malte sich die traurige Lebensweise aus, die ihn auf dem Gute erwartete: Einsamkeit, Mangel an Gesellschaft, Armut und Geschäfte, von denen er nichts verstand. Auf der Station angekommen, fragte er den Stationsaufseher, ob er nicht Privatpferde haben könne. Der Stationsaufseher erkundigte sich nach seinem Reiseziel und teilte ihm mit, daß die ihm aus Kistenjowka entgegengeschickten Pferde schon seit vier Tagen hier auf ihn warteten. Bald erschien auch der alte Kutscher Anton, der ihn einst in den Pferdestallungen herumgeführt und sein eigenes kleines Pferdchen gepflegt hatte. Anton vergoß beim Wiedersehen mit ihm einige Tränen, verbeugte sich vor ihm bis zur Erde, sagte, daß der alte Herr noch am Leben sei, und eilte hinaus, um die Pferde anzuspannen. Wladimir Andrejewitsch verzichtete auf das ihm angebotene Frühstück und machte sich schleunigst auf den Weg. Anton fuhr ihn auf Dorfwegen, und unterwegs entspann sich zwischen ihnen folgendes Zwiegespräch:
»Sag' mir bitte, Anton, was hat mein Vater mit dem Trojekurow?«
»Das weiß Gott allein, Väterchen Wladimir Andrejewitsch. Unser Herr hat sich mit Kirila Petrowitsch irgendwie nicht vertragen können, und jener verklagte ihn bei Gericht, – obwohl er meistens selbst sein eigener Richter ist. Wir Knechte dürfen nicht über ihren herrschaftlichen Willen urteilen; aber bei Gott, es ist schade, daß dein Väterchen dem Kirila Petrowitsch getrotzt hat; ein Beil kann man mit einer Peitschenschnur nicht durchhauen.«
»Dieser Kirila Petrowitsch macht also hier bei euch alles, was er will?«
»Gewiß, Herr: der Assessor ist für ihn Luft, den Polizeimeister gebraucht er zu Botengängen, und alle Herrschaften kommen zu ihm gefahren, um ihm ihren Respekt zu zeigen. Es ist ja wahr: wenn es nur einen Trog gibt, die Schweine kommen von selbst.«
»Ist es wahr, daß er uns unser Gut nehmen will?«
»Ach, Herr, davon haben auch wir gehört. Neulich sagte der Küster von Pokrowskoje bei der Kindstaufe bei unserm Dorfschulzen: ›Es ist euch lange genug gut gegangen; jetzt nimmt euch Kirila Petrowitsch in Zucht.‹
Aber der Schmied Mikita sagte ihm: ›Genug, Ssaweljitsch, betrübe den Gevatter nicht und mache die Gäste nicht trübsinnig. Kirila Petrowitsch ist ein Mensch für sich, und Andrej Gawrilowitsch einer für sich, – wir sind aber alle Knechte Gottes und des Zaren.‹ Aber an einen fremden Mund kann man nicht gut einen Kopf annähen.« »Also wollt ihr nicht in den Besitz Trojekurows übergehen?« »In den Besitz Kirila Petrowitschs? Gott schütze und bewahre uns! Seine eigenen Bauern haben ein schlechtes Leben, wenn er aber auch noch fremde bekommt, so schindet er ihnen nicht nur die Haut vom Leibe, sondern auch das Fleisch von den Knochen. Nein, Gott schenke unserm Andrej Gawrilowitsch ein langes Leben; wenn ihn aber Gott zu sich nimmt, so wollen wir keinen anderen als dich allein, du unser Ernährer. Halte zu uns, und wir werden für dich mit Leib und Seele einstehen.« Bei diesen Worten holte Anton mit der Peitsche aus und zog die Zügel an, und die Pferde begannen einen schnellen Trab zu laufen.
Durch die Ergebenheit des alten Kutschers gerührt, verstummte Dubrowskij und gab sich seinen Gedanken hin. So verging mehr als eine Stunde; plötzlich weckte ihn Grischa aus seinen Gedanken mit dem Rufe: »Da ist Pokrowskoje!« Dubrowskij hob den Kopf. Er fuhr am Ufer eines weiten Sees entlang, dem ein Flüßchen entströmte, das sich zwischen Hügeln schlängelte und sich in der Ferne verlor. Aus einem der Hügel erhob sich über den grünen Wipfeln eines Gehölzes das grüne Dach und Belvedere eines großen steinernen Hauses; auf einem anderen eine Kirche mit fünf Kuppeln und einem alten Glockenturme; ringsum lagen die Bauernhäuser mit ihren Gemüsegärten und Ziehbrunnen zerstreut. Dubrowskij erkannte diese Gegend; er erinnerte sich, daß er als Junge auf diesem selben Hügel mit der kleinen Mascha Trojekurowna gespielt hatte, die zwei Jahre jünger als er war und schon damals versprach, eine Schönheit zu werden. Er wollte sich nach ihr bei Anton erkundigen, aber eine gewisse Scheu hielt ihn davon ab. Als der Wagen am Herrenhause vorbeifuhr, sah Dubrowskij ein weißes Kleid zwischen den Bäumen des Gartens schimmern. Aber im gleichen Augenblick schlug Anton auf die Pferde ein und sauste, dem Ehrgeiz folgend, der allen ländlichen Kutschern und Fuhrleuten eigen ist, über die Brücke und am Garten vorbei. Als sie das Gut hinter sich hatten und einen Hügel hinaufgefahren waren und Wladimir ein Birkenwäldchen und links davon ein kleines graues Häuschen mit rotem Dache erblickte, fing sein Herz schneller zu schlagen an – vor ihm lag Kistenjowka mit dem ärmlichen Hause seines Vaters.
Nach zehn Minuten fuhr er schon in den Gutshof ein. Mit unbeschreiblicher Erregung blickte er um sich: zwölf Jahre hatte er seine Heimat nicht gesehen. Die Birken, die man zu seiner Zeit längs des Zaunes gepflanzt hatte, waren gewachsen und zu großen schattigen Bäumen geworden. Der Hof, den früher drei regelmäßig angelegte Blumenbeete schmückten, zwischen denen ein breiter, sorgfältig gekehrter Weg führte, war jetzt in eine ungemähte Wiese verwandelt, auf der ein gekoppeltes Pferd weidete. Die Hunde fingen schon zu bellen an, verstummten aber und wedelten mit den buschigen Schwänzen, als sie Anton erkannten. Die Leute liefen aus den Gesindegebäuden heraus und umringten den jungen Herrn mit lauten freudigen Ausrufen. Nur mit Mühe konnte er sich durch die dienstfertige Schar hindurchdrängen und die morsche Freitreppe hinauflaufen. Im Flur empfing ihn Jegorowna, die weinend ihren einstigen Pflegling umarmte. –»Guten Tag, guten Tag, Kinderfrau,« wiederholte er, die gute Alte an sein Herz drückend: »Wie geht es Väterchen, wo ist er? Was macht er?« – In diesem Augenblick trat ein großgewachsener, blasser und hagerer Greis, in Schlafrock und Nachtmütze, mit Mühe die Beine bewegend, in den Saal. – »Wo ist denn Wolodjka?« fragte er mit schwacher Stimme, und Wladimir umarmte voller Inbrunst seinen Vater. Die Freude hatte den Kranken zu stark erschüttert: er wurde plötzlich schwach, seine Beine knickten ein, und er wäre wohl hingefallen, wenn sein Sohn ihn nicht gestützt hätte. »Warum bist du vom Bett aufgestanden,« sagte ihm Jegorowna: »Er kann nicht mal stehen, will aber immer hin, wo die anderen Menschen sind.« Man trug den Alten ins Schlafzimmer. Er wollte mit dem Sohne sprechen, aber seine Gedanken gerieten durcheinander, und seine Worte hatten keinen Zusammenhang. Er verstummte und versank in einen Schlummer. Der Zustand des Vaters hatte Wladimir erschüttert. Er folgte ihm in sein Schlafzimmer und bat, ihn mit seinem Vater allein zu lassen. Das Hausgesinde gehorchte; alle wandten sich nun Grischa zu und führten ihn in die Gesindestube, wo man ihn erst ordentlich mit Fragen und Begrüßungen quälte und dann auf ländliche Weise mit größter Gastfreundschaft bewirtete.