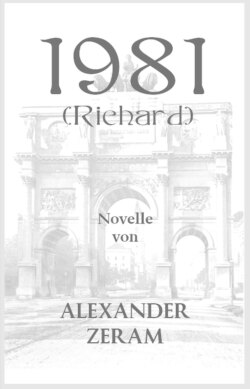Читать книгу 1981 - Richard - Alexander Zeram - Страница 4
1. Mônsieur Richard
Оглавление›… sind die Geiseln nach vierhundertvierundvierzig Tagen Gefangenschaft endlich freigelassen worden. Voraussichtlich wird …‹
»Gott sei Dank!«, rief Johannes Eckstein erleichtert aus und unterbrach damit zum ersten Mal in seinem Leben den Nachrichtensprecher, dem er bisher immer –zumindest bis zur Durchgabe der Wetterprognose– aufmerksam und schweigend zugehört hatte. »Aber das wurde wirklich langsam Zeit!«, fügte er noch hinzu und bekräftigte diese Ansicht vor seiner Gattin mit heftigem Kopfnicken.
»Ja … ich hab’ schon geglaubt, dass wieder was dazwischen kommt«, bemerkte sie. »Du hast ganz recht … es ist langsam Zeit!«
Ein letztes Schlückchen Kaffee und dann erhob sie sich vom Frühstückstisch.
Johannes sah ihr enttäuscht nach. Gerade jetzt hätte er sich gerne ein wenig mit ihr über den glücklichen Ausgang der sogenannten ›Geiselaffäre‹ unterhalten. Immerhin bedachte er, dass Elise sich politisch nie engagiert hatte und da niemand anderer anwesend war, wandte er sich schließlich dem Sohn zu, der vor dem mittleren Wohnzimmerfenster in einem wuchtigen Sessel lungerte.
»Das hätten die Amerikaner früher haben können, nicht wahr?«, fragte er – ohne Antwort zu erhalten. Der junge Mann schien völlig versunken in den wunderbaren Ausblick, den man von hier aus auf den zum Haus gehörigen Park hatte. »Die eingefrorenen Milliarden sind ja jetzt doch losgelöst worden. – Man hat auf die Forderungen des Iran eingehen müssen – zum größten Teil jedenfalls. Bin gespannt, ob man diesen –vielleicht nicht ganz unzweifelhaften– Erfolg bereits dem neuen Präsidenten zuschreiben wird. Was meinst Du, Richard?«
Richard reagierte nicht. Er mochte den sanften Fall der Schneeflocken studieren oder eine Krähe beobachten, die auf dem erst vor wenigen Minuten frei geschippten Weg zur Garage nach Futter suchte.
»Hörst Du mir eigentlich zu?« Johannes hatte sich erhoben. Jetzt stand er vor seinem Sohn.
Der wandte sich etwas herum und sah den Vater verständnislos an. »Hmm? – Hattest Du etwas gesagt, Papa?«
»Ich … nicht der Rede wert.« Johannes resignierte und verließ dann ziemlich plötzlich den Raum. Richard sah ihm nicht einmal nach. Er vertiefte sich weiter in den Anblick des wunderbaren, verschneiten Parks, den er liebte und den er besser kannte als die Zimmer des Elternhauses.
Etwas später kam Elise ins Wohnzimmer zurück. Der aufgebrachte Gatte hatte ihr zu verstehen gegeben, dass er die Interessenlosigkeit Richards einfach nicht mehr länger billigen könne.
»Richard …?«
Der drehte sich nochmals träge zur Seite.
»Interessiert Dich denn eigentlich gar nichts von alle dem, was in der Welt vorgeht?«, fragte sie.
»Wie? – Was geht denn vor, Mama?«
»Die zweiundfünfzig Geiseln, die jetzt endlich freigelassen worden sind. Das ist doch ein Ereignis!«
»Ja … wahrscheinlich«, murmelte Richard. »Wahrscheinlich … ich … aber ich verstehe ja nichts von der Politik.« Und so wandte er sich wieder dem Fenster zu – dem geliebten Park im frühwinterlichen Weiß.
Elise nahm Platz am Frühstückstisch und betrachtete ihn sorgenvoll.
Richard – ihr einziges Kind … wie fernab von ihr er lebte. Da saß er in seinem Hausmantel, den er sich nach einem Katalog-Muster aus dem Jahr 1890 schneidern hatte lassen, und starrte hinaus auf die Parkanlage. Versunken, fern … fernab von allen anderen Menschen, seinen Eltern, dem Hauspersonal … allen. Wenn sie sich Mühe gab, vermochte sie das Kratzen einer Schneeschaufel zu vernehmen. Franz, der Gärtner, hatte schon zeitig damit begonnen, die Spazierwege im Park wieder freizulegen. Richard wollte es so, denn nur selten ließ er einen Tag verstreichen, ohne im Park spazieren gegangen zu sein.
»Musst Du heute noch zur Vorlesung?«, erkundigte sich Elise einige Zeit später, als man im Radio gerade ein Morgenkonzert angekündigt hatte.
»Hmm?« Auch diesmal schien Richard nicht zu wissen, was man von ihm wünschte.
»Ach … Du träumst auch den ganzen Tag lang.« Elise seufzte. »Ich weiß nicht, woran Du fortwährend denken magst, aber zumindest solltest Du Antwort geben, wenn man Dich etwas fragt! – Musst Du heute noch zur Vorlesung?«
»Ja … jetzt dann«, erwiderte Richard.
»Dann will ich Max Bescheid sagen. Vielleicht springt der Wagen nicht sofort an.«
»Es war nicht kalt heute Nacht!«
»Ich habe gefröstelt!«
»Es war … ein wenig frisch.«
»Hmm!« Elise vollführte eine hilflose Geste und wandte sich ab. Es gab noch viel zu tun an diesem Morgen. Johannes begegnete ihr im Flur – bereits im Mantel.
»Ich komm’ erst gegen fünf, mein Schatz! – Bollhorst könnte mich aber auch noch länger beanspruchen. Sollte es später werden, dann rufe ich Dich an.«
»Gut.« Sie bot ihm die Lippen zum Kuss. »Geht’s um den Verkauf dieses Grundstückes in Gauting?«
»Eben darum … und mir graut davor. Der Eigentümer ist ein störrischer Kerl. Er verlangt einen Idiotenpreis. Aber wir müssen den Grund bekommen. Das wäre das letzte Steinchen in unserem Mosaik.« Er küsste sie und eilte davon.
Elise teilte der Köchin mit, dass sie zum Mittagessen zurück sein werde, und begab sich dann hinauf in den Oberstock. Umgekleidet erschien sie kurz darauf wieder unten im Wohnzimmer. Richard hatte seinen Sessel noch nicht verlassen. Unverändert fand sie ihn – träumend, in Gedanken versunken und weltentrückt.
»Richard … sieh zu, dass Du Dich richtest. Sonst verpasst Du wieder die Vorlesung.«
»Ja … ich ziehe mich in fünf Minuten um«, murmelte der.
»Bis später.« Sie beugte sich zu ihm hinab und küsste ihn auf die Stirne. Sein zweiflerischer Blick verfolgte sie aus dem Zimmer.
›Wie seltsam dieser Engel da draußen wirkt!‹, dachte sich Richard, als er endlich ungestört war. ›Die Schneehaube ist ihm über Nacht gewachsen und sie hat sein Aussehen völlig verändert. Er ist ein Krieger geworden … ein Krieger mit Helm … und doch hält er die Äolsharfe in den Händen. Seltsam, wie ein bisschen Schnee eine Statue verändern kann.‹
Die Nacht hindurch hatte es wenig geschneit, aber im Park machte sich jeder Zentimeter Neuschnee bemerkbar. Dort drüben beim Swimmingpool war ein Strauch endgültig im aufgetürmten Schnee verschwunden. Franz hatte den Weg, der an diesem Strauch vorüberführte, eben freigeschaufelt. Eine letzte Schippe musste das Gewächs zugedeckt haben – gestern waren noch einige Spitzen der obersten Zweige zu sehen gewesen.
* * *
Der Chauffeur Max erwartete den Sohn des Hausherrn bereits. Er lehnte an der Garagenwand, vor der die repräsentative Limousine des Hausherrn bereits vorgewärmt parkte. Aus seiner gebogenen Pfeife stieg dicker Rauch, auf der dünnen Blende seiner Schirmmütze schmolzen Schneeflocken.
»Guten Morgen, Herr Richard.«
»Bon jour, Max.« Richard nickte dem freundlich lächelnden Mann kurz zu, warf seine Aktentasche auf den Rücksitz und blieb dann vor der offenen Wagentüre stehen.
»Was vergessen, Herr Richard?«, forschte der Chauffeur.
»N … nein! – Ich habe nur eben daran gedacht, wie schön es wäre, jetzt mit einer Kutsche in die Stadt zu fahren.«
»Bei dem Wetter?«, empörte sich Max. »A mei … da hätten S’ keine Freud’, Herr Richard!«
»Es wäre wunderbar!«, entgegnete der. »Und doch … die Autos würden mich stören. Auf den Straßen ist Schneematsch, der Verkehr stockt … nein, die Vorstellung alleine ist schön – die Wirklichkeit verträgt sich nicht damit.«
»Das mein’ ich auch«, bekräftigte Max mit einem kurzen Kopfnicken, nahm seinen Platz ein und startete den Motor. Richard glitt auf den Rücksitz, schob die Aktentasche etwas zur Seite und zog die Türe zu – etwas nachlässig wohl.
»Die müssen S’ fester zuzieh’n, Herr Richard!«, mahnte der Chauffeur. »Jetzt ist sie ja bloß ang’lehnt.«
»Hmm?« Richard gab sich kaum Mühe, das Schloss zum Zuschnappen zu bringen. Kraftlos zog er einige Male kurz am Türgriff. Brummelnd stieg Max wieder aus, eilte um den Wagen herum, riss den Schlag auf und schlug ihn wütend zu.
»Max … Sie sind heute schlecht gelaunt!«, stellte Richard fest, als sie bereits eine Weile fuhren.
»So? – Na, ich muss schon ehrlich sagen, Herr Richard, dass man bei Ihnen die Geduld verlieren kann. Ihrem Herrn Vater hab’ ich’s auch schon g’sagt!«
»Aber – was habe ich denn getan?«
»Nichts … nichts ham S’ ’tan. Eben deswegen ja! – Ihr Herr Papa sagt’s auch, dass Sie zu viel träumen. Sie sind ja gar nicht richtig da … mit den Gedanken.«
»Ach so … ja.« Richard schmunzelte. »Das hat mir Papa selbst schon hin und wieder vorgehalten. Ich träume zu viel! – Hmm … fällt mir nicht auf.«
Max atmete geräuschvoll ein und konzentrierte sich auf den Straßenverkehr, um sich nicht zu einer weiteren Äußerung hinreißen zu lassen. Man hatte es schon schwer mit diesem jungen Mann.
Vierundzwanzig Jahre lang kannte er ihn jetzt – von Geburt an fast. Er hatte seinen Dienst bei den Ecksteins angetreten, als der kleine Richard gerade ein halbes Jahr alt gewesen war. Und mit welchen Hoffnungen hatten ihn seine Eltern aufgezogen. Ein prächtiger Kerl, der kleine Richard … immer wieder hatte man es ihnen versichert. ›Ein aufgeweckter Bursche, aus dem einmal etwas werden wird‹.
Man hatte es damals nicht für nötig gehalten, des Kleinen Zukunft näher zu bestimmen.
Er war ›was‹ geworden: ein weltverlorener Träumer, der an der Universität Philosophie studierte und am Konservatorium als Pianist glänzte: Richard Eckstein … Sohn des bekannten Maklers Johannes, dessen Position im gesellschaftlichen Leben unangezweifelt war. Ein Mann von Genie – ein Finanzexperte und zudem ein großer Kenner der Künste. In der ganzen Stadt genoss er höchstes Ansehen – bei Geschäftsleuten ebenso wie in den Kreisen der Musiker, Literaten und Maler. Überall sah man ihn gerne, gab viel auf sein Urteil und sein Wohlwollen.
Ein mächtiger Mann – ein schmächtiger Sohn!
Für den Chauffeur Max blieb es unverständlich, wie der Sohn eines Johannes Eckstein so hatte werden können. Dabei war diese Entwicklung, die Richard genommen hatte, kaum abzusehen gewesen. Ein paar seltsame Vorlieben als ausgehender Teen, dieselben Vorlieben als angehender Twen – Musik, Bücher, ausgewählte Kleidung, sorgfältig gepflegte Erscheinung – ein durchaus attraktives Äußeres – Versunkenheit, Melancholie … Richards Begeisterung für die französische Sprache, die er schließlich an gewissen Tagen zu der seinen gemacht zu haben schien … vertiefte Versunkenheit, Entrücktheit – ein Werdegang, der niemandem alarmierend erschienen war und jetzt an manchen Tagen doch Bestürzung auslösen konnte.
Richard Eckstein lebte sein eigenes, seltsames Leben inmitten dieser Millionenstadt, im Haus seines wohlhabenden Vaters, der die Geschäftsleute der halben Welt kannte, sich politisch engagierte und kein wichtiges Tagesereignis achtlos an sich vorüberziehen ließ. Es war dies ein Leben in einer anderen Zeit – hineingesetzt ins letzte Viertel dieses Zwanzigsten Jahrhunderts. Als sie die Ludwigstraße hinauffuhren, bemerkte Richard nach vorne gebeugt:
»Damals hätte ich bei Josef Rheinberger studieren können!«
Max zuckte nur mit den Schultern. Er kannte das bereits. Hin und wieder erinnerte sich Richard an diese Möglichkeit – wenn sie an der Rheinbergerstraße vorüberfuhren.
»Das Haus hatte früher eine kleine Orgel hinten in der Kapelle. Haben Sie gewusst, dass wir im Park eine Kapelle gehabt haben?«
»Ja …« Max überlegte sich seine Antwort, doch fiel ihm nichts ein. »Ja.«
»Sie war im siebzehnten Jahrhundert errichtet worden und ist dann einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Sie muss sehr schön gewesen sein. In der Bibliothek haben wir einen alten Stich, der die Kapelle im Park zeigt. Sie hatte eine hohe Kuppel mit einem winzigen Kreuz.«
»Hmm … so, da sind wir schon! – Hoffentlich langweilt man Sie nicht gar zu sehr, Herr Richard.«
Max hatte den Wagen vor dem Haupteingang der Universität angehalten. Diesmal wurde von ihm erwartet, dass er Richard den Schlag öffnete. Zuhause vor der Garage verzichtete man auf derartige Aufmerksamkeiten. Man lebte ja schließlich nicht mehr im neunzehnten Jahrhundert, da Herr und Diener im denkbar unpersönlichsten Verhältnis zueinandergestanden haben mochten. Max verstand sich mit seiner Herrschaft ausgezeichnet – er gehörte sozusagen zur Familie, und den Heiligen Abend verlebte er ebenso in Gemeinsamkeit mit den Ecksteins wie Geburtstagsfeste der Familienmitglieder. ›Der alte Max‹ – auch Besucher hatten sich längst an den Sonderstatus dieses Mannes gewöhnt.
Richard hatte sich möglicherweise noch nicht daran gewöhnt – aber er lebte ja im neunzehnten Jahrhundert. Daher mochte man es ihm verzeihen! Er entstieg dem Wagen, klemmte die Aktentasche unter den Arm und machte sich davon.
Ein Schneeschauer ging nieder – Nässe schlug dem Studenten ins Gesicht.
Vor dem Portal angelangt, wandte sich Richard um.
»Um eins, Max!«, rief er zum Wagen zurück. Der Chauffeur nickte nur.
* * *
»Ah, Mônsieur Richard!«
So wurde er von einem Kollegen begrüßt, mit dem er auf der Treppe zum ersten Stock zusammentraf.
»Grüß’ Dich, Josef.«
»Tolles Wetter heute wieder, heh?«
»Ja, es ist wunderbar!«
Josef lachte. Auf diese Antwort Richards hatte er es abgesehen gehabt.
»Mann, ich find’s beschissen! – Bin vorhin an der Ecke glatt ausgerutscht. Sauerei so was. Vorige Woche war noch gestreut.«
»Ja? – Ich weiß nicht.«
»Du gehst ja auch nie zu Fuß«, erinnerte ihn Josef.
Die Vorlesung über saß Richard konzentriert auf seinem Platz. Er wagte einen Einwand und wies auf eine von Kierkegaard aufgestellte These hin, mit der sich der Professor gerne beschäftigte. Die allgemeine Diskussion brachte dann allerdings etwas zu viel Schwung in den Saal, und der Nebenmann Richards nützte die Gelegenheit, um sich mit einem Mädchen für den Nachmittag zu verabreden.
»Bei so ’nem Wetter müsste man doch was zur Aufheiterung des Gemüts tun, wie? – Hör mal zu, Sabine … ich hab da ’ne kleine Kneipe ausfindig gemacht. Da gibt’s ganz tollen Glühwein. Haste Lust?«
»Den Glühwein kenn’ ich, Don Juan!«, spöttelte das Mädchen.
»Ah, geh’ zu … das ist ganz ohne Hintergedanken, Du! – Will mich mal mit Dir unterhalten. Oder bin ich Dir sooo unsympathisch?«
»Du bist mir zu direkt, Sepp!«, erklärte Sabine rundheraus. Richard wandte sich zur Seite und lugte seinem Nebenmann über die Schulter. Sabine … er sah sie zum ersten Mal. Oder vielleicht hatte er sie schon öfter gesehen. – Er wusste es nicht mehr. In ihrem verlotterten Aufzug fiel sie ihm jedenfalls auf.
›Wie kann man sich nur so unmöglich kleiden!‹, dachte er sich. ›Diese verwaschenen Jeans und diese Jacke. Schon die Farben harmonieren überhaupt nicht, und dann … wozu behält sie denn die Pelzjacke hier im Saal an.‹
Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder nach vorne, wo der Professor sein Thema weiter ausführte. Ein junger Mann in der ersten Reihe attackierte ihn hart – Richard war nicht einverstanden damit und übernahm die Verteidigung des Gelehrten.
Etwas später wurde Richard wieder durch das Gespräch, abgelenkt, welches Josef und Sabine führten. Es ging noch immer um den Glühwein. Aus der Reihe hinter ihnen bemerkte jemand, dass ›Sepps Glühwein‹ unübertrefflich sei.
»Kann ich Dir wärmstens empfehlen! – Aber, sieh zu, dass Du ihn nicht auf seiner Bude serviert bekommst. Er hat ’nen Kohleofen, und bis der mal auf Touren ist, biste längst erfroren … trotz Glühwein!«
»Na, Du musst ’s ja wissen!« Josef resignierte und ließ von der ›Neuen‹ ab.
»Sowieso Scheiße! – Hab’ nur noch zehn Mark. Wenn meine Alten nicht bald was schicken, dann könnt ihr mich mal zum Glühwein einladen!«
Einige lachten auf.
»Dann bedanke ich mich mal herzlichst!«, erklärte Sabine.
»Geh’ lieber mit Monsieur Richard!«, schlug ein anderer vor. »In seinem Schloss wirste köstlich bewirtet und währenddessen kannst Du Dir seine Ausführungen anhören. Sehr interessant. Dabei lernste noch was.«
Richard errötete stark. Dass ihn seine Studienkollegen unablässig hänselten, störte ihn längst nicht mehr, aber der Blick Sabines verwirrte ihn und ihr helles Lachen behagte ihm gar nicht.
»Na, nimm’ die Gelegenheit wahr, alter Junge!« Josef klopfte ihm auf die Schulter. »Oder willste lieber mir ’nen Glühwein spendieren. Ich sag’ nicht Nein.«
Richard biss die Zähne aufeinander und starrte nach vorne.
›Gestern habe ich die Noten zur f-moll Sonate von Brahms entdeckt. Wenn ich bedenke, dass ich kaum die ersten Takte des Kopfsatzes spielen konnte und jetzt hier meine Zeit vertue …!‹
Endlich endete die Vorlesung. Der Saal leerte sich rasch und Richard ging neben Josef den Gang entlang.
»Was machste jetzt?«, wollte der wissen.
»Mein Chauffeur kommt um eins. Ich habe mich verrechnet – dachte, dass ich nicht lange auf ihn warten würde müssen.«
»Und?«
»Ich werde mich ins Café setzen … wie immer, wenn ich hier festgenagelt bin«, erwiderte Richard.
»Na – dann viel Spaß. Ich frag’ Dich gar nicht erst, ob Du mit zu Jim kommst. – Bis morgen!«
Richard verließ das Gebäude alleine. Auf den Straßen lag Schneematsch, und es hatte zu regnen begonnen. Angeekelt klappte er den Kragen seines Mantels hoch und eilte hinüber in das kleine Café, welches er aufzusuchen pflegte, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Im Sommer spazierte er manchmal die Leopoldstraße hinauf und hinunter – bei diesem Wetter ließ sich damit die Zeit nicht gut totschlagen.
Sein Platz in der Ecke bei dem großen Gummibaum war noch unbesetzt. Er bestellte sich einen Kaffee mit Cognac und steckte sich eine Zigarette an.
Da saß er also wieder einmal und musste sich eine knappe Stunde in dieser nicht sehr anheimelnden Atmosphäre zu vertrösten suchen. In seiner Aktentasche fand er einen Band mit Gedichten Heinrich Heines, dem er sich jetzt widmete.
»Du … haste mal Feuer für mich?«, fragte ihn schließlich jemand, und als er von seinem Buch aufsah, lächelte ihn ein hübsches Gesicht an. Er hatte gar nicht bemerkt, dass zwei Mädchen an seinem Tisch Platz genommen hatten – und er wunderte sich auch nicht darüber. Um die Mittagszeit wurde es in diesem Café regelmäßig sehr voll und da blieb niemand alleine an einem Tisch. Jeder Stuhl wurde gebraucht. Die Serviererinnen flitzten herum, es war laut. Unterhaltungen, Gläsergeklirr, Tellergeschepper … Richard entnahm der kleinen Brusttasche seines Gilets das goldene Feuerzeug, mit dem sein Großvater sich einst seine Zigarren angezündet hatte und befriedigte den Wunsch des Mädchens. Rasch vertiefte er sich anschließend wieder in Heines Verse. Die Atmosphäre des Studenten-Cafés wurde ihm mit jedem Mal, da er in sie eintauchte, mehr zuwider.
»Biste nicht einer von den Philosophen?«, erkundigte sich die Raucherin jetzt bei ihm. Richard ließ sein Buch sinken und musste sich erst vom Eindruck lösen, den ein Gedicht auf ihn gemacht hatte.
»Ich …«
»Na klar … Du kennst bestimmt einen Josef! – Sepp vielmehr.«
»Ja … einer meiner Kommilitonen heißt zumindest so«, gab er zur Auskunft.
Das Mädchen setzte sich zurecht und es wirkte, als wollte sie ihn in ein längeres Gespräch ziehen. Eiligst senkte er den Blick wieder auf die Seiten des Buches und las angestrengt weiter.
Achselzuckend wandte sich die Raucherin ihrer Freundin zu.
»Trübe Tasse!«, murmelte die. »Hab’ ich Dir gleich gesagt.«
»Na ja.«
Die beiden Mädchen unterhielten sich jetzt über einen Film, der in einem kleinen Kino in Schwabing gegeben wurde, und ihre aufdringlich hellen Stimmen störten Richard.
›Damals hätten sich junge Damen dezenter unterhalten … abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich schon schlecht angesehen gewesen wären, sich an den Tisch eines fremden Mannes zu setzen. Man hätte sie für leichtlebig gehalten. Das Café war den Männern vorbehalten … oder doch den Paaren. Ach …!‹
Er klappte den Band Heine zu und lehnte sich zurück.
Erstaunt stellte er fest, dass ihn die beiden Mädchen musterten. Das war ihm äußerst unangenehm. Er vertrug es schon nicht, wenn ihn Männer auffällig ansahen … wenn es dann noch Frauen waren …! – Eine Hitzewelle überflog ihn.
Kurz darauf nahm er seinen Mantel vom Garderobenhaken. Dabei musste er mit anhören, wie die Raucherin ihrer Freundin erklärte:
»Aber toll angezogen. So was siehste heut’ kaum mehr. Erinnert mich richtig an so ’nen Film, den ich mal gesehen hab’.«
»Mich hat der Typ eher an Fasching erinnert. Vielleicht meint er, dass er Kaiser Wilhelm ist … oder so ein Adjutant vielleicht.«
Ihr böses Lachen vertrieb Richard endgültig.
Seine Kleidung – schon die Eltern hatten ihm genug Szenen gemacht.
›So läuft heutzutage kein Mensch mehr herum, Richard! Wenn Du in diesem Aufzug auf die Straße gehst, dann wird man über Dich lachen … und über mich dazu!‹
›Zumindest in der Stadt solltest Du Dich kleiden wie alle! – Gut, Du kannst Dich ja von unserem Schneider einkleiden lassen … aber doch nicht in solche Kostüme! – Das ist doch Clownerie!‹
Er kannte das – die Studienkollegen spielten tagtäglich darauf an. Nicht umsonst nannten sie ihn spöttisch ›Mônsieur Richard‹ – mit einem besonders intensiv betonten ›O‹.
Pünktlich um ein Uhr fuhr die dunkelgrüne Limousine mit Max am Steuer vor.
Richard atmete erleichtert auf, riss den Passanten neben sich fast mit, als er beim Umschlagen der Ampel losstürmte, und saß wenige Sekunden später erlöst lächelnd auf dem Rücksitz des Wagens.
»Wie war die Vorlesung, Herr Richard?«, erkundigte sich Max gewohnheitsmäßig.
»Langweilig, Max! – Ich frage mich manchmal, wozu ich das eigentlich noch tue.«
»Na, irgendwas müssen Sie doch tun!«
»Aber ich … ich bin vollauf beschäftigt, Max.«
»Mit der Musik … ja! – Aber Sie wollen ja gar nicht auftreten … Konzerte geben und so.«
»Wie? – Konzerte? – Dort sitzt man in Jeans und Pullovern im Saal, kaut Kaugummi und denkt an die Stereoanlage zuhause, auf der man gebotene Werke schon in viel besserer Interpretation abgehört hat, wie? – Nein, danke! – Bevor ich die alten Geister entwürdige, studiere ich lieber noch.«
Max reagierte nicht darauf. Er konzentrierte sich auf den Verkehr.
Den Nachmittag über war Richard im Park. Er hatte seinen langen Gehrock übergeworfen und stocherte mit dem Spazierstock seines Großvaters im Schnee herum. Hin und wieder zückte er einen Notizblock und trug ein, was ihm aufgefallen war.
»Aha!«, rief er aus, als er die Ursache für die Neigung einer kleinen Statuette herausgefunden hatte, die ihm am Vortag aufgefallen war. Unter dem Sockel mussten Maulwürfe das Erdreich gelockert haben – daneben hatte er jedenfalls einige Maulwurfshügel entdeckt.
* * *
»Was hast Du eigentlich den Nachmittag über gemacht?«, erkundigte sich Richards Mutter, als er mit ihr zusammen um halb fünf Kaffee im kleinen Salon trank.
»Ich war im Park.«
»Und?«
»Oh, mir ist aufgefallen, dass die Maulwürfe ziemlich rege sind. Das muss am Temperaturanstieg liegen. Die denken vielleicht, dass der Frühling schon angebrochen ist.«
»Richard … Richard … damit hast Du den Nachmittag verbracht?«
»Nicht nur, Mama! – Ich habe mich vorhin hinten beim Springbrunnen auf die Bank gesetzt und mich in eine Vision hineingelebt. Es war großartig. Ich sah das Haus in seiner vollen Pracht vor mir … abends. Es dämmerte und alle Fenster waren erleuchtet. Eine ausgelassene Abendgesellschaft tollte im Park herum. Meine Geburtstagsfeier! – Wir hatten uns einen dieser großen Schlitten beschafft und Max kutschierte uns durch den Park. Einmal wären wir beinahe in den Swimmingpool hineingerutscht … und das holte mich dann wieder zurück. Damals hätte es diesen Swimmingpool nicht gegeben!«
Elise sank in sich zusammen.
»Richard …!« Sie hatte sich erst nach geraumer Zeit wieder gefasst und sie zwang sich, ganz ruhig zu sprechen. »Wie denkst Du Dir das eigentlich?«
»Was, Mama?«
»Richard … Du bist jetzt fast fünfundzwanzig Jahre alt. Du hast keine Freunde … keinen Umgang. Und … was mich besonders betrübt, mein Kind ….. Du hast keine Freundin.«
»Ähm … ja … ich …«
»Richard, wie soll denn das mit Dir weitergehen. Du lebst in einer Welt, die mit der unseren nicht vereinbar ist. Alles, was Du bewunderst, ist seit hundert Jahren nicht mehr … alle Leute, die Dich interessieren, leben nicht mehr. So wie Du Dir Deine Mitmenschen wünschst, gibt es niemanden. Du musst Dich damit abfinden, dass wir 1981 schreiben, mein Kind! – Überlege Dir doch wenigstens einmal, was Du später tun willst. Gott … Du weißt genau, dass es uns –deinem Vater und mir– nicht darum geht, wie viel Du einmal verdienen wirst. Wenn es nach uns ginge, könntest Du Dein Leben lang Deinen Hobbys nachgehen und nie auch nur eine Mark verdienen müssen, um Dich zu ernähren. Aber der Beruf … man braucht einen Beruf in unserer Zeit. Früher einmal … ach, ja, da gab es wohl Sprösslinge aus reichem Haus, die nichts weiter taten, als aufs Erben zu warten. Aber diese Zeit ist vorüber, Richard! – Du brauchst einen Beruf, Du brauchst ihn wirklich –schon deshalb, weil Du durch ihn unter Menschen kommen wirst, mit denen Du Dich zu beschäftigen hast. Von Berufs wegen schon. Heute kannst Du Leute, die Dich nicht interessieren, links liegen lassen. Einmal im Beruf, musst Du Dich auch mit diesen befassen, denn sie werden für Dich unter Umständen Geschäftspartner sein, und wenn es so weit gekommen ist, dass Du Dich nicht mehr gegen Deine Mitmenschen verschließt, dann wirst Du auch begreifen, dass unsere Zeit nicht schlechter ist, als jene, von der Du träumst. Es gibt heute sicherlich genauso viele wertvolle Menschen wie damals. Du musst nur die Augen aufmachen, dann siehst Du sie!«
»Aber …«
»Ja?« Elise sah ihren Sohn erwartungsvoll an – erwartungsvoll … und flehentlich. Oh, wie bereute sie, dass sie sich nie den sonderbaren Wünschen ihres kleinen Richard widersetzt hatte. Wie sehr tadelte sie sich selbst und ihren Mann, dass sie der Entwicklung Richards nie die Weichen gestellt hatten.
»Aber … ich will diese Leute doch gar nicht sehen, Mama! Ich will sie auch nicht kennenlernen!«
Für Elise brach alles zusammen. Nein, es gab kaum Hoffnung, dass sich Richard je ändern würde. Er hätte tatsächlich Menschen finden müssen, die sich in dieser Zeit und dieser Welt von heute ebenso wenig zurechtfanden wie er und deren Gedanken sich mit den seinen im vorigen Jahrhundert treffen würden.
Am Abend bespielte Richard den kostbaren Flügel im Musikzimmer. Die f-moll Sonate von Brahms fesselte ihn nicht lange. Gegen neun Uhr hatte er späte Werke von Liszt in Angriff genommen – gegen zehn Uhr improvisierte er nur noch und gegen elf Uhr saß er träumend auf dem Drehhocker vor dem Flügel und steigerte sich in eine Vision hinein.
›Ich bin der gefeierte Pianist Richard Eckstein. Eben habe ich unter Nikisch das zweite Klavierkonzert von Brahms aufgeführt. Die Berliner Philharmoniker spielten großartig, und im Publikum wurde es schon während des Kopfsatzes unruhig. Noch vor dem Andante brach der Begeisterungssturm los. Drei Tage später bittet mich der Kaiser zu sich. Ich spiele ihm einen Walzer von Chopin und eine unbekannte Sonate vor, die ihn zu großem Lob hinreißt. Er verlangt den Komponisten der Sonate zu erfahren – und ich sage, dass ich es selbst bin!‹
Währenddessen plagten sich seine Eltern mit dem Problem dieses Tages. War es ihnen schon länger aufgefallen, wie weltfremd Richards Dasein sich entwickelt hatte – erst heute schien es ihnen zu dämmern, in welchem Maße sie selbst als die Erzieher dieses jungen Menschen versagt hatten.
»Er muss sich in diese Traumwelt geflüchtet haben«, fand Johannes. »Aber wovor? – Was hätte ihn denn dazu treiben sollen? – Hier im Haus war er ein junger König und in der Stadt brauchte er sich nie vor jemandem zu fürchten. Er sieht blendend aus, ist intelligent … durch uns wohlhabend … was kann es nur sein?«
»Vielleicht hat er einmal etwas erlebt, was ihm sehr nahe gegangen ist. Er mag uns nie was davon erzählt haben«, mutmaßte Elise.
»Wie könnte denn so was geschehen sein? Nein, mein Schatz, das glaube ich einfach nicht.«
»Aber … warum gibt er sich dann so desinteressiert? Ich sehe ihn manchmal im Park und …«, Elise schluchzte auf, »… er spricht dann mit sich selbst. Er imitiert Stimmen, unterhält sich über irgendwas … mit sich selbst! Einmal hab’ ich ihn belauscht, da ging es um einen Börsenkrach!«
»Um einen … Börsenkrach?« Johannes schluckte schwer.
»Vorhin habe ich ihn beim Klavierspiel beobachtet. Er dirigierte … ja, Hans … er dirigierte vom Klavier aus. Und dann erhob er sich und schüttelte einer imaginären Persönlichkeit die Hände, verneigte sich … und wenn er noch geredet hätte … oh, das ist doch furchtbar, Hans! – Unser Sohn wird … verrückt!«
Johannes legte seinen Arm um ihre Schultern und zog sie näher an seine Seite. Durchs offene Fenster schlug ein kühler Nachtwind herein. Johannes ordnete die Kissen und legte sich wieder zurecht. »Wir wissen es schon lange, dass irgendwas mit Richard nicht stimmt, Elise. Aber … wir haben nie daran gedacht, etwas zu unternehmen. Aus irgendeinem Grund ist uns sein Verhalten heute besonders stark aufgefallen.« Johannes räusperte sich. »Wir … wir werden einen Psychiater aufsuchen!«, brachte er schließlich hervor.
»Einen Psychi…«
»Das hat nichts mit einem Irrenarzt zu tun. Ein …«
»Ich weiß ja, Hans«, unterbrach sie, »aber der Gedanke … es ist schrecklich. Und dabei … es ist unvermeidlich, oder?«
»Wenn er so weiter macht, dann … ja.«
»Aber wird er denn einen Psychiater akzeptieren?«, fragte sie nach einer Weile bedrückenden Schweigens. Dunkelheit umgab sie – das eheliche Schlafzimmer war kalt.
»Vorerst ist es noch gar keine Frage, ob er einen Psychiater konsultieren wird müssen«, erklärte Johannes. »Elise, wir werden zu einem gehen und uns einen Rat holen. Wir schildern Richard so, wie er ist, und geben möglichst viele Details. Dann kann sich der Arzt ein Bild machen und entscheiden, wie er vorgeht. Vielleicht können wir unserem Kind helfen – auch ohne direkte Mitwirkung eines Arztes. – Ich kenne da einen, der praktiziert nur noch sporadisch – ist schon ein älterer Mann, hat aber einen exzellenten Ruf … Dr. Frieser heißt er. Ich werde ihn morgen anrufen und mir einen Termin geben lassen. Dann gehen wir beide hin.«
»Oh, hoffentlich ist Richard nicht … wirklich krank.«
»Unsinn!«
Johannes küsste sie und wiederholte sein ›Unsinn!‹
Es war bedenklich – ihre Einsicht kam reichlich spät. Aber bisher hatten sie wohl beide noch immer gehofft, dass Richard eines Tages den Anschluss an seine Mitmenschen finden würde – vor allem an der Universität. Aus irgendeinem bestimmten Grund war es ihnen heute zu Bewusstsein gekommen, dass diese Chance mit jedem Tag abnahm. Vielleicht hatte es an Richards Reaktion auf die Freilassung der Geiseln im Iran gelegen, vielleicht an den Bemerkungen des Chauffeurs Max, der von Richards Abneigung gegen Konzerte berichtet hatte – vielleicht lag auch gar kein auffälliger Grund vor. Es war schwer zu sagen.
»Wir sollten mal irgendwohin fahren, wo es noch so etwas wie einen Hauch dieser guten alten Zeit gibt, Hans«, schlug Elise vor. »Monte Carlo vielleicht – oder … Venedig!«
»Damit er dort Leuten in Jeans begegnet und Touristen mit Fotoapparaten?«
Johannes schüttelte den Kopf. »Nein … ich möchte bald mit Dr. Frieser reden. Wenn wir jetzt etwas unternehmen, dann muss es ins Ziel treffen, … Elise. Viel zu spät haben wir erkannt, dass unser Sohn gefährdet ist … und eben aus diesem Grund sollte jetzt kein Fehler mehr gemacht werden.«
»Ja.«
»Elise …«
»Hm?«
»… wir haben versagt!«
Kopf an Kopf schliefen sie ein.
* * *
Richard hingegen war um Mitternacht herum noch hellwach. Er saß am Schreibtisch seines Arbeitszimmers und skizzierte eine kurze Geschichte, in die er sich zuvor hineingelebt hatte.
›Ich überwinde mich dann endlich, doch einmal ein Konzert zu geben und … es wird ein triumphaler Erfolg. Meine Kleidung, meine Eigenheiten … die Leute finden das plötzlich gar nicht mehr absonderlich. Ich gebe weitere Konzerte und meine Manie wird bekannt … berühmt … w e l t-berühmt.
Nach und nach werden alle meine Auftritte zu Galaabenden. Und eine Modewelle kommt auf – man nennt sie den ›Eckstein-Trend‹. Alles kleidet sich so wie ich. Sogar die Möbelhäuser ziehen mit. Journalisten besuchen mich hier und machen Fotos von unserem Haus. Die Einrichtung wird als Vorbild hergenommen – in einigen Jahren gibt es keinen Menschen mehr, der etwas auf sich hält und nicht so eingerichtet ist wie ich. Auf den Straßen verschwinden die Autos … nur Taxis, Feuerwehr, Krankenwagen und Busse bleiben. Kutschen erscheinen und das Bild der Städte wandelt sich. Es wird nicht mehr modern gebaut – nicht mehr mit Stahl, Beton und vielen Ecken – man baut, haha … altmodisch … oder vielmehr: ganz modern im Eckstein-Stil! Die alten Gebäude werden mit besonderer Sorgfalt restauriert, neuere umgebaut, mit Stuckwerk versehen. Das Jahr 2000 bricht an und vergessen sind all die Visionen vom Raumfahrtzeitalter, das von Computern und Maschinen beherrscht wird.‹
Schmunzelnd hielt er inne. Im Aschenbecher rauchte eine Zigarre – es war die Marke, die einst schon sein Großvater bevorzugt hatte. Sein Großvater … oh, er hätte ihn verstanden. Richard erinnerte sich an einen Tag in frühester Kindheit. Der Großvater hatte gegen die ›moderne Zeit‹ gewettert und sich wortreich –in kräftigen Ausdrücken obendrein– nach der ›guten alten Zeit‹ zurückgesehnt.
›Damals hat es noch keine Atombomben gegeben. Man heizte mit Kohle und war nicht abhängig von den Wüstenscheichs‹, sagte er sich und bedauerte, dass sein Großvater schon seit zehn Jahren nicht mehr lebte. Neunzigjährig war der Begründer des Ecksteinschen Vermögens gestorben. Mit ihm zusammen hätte Richard die Welt verändern wollen … in dem Sinne verändern … dass alles wieder so geworden wäre, wie einst … zu Großvaters Zeiten.
›Damals waren sogar die Weiber anders!‹, hatte Friedrich Eckstein einmal erklärt und Richard begriff es heute. Der Charme einer Frau … wo war er unter diesen pluderigen Pullovern und Blusen, unter unförmigen Hosen und unter in Neonfarben gefärbten, auftoupierten oder ausrasierten Haaren?
Richard hatte zahllose Romane gelesen, deren Handlung in ›jener Zeit‹ spielte. Oh, wie aufregend diese fiktiven Histörchen doch gewesen waren. Und um wie viel aufregender hätte die erlebte Wirklichkeit sein müssen. ›Ich bin ein bekannter Philosoph. Meine Frau beginnt mich nach zehn Jahren Ehe zu langweilen und ich nehme mir eine Geliebte. Sie ist die Frau eines jungen Arztes, dem ich einmal einen Dienst erwiesen habe. Sie fällt mir nicht leichthin zu … aber die Ränke, die wir schließlich schmieden, sind großartig. Ihr Gatte ist sehr eifersüchtig – verständlich bei ihrer Schönheit – und wir müssen uns vorsehen.‹
»Bah!« Richard warf die Schreibfeder über den Tisch – Tinte spritzte auf die Blätter, die er schon beschrieben hatte. »Das Leben in unserer Zeit ist langweilig.«