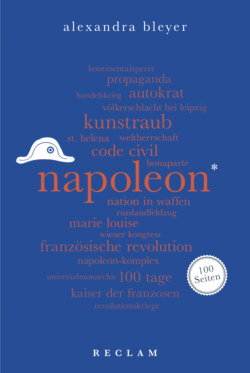Читать книгу Napoleon. 100 Seiten - Alexandra Bleyer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine nahezu unglaubliche Karriere
ОглавлениеEine Weltgeschichte ohne Napoleon? Für uns unvorstellbar. Doch Napoleon hätte genauso gut als Nebenfigur in einer Fußnote enden können. Was Geschichte von Mathematik unterscheidet und sie so spannend macht, ist, dass ihr Verlauf weder logisch noch vorhersehbar ist. 2 + 2 ergibt nicht zwingend 4. Persönlichkeiten, Entscheidungen und Zufälle prägen die Abfolge der Ereignisse. Betrachten wir ein paar Stationen in Napoleons Karriere, an denen er allzu leicht vom uns bekannten Lebenslauf hätte abweichen können.
Napoleons junges Herz schlug für sein Vaterland, und das war Korsika. Die Republik Genua trat die Insel 1768 an Frankreich ab; die Unabhängigkeitskämpfer unter Pasquale Paoli bekämpften die neuen Herren, wurden aber im Jahr darauf – Napoleons Geburtsjahr – vernichtend geschlagen. Von seinem Vater Charles Bonaparte (Carlo Buonaparte), zuvor ein entschiedener Anhänger Paolis, lernte Napoleon wohl eine wertvolle Lektion: Häng dein Fähnlein nach dem Wind! Der Advokat arrangierte sich mit den französischen Machthabern und erlangte für seine älteren Söhne königliche Stipendien. So gelangte Napoleon auf die Militärschule in Brienne und begann danach seine Karriere als Offizier in der Armee König Ludwigs XVI.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit! Napoleon begrüßte die Ideale der Französischen Revolution und wandelte sich zum Republikaner. Er wurde auf Korsika politisch aktiv, wobei er die Zukunft seiner Heimat in einer engen Anbindung an das revolutionäre Frankreich sah. Hingegen trat der aus dem Exil zurückgekehrte Paoli für mehr Unabhängigkeit ein. Mit Paoli wurden die Bonapartes nicht mehr warm. Der Rebellenführer verzieh dem mittlerweile bereits verstorbenen Charles den Verrat an der korsischen Sache nicht; dessen Söhnen misstraute er. Zu Recht? Lucien Bonaparte rühmte sich 1793 in einem Brief an seine älteren Brüder Joseph und Napoleon, er habe maßgeblich zum Beschluss des Konvents, Paoli zu verhaften, beigetragen. Nachdem dieser Brief Paoli in die Hände gefallen war, wurden die Bonapartes für vogelfrei erklärt und mussten fliehen. Was wäre wohl gewesen, wenn Napoleon seine Ziele auf Korsika erreicht und dem Festland den Rücken gekehrt hätte?
In Frankreich hatte sich inzwischen viel geändert. König Ludwig XVI. war im Januar 1793 geköpft worden und die radikalen Jakobiner unter der Führung von Maximilien de Robespierre errichteten ihre blutige Schreckensherrschaft (la Terreur). Napoleon war lange unerlaubt der Armee ferngeblieben, doch der Mangel an Offizieren kam ihm zugute und er wurde gern wieder aufgenommen. Zudem näherte er sich politisch den Jakobinern an und fand in Augustin Robespierre, dem jüngeren Bruder Maximiliens, einen Förderer. Militärisch bewährte er sich bei der Belagerung und Rückeroberung von Toulon; Ende des Jahres war er Brigadegeneral und durch Augustins Fürsprache erhielt er im März 1794 das Kommando über die Artillerie der Italienarmee.
Napoleon freute sich über seine steile Karriere – bis ihm das Schicksal einen Strich durch die Rechnung machte. Am 27. Juli 1794 (9. Thermidor nach dem Kalendarium der Revolutionäre) wurden die Jakobiner gestürzt und die Gebrüder Robespierre mit vielen anderen hingerichtet. Es fehlte nicht viel, und auch der verhaftete Napoleon hätte seinen Kopf verloren. Er wurde zwar freigelassen, aber seine militärische Karriere war auf Eis gelegt. Dies wäre beinahe das Ende der Geschichte gewesen.
Seit 1795 wurde Frankreich von einem fünfköpfigen Direktorium regiert, in dem Paul Vicomte de Barras eine führende Rolle spielte. Erneut schaffte es Napoleon, auf das richtige Pferd zu setzen. Er tat sich Anfang Oktober bei der Niederschlagung eines Aufstandes hervor und wurde als »Général Vendémiaire« gefeiert sowie zum Divisionsgeneral befördert. »Das Glück ist mir hold«, jubelte er. Privat fand er sein Glück mit der verwitweten Joséphine de Beauharnais, die sich als ehemalige Geliebte Barras’ in den besten Kreisen bewegte. Die beiden heirateten am 9. März 1796. Ob Barras Napoleon das begehrte Kommando über die Italienarmee als eine Art Hochzeitsgeschenk verschaffte?
Nach der Schlacht bei Lodi 1796 soll Napoleon angeblich erstmals der Gedanke gekommen sein, dass er »wohl auf der politischen Bühne eine ausschlaggebende Rolle spielen könnte«. Seine Erfolge als Feldherr verstand er propagandistisch auszuschlachten und erhöhte damit seinen Bekanntheitsgrad. Er fiel auch Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord auf, der im Juli 1797 vom Direktorium zum Außenminister ernannt worden war und nun schriftlich Kontakt mit Napoleon aufnahm. Der mit allen Wassern gewaschene Vollblutdiplomat und der siegreiche Feldherr – ein ideales Gespann, oder? Talleyrand wirkte maßgeblich an Napoleons Aufstieg mit und sah sich in den nächsten Jahren in der Rolle des weisen Mentors gegenüber dem Jüngeren. Vielleicht hoffte er, als Art graue Eminenz aus dem Hintergrund die Fäden zu ziehen und Napoleon steuern zu können.
Von seinen Siegen bestärkt, neigte Napoleon dazu, sich über Befehle des Direktoriums hinwegzusetzen. Talleyrand drängte ihn zu Friedensverhandlungen mit Österreich und formulierte Ziele wie die Festigung der Italienischen Republik und die Festlegung des Rhein als östliche Grenze Frankreichs; entgegen den Vorgaben des Direktoriums schloss Napoleon in seiner Rolle als General eigenmächtig den Frieden von Campo Formio, der den Ersten Koalitionskrieg beendete.
Die Direktoren waren irritiert und besorgt angesichts des Ehrgeizes, den der General an den Tag legte. Noch saßen sie am längeren Hebel, wie folgende von Johannes Willms beschriebene Szene verdeutlicht: Offensichtlich hatte Napoleon als General in Italien bisweilen mit seinem Rücktritt gedroht, um seinen Willen durchzusetzen. Nun nahm er in Paris an Sitzungen des Direktoriums teil und versuchte ebenfalls, die Richtung zu bestimmen. Direktor Jean François Reubell wies Napoleon darauf hin, dass er ihnen gar nichts zu befehlen hätte, woraufhin dieser impulsiv seinen Rücktritt verkündete. »Nur zu, General«, antwortete Reubell anders als erwartet, »hier haben Sie eine Feder! Das Direktorium erwartet Ihr Rücktrittsgesuch.« Wieder einmal war Napoleons Karriereende zum Greifen nah. Doch seine Worte waren schnell als leere Drohung entlarvt; er entschuldigte sich in aller Form. Die Direktoren waren dennoch froh, ihn in die Wüste schicken zu können. Doch die Distanz erwies sich für Napoleon als Vorteil. Während die Direktoren zunehmend unpopulär wurden, da sie als korrupt und unfähig galten, konnte sich Napoleon vor der exotischen Kulisse Ägyptens in Szene setzen.
Mit dem Direktorium war kein Staat (mehr) zu machen und kein Krieg zu gewinnen. Zu dieser Ansicht gelangte zumindest Emmanuel Joseph Sieyès, der mit der revolutionären Streitschrift Was ist der Dritte Stand? Berühmtheit erlangt hatte. Im Mai 1799 wurde er einer der fünf Direktoren – und arbeitete auf den Sturz des Direktoriums hin. Seiner Ansicht nach taugte die Verfassung von 1795 wenig, er wollte eine stärkere Exekutive. Um das zu erreichen, gab es nur einen Weg: einen Staatsstreich. Sieyès war ein kluger Kopf und wusste, dass ein Denker wie er zusätzlich ein Schwert benötigte; einen General, der ihn militärisch unterstützen konnte. Dachte Sieyès an Napoleon? Nein. Sein Wunschkandidat war Barthélemy Joubert, doch dieser fiel in der Schlacht; andere Generäle lehnten ab und so blieb Bonaparte übrig, der sich – über die innenpolitischen Vorgänge und Intrigen bestens informiert – aus Ägypten abgesetzt hatte.
Ein Mitverschwörer war Talleyrand. Vorsorglich reichte er im Juli 1799 seinen Rücktritt als Außenminister des Direktoriums ein. Nun musste er sämtliches diplomatisches Geschick aufbringen, um Napoleon und Sieyès – unterschiedlich wie Tag und Nacht – zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ebenfalls eingeweiht war Napoleons Bruder Lucien, der sich die Verschwörung als »Reformprojekt« schönredete. Parallel zu Napoleons militärischer Karriere war Lucien in der Innenpolitik aufgestiegen und saß 1799 als Präsident des »Rates der Fünfhundert« an einem Schalthebel.
Der Staatsstreich am 18./19. Brumaire 1799 (9./10. November) hatte zwei Stoßrichtungen: Einerseits mussten die Direktoren kaltgestellt werden, andererseits sollten die Abgeordneten der beiden Kammern, Ältestenrat und »Rat der Fünfhundert«, dazu gebracht werden, einer aus drei Konsuln bestehenden neuen provisorischen Exekutive zuzustimmen, um der Sache einen Anstrich von Legalität zu geben. Die Direktoren Sieyès und Roger Ducos verkündeten ihren Rücktritt. Napoleons ehemaliger Förderer Barras unterschrieb das bereits vorgefertigte Rücktrittsgesuch; die bedrohliche Truppenpräsenz in Paris sowie ein großzügiges Geldgeschenk dürften seine Entscheidung beflügelt haben. Da waren es nur noch zwei. Louis Jérôme Gohier und Jean Français Moulin wollten sich nicht so einfach geschlagen geben; auf Diskussionen ließen sich die Verschwörer nicht ein, die beiden wurden gefangen gesetzt. Das Direktorium gab es nun nicht mehr.
Dennoch wäre das Unternehmen beinahe gescheitert, was ausgerechnet Napoleons impulsiven Auftritten vor den Abgeordneten anzulasten ist. Unter dem Vorwand angeblich drohender Gefahr wurden die beiden Kammern ins Schloss von Saint-Cloud verlegt. Die Erfahrung der letzten Jahre mit Revolution und Terror ließen so manchen Volksvertreter jedoch misstrauisch werden, zumal sich dort auffällig viele Soldaten aufhielten. War da etwas im Busch? Gewohnt, auf dem Schlachtfeld schnelle Entscheidungen zu treffen, zeigte sich Napoleon von den Debatten entnervt. Um das Ganze zu beschleunigen, wollte er vor dem Ältestenrat eine Rede halten. Nur waren Abgeordnete keine Soldaten, wie er zu seinem Leidwesen feststellen musste. Daraufhin versuchte er, sich im Sitzungssaal des »Rates der Fünfhundert« ans Rednerpult zu drängen. Statt Jubel schallten ihm allerdings Rufe wie »Nieder mit dem Tyrannen!« entgegen. Das war Napoleon nicht gewohnt; er wusste sich nicht zu helfen. Stunden später sollte sich Napoleon gegenüber seinem Sekretär Bourrienne selbstkritisch äußern: »Ich habe heute ziemlich viel Blödsinn gesagt.« Und er gestand, er spreche »lieber zu Soldaten […] als zu Advokaten. Diese Hohlköpfe haben mich eingeschüchtert. Ich habe keinerlei Erfahrung im Umgang mit Versammlungen. Das wird schon noch kommen.« Als Retter in höchster Not erwies sich Lucien. Als Präsident des »Rats der Fünfhundert« unterbrach er die Sitzung und verhinderte in letzter Minute, dass die Abgeordneten über nichts weniger als die Ächtung seines Bruders Napoleon abstimmten.
Wenn man mit Worten nicht überzeugen kann, kommt so mancher mit militärischer Stärke weiter. Unter den versammelten Truppen wurde das Gerücht gestreut, dass ein Anschlag auf Bonaparte versucht worden sei; Napoleon behauptete sogar, mit Dolchen bedroht worden zu sein, eine Lüge. Als die Soldaten noch zögerten, mit Waffengewalt gegen die gewählten Volksvertreter vorzugehen, bewies Lucien ebenfalls schauspielerisches Talent. Mit einem Säbel in der Hand schwor er, »die Brust meines eigenen Bruders zu durchbohren, sollte er es jemals wagen, Hand an die Freiheit der Franzosen zu legen!« Daraufhin wurden die Versammlungsräume (ohne weiteres Blutvergießen) geräumt.
Es wurde eine provisorische Regierung von drei Konsuln gebildet: Napoleon und die beiden nun wieder aktiven Direktoren Sieyès und Ducos. Doch Sieyès musste erkennen, dass Napoleon seine Macht nicht teilen wollte. Die neue Verfassung schenkte dem Ersten Konsul diktatorische Vollmachten, während seine Kollegen nur beratende Funktion hatten. Der starke Mann an der Staatsspitze verkündete: »Bürger! Die Revolution ist zu den Grundsätzen zurückgekehrt, von denen sie ausging; sie ist zu Ende«. Jetzt schlug die Stunde Napoleons, der sich zum Retter Frankreichs stilisierte.
Ein Plebiszit diente der zusätzlichen Legitimierung der neuen Herrschaft. Durch die Volksabstimmung über die Verfassung sollte deutlich werden: Napoleon ist der von den Franzosen Erwählte. Im Februar 1800 wurde das amtliche Ergebnis bekannt gegeben. Laut dem Historiker Volker Ullrich haben von fünf Millionen Wählern 3 011 117 mit Ja und nur 1562 mit Nein gestimmt. Wie gesagt, mit Mathematik habe ich es nicht so, aber die Zahlen erscheinen selbst mir zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich wird in der Forschung darauf hingewiesen, dass die Wahlergebnisse manipuliert wurden. Lucien Bonaparte, mittlerweile Innenminister, hatte die Ja-Stimmen großzügig um 900 000 Stimmen aufgerundet und zudem eine halbe Million Stimmen aus der Armee in den Topf geworfen, obwohl diese gar nicht befragt worden war. Auffallend ist zudem die große Anzahl an Enthaltungen: Stimmte die schweigende Mehrheit zu oder rebellierte sie im Stillen gegen diese Entwicklung?
Auch die folgenden Volksabstimmungen, in denen es darum ging, sein Konsulat auf Lebenszeit zu verlängern und sich zum »Kaiser der Franzosen« zu erheben, gingen zu Napoleons Gunsten aus. Mit jeder neuen Verfassung, die Napoleon bis 1812 verabschiedete, sicherte er sich mehr Befugnisse, bis er allein Gesetze vorschlagen, Krieg erklären und Frieden schließen konnte. Die Minister waren ihm verantwortlich und das Parlament, bestehend aus dem Oberhaus (Senat) und dem Unterhaus (Gesetzgebende Körperschaft und Tribunat), konnte ihm nur dem Papier nach Grenzen setzen.
Napoleon auf dem Thron, Gemälde von Jean Auguste Dominique Ingres, 1806.
Napoleon bezeichnete sich selbst als »Sohn des Glücks«. Wie sein Lebenslauf zeigt, war ihm das Schicksal tatsächlich oft wohlgesonnen; dass er nicht in einer der vielen Schlachten oder durch ein Attentat sein Leben verlor, spricht dafür. Doch es wäre falsch, anzunehmen, allein der Zufall hätte ihn nach oben gespült. Er hatte ein sicheres Gespür für Chancen und war mutig genug, Risiken einzugehen; somit war er zu einem großen Teil seines eigenen Glückes Schmied. Möglicherweise waren es diese unfassbaren Erfolge, die ihn übermütig werden ließen und in dem Glauben bestärkten, mit der »Vorsehung« im Bunde zu sein. Hielt er sich selbst für unbesiegbar, für unfehlbar? Vertraute er so sehr auf sein Glück, dass er als Hasardeur um immer höhere Einsätze spielte und am Ende alles verlor?