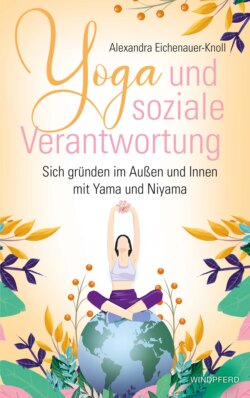Читать книгу Yoga und soziale Verantwortung - Alexandra Eichenauer-Knoll - Страница 15
Verantwortung für strukturelle soziale Ungerechtigkeit im Kollektiv mittragen
ОглавлениеDas »Social Connection Model« nach Iris Marion Young19
Wir sind heute mit vielen moralischen Dilemmata konfrontiert. Einerseits leiden wir unter den Folgen ökologischer und sozialer Krisen, erkennen auch irgendwie unsere Mitverantwortung daran, andererseits sehen wir uns außerstande, diese Probleme zu lösen. Daher verdrängen wir diese uns überfordernden Belange oder überlassen es bewusst der Politik, der Wissenschaft oder NGOs, für uns Lösungen zu finden.
Die amerikanische Philosophin Iris Marion Young beschreibt einen Denkansatz, der uns nicht aus unserer Mitverantwortung entlässt, gleichzeitig aber nach individuellen Möglichkeiten differenziert. Dabei setzt sie nicht auf Einzelkämpfertum, sondern auf die Effektivität eines Kollektivs. Ich möchte dieses Modell nun zum weiteren Durchdenken einführen, denn es appelliert an unsere Eigenverantwortung, an unsere Ratio und an unseren Gemeinwohlsinn. Gleichzeitig räumt es uns die Freiheit ein, nach eigenem Ermessen zu handeln. Und hier sind wir auch wieder beim Spüren: Was kann ich mir zumuten, und wo verläuft die Grenze zwischen moralischer Über- und Unterforderung?
Young sieht ihr Modell als Ergänzung, aber auch als mögliche Alternative zum »Liability Model«, das nach individueller Schuld und Haftung forscht und vergangenheitsorientiert funktioniert. Ihr neuer Ansatz erkennt nicht einen oder mehrere, sondern eine Vielzahl (vielleicht sogar Millionen) von Verursacher:innen. Sie alle tragen persönliche Verantwortung, da sie mit ihren Aktivitäten Teil eines Systems sind, das (globale) strukturelle Ungerechtigkeit produziert. Auch wenn sie dabei durchaus im Rahmen der Gesetze ihres Landes handeln, tragen sie trotzdem zur globalen Ungerechtigkeit bei. Dieser Verursachergruppe kann man je nach ihren Aktivitäten unterschiedliche Rollen zuordnen, zum Beispiel als Produzent:in, Händler:in, Arbeiter:in oder Konsument:in. Young bringt das Beispiel des Anti-Sweatshop Movements, wo Aktivist:innen Verursacher:innen auf unterschiedlichsten Ebenen zu mehr Verantwortungsübernahme für bessere Arbeitsbedingungen motivieren konnten.
Um sich über die eigene Rolle und die eigenen Handlungsmöglichkeiten klar zu werden, schlägt Young vier Parameter vor:
Wie viel Macht habe ich in dieser Gruppe (z. B. als renommierte:r Markenerzeuger:in)?
Welche Privilegien genieße ich (z. B. als Mittelklasse-Konsumentin, die spottbillig einkaufen kann)?
Wie sehr interessiert mich eine Verbesserung der Situation? (z. B. als Arbeiter:in in einem Sweatshop). Auch die Opfer können in diesem Modell also Verantwortung übernehmen!
Welche kollektiven Fähigkeiten können wir nutzen? (z. B. über Universitäten, Gewerkschaften oder Buchhandlungen)
Ergänzend sei gesagt, dass auch Drittparteien, die nicht zu den oben genannten Gruppen gehören, als positive Verstärker einwirken können. Man denke hier vor allem an Presse- und Medienarbeiter:innen. Auch Politiker:innen können als Außenstehende in Kampagnen eingebunden werden, um verbesserte Rahmenbedingungen zu ermöglichen.
Der ganze Prozess dieses Verantwortungsmodells ist als politisch anzusehen, da es viel Überzeugungsarbeit, eventuell auch Proteste und Aktionen bedarf, um die Akteur:innen zu mobilisieren bzw. sie auf ihre Verantwortung aufmerksam zu machen. Die Lösung des Problems liegt jedenfalls im kollektiven Zusammenwirken. Young hält nichts davon, einzelne Schuldige festzumachen, da das oft nur eine Kultur der wechselseitigen Schuldzuweisungen fördert. Wichtig ist zu erkennen, dass überall Menschen und keine unveränderlichen Fakten, Zahlen oder Dinge dahinterstehen. Wir können Veränderungen gemeinsam bewirken, wenn wir erkennen, dass wir (global) miteinander verbunden sind – auch wenn wir uns noch nie persönlich begegnet sind.