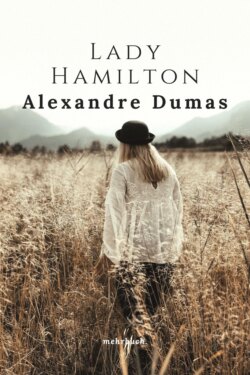Читать книгу Lady Hamilton - Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, The griffin classics - Страница 3
Prolog.
ОглавлениеAm 14. Januar 1815, gegen fünf Uhr abends, ließ ein Priester, dem eine alte Frau, die ihm als Führer zu dienen schien, voranschritt, die Spuren seiner Tritte in dem Schnee zurück, welcher sich von dem Dorfe Wimille nach dem zwischen Boulogne-sur-Mer und Calais gelegenen kleinen Hafen Ambleteuse erstreckte, in welchem Jakob der Zweite, nachdem er aus England verjagt worden, im Jahre 1688 landete. Der Priester ging mit raschem Schritte und verriet dadurch, daß man ihn mit Ungeduld erwartete. Er hüllte sich dabei dicht in seinen Mantel, um sich gegen den kalten, scharfen Wind zu schützen, der von der englischen Küste herüberwehte. Die Flut war eben im Steigen begriffen und man hörte das Brüllen der Meereswogen, gemischt mit dem trockenen Geräusch des Gerölles, welches vom Wasser am Strande hin- und hergeworfen wurde. Nachdem man ungefähr eine halbe Wegstunde auf der durch eine Doppelreihe kränklicher, entlaubter Ulmen angedeuteten Straße zurückgelegt, schlug die alte Frau rechts vom Wege einen unter dem Schnee kaum sichtbaren Fußsteig ein, welcher nach einer kleinen Hütte führte, die auf der Mitte eines die Landschaft beherrschenden Hügelabhanges stand. Ein leuchtender Punkt, der wahrscheinlich durch eine durch die Fensterscheiben hindurch sichtbare Kerze oder eine Lampe verursacht ward, war das einzige, was das Vorhandensein dieser Hütte verriet, die sonst in dem Abenddunkel vollständig unsichtbar gewesen wäre. Zehn Minuten genügten, um die beiden Wanderer an die Schwelle der Tür gelangen zu lassen. Die alte Frau streckte eben die Hand nach dieser Tür aus, als dieselbe sich von selbst öffnete und eine jugendliche Stimme mit einem leichten Anflug von englischem Akzent sagte:
»Kommen Sie, Herr Abbé. Meine Mutter erwartet Sie mit Ungeduld.« – Die alte Frau trat auf die Seite, um den Priester vorangehen zu lassen, hinter welchem sie ebenfalls in die Hütte trat. Das junge Mädchen schloß die Tür wieder und zeigte in dem zweiten Zimmer, dem einzigen erleuchteten, auf eine Frau, welche sich mit Mühe im Bette emporrichtete. »Ist er da?« fragte die Kranke mit matter Stimme und auf englisch. – »Ja, Mama,« antwortete das junge Mädchen in derselben Sprache. – »O, dann möge er hereinkommen!« rief die Kranke auf französisch. Mit diesen Worten sank sie wieder auf ihr Bett zurück. – Der Priester trat in das zweite Zimmer und näherte sich dem Bette. Das junge Mädchen und die alte Frau blieben in dem ersten Gemach.
Die Kranke schien durch die Anstrengung, die sie soeben gemacht, ganz erschöpft zu sein und zeigte, ohne den Kopf vom Pfühl zu erheben, mit matter Hand auf einen Sessel, indem sie dem Geistlichen durch diese Gebärde zu verstehen gab, daß er sich dem Bette nähern und Platz nehmen solle. Der Priester verstand diese Gebärde, näherte sich dem zu Häupten des Bettes stehenden Sessel und setzte sich. Es trat ein Augenblick des Schweigens ein, während dessen man weiter nichts hörte als den gepreßten Atemzug der Sterbenden und das Schluchzen, welches das junge Mädchen vergebens zu unterdrücken versuchte. Während dieser Minute des Wartens hatte der Priester Zeit, einen Blick um sich zu werfen. Das Innere des Gemaches bot ein eigentümliches Gemisch von Luxus und Elend dar. Die Möbel und Wände waren allerdings die einer ärmlichen Hütte, die Bettwäsche der Kranken aber war von der feinsten holländischen Leinwand. Das Negligé, in welches sie sich gehüllt, war von prachtvollem Batist und das Tuch, welches, unter ihrem Halse zusammengeknüpft, einen Wald von herrlichem kastanienbraunem Haar zusammenhielt, war mit jenen kostbaren Spitzen eingefaßt, welchen England den Namen gegeben hat. Dem Bette gegenüber und nur durch das Fenster getrennt, welches durch einen elenden Kattunvorhang verhüllt war, machten sich durch den Glanz ihres Kolorits zwei Bildnisse bemerkbar, die augenscheinlich ihr Dasein dem Pinsel eines großen modernen Meisters verdankten.
Sie stellten das eine eine Frau, das andere einen Mann vor, beide schienen eines des andern Seitenstück zu sein, und waren von Lebensgröße. Das Bildnis des Mannes stellte einen höheren Offizier der englischen Marine vor. Seine blaue Uniform trug auf der linken Seite unter dem Bath-Orden, der in England so hoch geschätzt und nur für geleistete sehr wichtige Dienste verliehen wird, noch drei andere Orden, in welchen ein in diesen Dingen bewanderter Kenner den Orden des heiligen Ferdinand und des Verdienstes, den Orden des heiligen Joachim von Malta, welchen Paul der Erste von Rußland gestiftet und der mit ihm starb, und drittens endlich den ottomanischen Halbmond erkannt haben würde, der in seiner Sichel den Namenszug des Sultan Selim des Dritten in Diamanten trug. Ganz besonders auffallend aber ward dieses Bildnis durch die ruhmreiche Verstümmelung gemacht, deren Opfer das Original gewesen sein mußte. Eine breite Narbe durchfurchte nämlich die Stirn, unter welcher sich eine schwarze Binde hinzog, die ein verlorenes Auge verdeckte, während der an einem Knopf der Uniform befestigte rechte Ärmel der Uniform verriet, daß der Arm oberhalb des Ellbogens amputiert worden war. Der Mann, welchen dieses Bild vorstellte, war von Wuchs eher klein als groß. Er hatte blondes Haar. Das ihm noch gebliebene Auge schien geniale Blitze zu schießen und die Adlernase verriet ebenso wie das kräftig geformte Kinn Willenskraft und Mut, die charakteristischen Eigenschaften eines Kriegshelden. Die Frau dagegen war das vollkommene Urbild der Anmut und Schönheit. Ihr jeden Schmuck entbehrendes kastanienbraunes Haar fiel in üppigen Locken auf ihren Hals und ihre Brust herab. Sie hatte schwarze Augen und schwarze Wimpern. Ihre Gesichtsfarbe war frisch und zart, die Nase gut geformt, der Mund klein wie der eines Kindes und ließ, halbgeöffnet wie eine Rose an einem Frühlingsmorgen, zwei Perlenreihen sehen oder vielmehr erraten. Sie trug eine Kaschmirtunika von griechischem Schnitt und einen über die rechte Schulter geworfenen Purpurmantel. Ihr Leib ward von einem breiten, mit Gold gestickten Gürtel von kirschrotem Samt umschlossen, dessen Agraffe aus einer Kamee bestand, die das von der Seite gesehene Haupt eines Greises darstellte. Dieses prachtvolle Bildnis war augenscheinlich das der Kranken, in deren Zügen man jetzt noch, trotz ihrer fünfzig Jahre und der Verheerungen einer grausamen Krankheit, Überreste einer außerordentlichen Schönheit erkennen konnte, welche der Maler auf die Leinwand festgebannt.
Während der Priester diese sozusagen unwillkürliche Beaugenscheinigung vornahm, öffnete die Kranke wieder langsam die Augen und heftete sie mit dem Ausdrucke der Unruhe auf ihn. Es war, als suchte sie in dem Gesichte des Mannes, den sie hatte rufen lassen, um ihn zum Vermittler ihrer Versöhnung mit Gott zu machen, was sie wohl von der himmlischen Barmherzigkeit zu fürchten und zu hoffen habe. Der Priester war ein Mann von fünfundsechzig Jahren, mit einem sanften, ruhig heiteren, von spärlichem, dünnem weißen Haar beschatteten Gesicht. Man las in seinen Zügen die Einfalt seiner Seele und erkannte in seinem Blick einen Funken jener unaussprechlichen Liebe, welche Leonardo da Vinci in die Augen des Heilands gelegt hat. Die Kranke schien durch den Anblick des Priesters wieder ein wenig beruhigt zu werden. »Mein Vater,« sagte sie, »ich habe in allen heiligen Büchern gelesen, daß Gottes Barmherzigkeit unendlich ist; ich habe Sie aber holen lassen, um diese Worte nochmals aus dem Munde eines Dieners dieses Gottes selbst zu hören. Meine Sünden, meine Fehler, ja meine Verbrechen,« setzte sie, die Stimme senkend, hinzu, »sind so groß, daß, wenn ich nicht in Verzweiflung sterben soll, ich nicht weniger als des Wortes eines heiligen Mannes wie Sie bedarf.« – Der Priester betrachtete erstaunt diese Frau mit der sanften Stimme, dem offenen Gesichtsausdrucke und dem Auge, welchem selbst das Fieber, welches sie verzehrte, seinen engelgleichen Ausdruck nicht rauben konnte und die gleichwohl sagte, sie sei eine Verbrecherin. »Meine Tochter,« antwortete er, »die Todesangst verwirrt Ihre Sinne. Das Weib ist allerdings ein schwaches Geschöpf und durch ihre Stellung in der Gesellschaft der Gefahr ausgesetzt, Sünden und Fehler zu begehen; wenn ich aber recht verstanden habe, so klagen Sie sich an, nicht bloß Sünden und Fehltritte, sondern geradezu Verbrechen begangen zu haben.« – »Ja, Verbrechen, mein Vater, Verbrechen! O, ich weiß wohl, daß ein Held mich seine Geliebte und eine Königin mich ihre Freundin nannten, ich weiß wohl, daß in dem Enthusiasmus meiner Jugend, in dem Strudel meines Glücks ich meine Handlungen nicht so beurteilte. Seitdem aber er tot ist, seitdem sie tot ist, seitdem ich in Not und Elend geraten bin, und seitdem die Not, diese Rache des Himmels, mich zum Zweifel geführt hat – seit dieser Zeit sehe ich mich so wie ich bin, mein Vater, das heißt mit einem durch die Schwelgerei befleckten Körper und mit von Blut geröteten Händen.« – »Meine Tochter, die Barmherzigkeit des Herrn ist unendlich,« hob der Priester wieder an, »und Jesus verzieh im Namen seines Vaters der reuigen Magdalena ebenso wie der Ehebrecherin.«
Die Kranke streckte die Hand aus, legte dieselbe auf den Arm des Priesters, richtete sich empor, um sich ihm zu nähern, und fragte: »Würde er auch der Herodias verziehen haben?« – Beinahe mit Entsetzen bog der Priester sich zurück. »Wer sind Sie denn?« fragte er. – »Ja, in der Tat, Sie haben recht, mein Vater,« antwortete die Kranke, –»wenn ich Ihnen meinen Namen sage, so sage ich Ihnen damit alles. O entfernen Sie sich nicht von mir, wenn ich es Ihnen gesagt haben werde«,« setzte sie hinzu. – »Meine Tochter,« sagte der Priester, »selbst einen Vatermörder würde ich trösten und bis aufs Blutgerüst begleiten.« – »O, das Blutgerüst, das ist die Sühne!« rief die Kranke. »Wenn ich anstatt in meinem Bett auf dem Blutgerüst stürbe, dann würde ich nicht zweifeln.« – »Haben Sie denn einen Mord begangen?« fragte der Priester schaudernd. – »Nein, mein Vater, aber ich habe einen Mord begehen lassen.« – »Waren Sie sich dabei des Verbrechens bewußt, welches Sie begingen?« – »O nein, nein, ich glaubte dem König, ich glaubte Gott zu dienen; ich diente aber bloß meiner Rache. Wie wollen Sie, daß Gott mir verzeihe, mir, die ich nicht verziehen habe?« – Der Priester sah sie an. »Sie sind Engländerin?« fragte er dann. –»Ja, mein Vater,« antwortete die Kranke. – »Und Protestantin?« – »Ja.« – »Warum haben Sie aber dann nicht einen Geistlichen von Ihrer Religion holen lassen? Es gibt einen in Boulogne.« – »Ich weiß es.« – Die Kranke schüttelte den Kopf und stieß einen Seufzer aus. – »Nun und?« fragte der Priester wieder. – »Unsere Geistlichen sind zu streng, mein Vater. Unsere Religion ist zu schroff. Ich habe es nicht gewagt.« – »Es ist das ein großes Lob, welches Sie der unsrigen zollen, meine Tochter, da Sie aber diese Meinung von unserer Religion haben, warum haben Sie dann nicht schon längst im Schoße derselben Zuflucht gesucht?« – »Wenn sie mich nun zurückgewiesen hätte, mein Vater?« – »Unsere Religion weist niemanden zurück, meine Tochter. Sagte Jesus nicht zu dem guten Schächer: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch heute sollst du bei mir im Paradiese sein?« – »Der gute Schächer hing aber am Kreuze. Er starb mit dem Heiland.« – »Wer in ihm stirbt, der stirbt auch mit ihm und die Reue ist besser als das Kreuz. Bereuen Sie, meine Tochter?« – »O,« sagte die Kranke, indem sie beide Hände gen Himmel hob, »o, ich bereue aufrichtig und inbrünstig, das schwöre ich Ihnen.« – »Bereuen Sie bloß aus Furcht vor dem Tode?« – »O nein, mein Vater; ich bereue, weil mir, wie dem heiligen Paulus auf dem Wege nach Damaskus, die Schuppen von den Augen gefallen sind, und weil ich mich so sehe, wie ich bin.« – »Wohlan, Sie wissen, daß Gott dem heiligen Paulus nicht bloß verzieh, sondern auch einen seiner Apostel aus ihm machte. Dennoch hatte der heilige Paulus die Mäntel derer gehalten, welche den heiligen Märtyrer Stephan steinigten.« – »Wie gut sind Sie, mein Vater, daß Sie mich auf diese Weise ermutigen und trösten.« – »Das ist meine Pflicht, meine Tochter. Wenn ein Schaf trotz der Warnungen des Hundes sich eigenwillig von der Herde entfernt, dann nimmt der gute Hirt es auf seine Schultern und trägt es zurück in die Hürde. Wie weit mehr Grund hat er aber, es mit Freuden aufzunehmen, wenn es von selbst zurückkehrt. Sprechen Sie, erzählen Sie mir Ihre Fehltritte. Ich bin bereit, dieselben zu hören, und wenn dieselben die einem armen Priester erteilte Vollmacht nicht überschreiten, so werde ich sie Ihnen im Namen Gottes verzeihen.« – »Eine solche Erzählung würde lang und nutzlos sein. Mein Name wird genügen. Wenn Sie meinen Namen hören, so werden Sie alles wissen.« – Der Priester sah sie abermals mit Überraschung an. »Nun, dann nennen Sie mir Ihren Namen,« sagte er.
Die Sterbende neigte sich zu ihm und murmelte mit zitternder, kaum vernehmlicher Stimme die zwei Worte: »Lady Hamilton.« – »Dieser Name sagt mir nichts, meine Tochter,!« antwortete der Priester, »ich kenne denselben nicht, sondern höre ihn jetzt zum erstenmal.« – »O, mein Gott,« rief die Kranke fast mit dem Ausdruck der Freude, »dann gibt es also einen Menschen, der mich nicht kennt! Es gibt also einen Mund, der mir nicht geflucht hat?« Und sie sank, ein Dankgebet zu Gott murmelnd, auf ihrem Bett zurück. Plötzlich aber zuckte ein Ausdruck der Angst und des Schreckens über ihr Gesicht. »O dann,« sagte sie, »bin ich aber verloren, mein Vater, denn ich werde weder Kraft noch Zeit genug haben, Ihnen alles zu erzählen, und wenn ich Ihnen nicht die nagenden Folterqualen der Armut, die fieberhaften Verlockungen des Goldes, die unwiderstehlichen Vorspiegelungen der Leidenschaft schildern kann, wenn Sie von meinem Leben bloß die Fehler, aber nicht die Versuchungen kennen, dann werden Sie mir niemals verzeihen. O, wenn Sie lesen könnten –.«
»Was denn?« – »Meine Lebensgeschichte, die ich selbst als eine erste Sühne in allen ihren Einzelheiten niedergeschrieben, besonders damit sie später meiner Tochter zur Warnung dienen und sie abhalten möge, den Weg zu betreten, den ich gewandelt, und in die Fehler zu verfallen, in welche ich gefallen bin.« – »Und warum sollte ich diese von Ihnen geschriebene Lebensgeschichte nicht lesen?« – »O, mit dem Blute meines Herzens ist sie geschrieben, das schwöre ich Ihnen.« – »Warum sollte ich sie nicht lesen, frage ich.« – »Weil ich Engländerin bin und diese Geschichte daher in englischer Sprache niedergeschrieben habe.« – »Ich habe fünf Jahre, von 1790 bis 1795, in England gelebt und spreche das Englische wie meine Muttersprache.« – »O, mein Vater, mein Vater!« rief die Sterbende, indem sie die Hand des Priesters ergriff. »Sie hat fürwahr Gott mir gesendet und ich beginne an seine Verzeihung zu glauben. Hier, mein Vater,« setzte sie mit fieberhafter Hast hinzu, indem sie dem Priester einen Schlüssel gab, den sie an dem Zipfel ihres Taschentuchs angebunden und unter ihrem Kopfkissen versteckt gehalten; »nehmen Sie diesen Schlüssel, öffnen Sie das Schubfach dieser Toilette und Sie werden darin ein Manuskript mit dem Titel »My Life« finden. Nehmen Sie dieses, lesen Sie es und wenn Sie mir Verzeihung bringen, so kommen Sie so schnell als möglich wieder. Bin ich dagegen auf ewig verdammt, so schicken Sie mir bloß das Manuskript zurück. Ich werde dann wissen, was das heißt.«
Der Priester erhob sich, öffnete das Schubfach und nahm aus demselben das bezeichnete Manuskript. »Meine Tochter,« sagte er, »diese Lektüre muß einen Teil der Pflichten meines Berufes ausmachen. Sie werden mich daher erst morgen zu derselben Stunde wiedersehen.« – »Gott wird so gnädig sein, mich bis dahin leben zu lassen,« sagte die Kranke, »besonders –,« Sie zögerte. – Der Priester sah sie an. Sein Blick war eine Ermutigung. – »Besonders,« hob sie wieder an, »wenn Sie mich segnen.« – »Ich segne Sie, arme Frau!« sagte der Priester, »und möge Gott Sie segnen, wie ich es tue.« – Als er in das erste Zimmer zurückkam, sah er hier das junge Mädchen und die alte Frau auf den Knien liegen. – »Gott behüte Sie, mein Kind; leben Sie wohl,« sagte er zu dem jungen Mädchen, indem er seine rechte Hand auf das Haupt desselben legte. Die alte Frau ergriff seine linke Hand und küßte sie. Der Priester verließ das Haus. Die Kranke folgte, so lange sie ihn sehen konnte, ihm, die Arme nach ihm ausbreitend, mit den Augen. Das junge Mädchen zeigte sich auf der Schwelle des Zimmers. »Wie fühlst du dich jetzt, Mama?« fragte es. – »O, besser, besser, meine Horatia. Noch ein Besuch wie der, den dieser Mann mir soeben gemacht, und er wird meine Vergangenheit mit sich hinweggenommen haben.«
Am nächsten Tage zu derselben Stunde kam der Priester wieder. Dicht hinter ihm folgten zwei Chorknaben, von welchen der eine den Weihkessel, der andere das Kreuz trug. Die Kranke war ruhiger, aber auch noch schwächer als am Abend vorher. Es war klar, daß nur der Glaube und die Hoffnung, diese beiden Töchter des Himmels, sie noch aufrecht hielten. Der Priester näherte sich mit von Menschenliebe und Mitleid strahlendem Antlitze dem Bette. Das junge Mädchen und die alte Frau, diese beiden Wesen, welche zwei zu beiden Seiten der Pforte des Lebens stehende Bildsäulen zu sein schienen, um die Jugend und das hinfällige Alter zu repräsentieren, richteten die Kranke auf ihrem Pfühl empor. Zwei Schritte von ihr blieb der Priester stehen. Sie wartete mit gefalteten Händen und die Augen gen Himmel richtend. »Glauben Sie an die sieben Sakramente?« fragte er. – »Ja, ich glaube daran,« antwortete sie. – »Glauben Sie an die wirkliche Gegenwart des Heilands im heiligen Abendmahle?« – »Ja, ich glaube daran.« – »Glauben Sie an die oberste Gewalt des römischen Papstes und an seine Unfehlbarkeit in Glaubenssachen?« – »Ja, ich glaube daran.« – »Glauben Sie an die römischen Symbole und mit einem Worte an alles, was die römische, apostolische und allgemeine Kirche glaubt?« – »Ja, ich glaube daran.« – Der Priester schöpfte mit der hohlen Hand ein wenig Wasser aus dem Weihkessel, ließ es auf das Haupt der Sterbenden träufeln und sagte: »Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Möge das Wasser der Taufe deine Fehltritte, deine Sünden und selbst deine Verbrechen hinwegnehmen!« Die Sterbende stieß einen Freudenruf aus, ergriff die von der Berührung mit dem geweihten Wasser noch nasse Hand des Priesters, drückte sie begierig an ihre Lippen und küßte sie. Dann rief sie mit überwallendem Gefühle der Erhebung: »Mein Gott, nimm meine Seele auf zu Dir!« – Und sie sank auf das Kopfkissen zurück. Ihr Gesicht hatte einen solchen Ausdruck von heiterer Ruhe gewonnen, daß die alte Frau und das junge Mädchen glaubten, sie schliefe, und nur der Priester verstand, daß bloß der Tod diese himmlische Ruhe geben konnte. Sie war wirklich tot. Wie sie am Abende zuvor gesagt, hatte der Priester bei seinem zweiten Besuche die Vergangenheit mit sich fortgenommen und das Wasser der Taufe hatte, indem es von ihrer Stirn bis zur Seele drang, alles, Schmutz und Blut, hinweggewaschen.
Wir lassen nun folgen, was der Priester in dem »Meine Lebensgeschichte« betitelten Manuskripte gelesen.
In der Hoffnung, daß Gott meiner Reue und meiner Demut verzeihen wird, schreibe ich die folgenden Seiten.
1. Jänner 1814.
Emma Lyonna, verw. Hamilton.