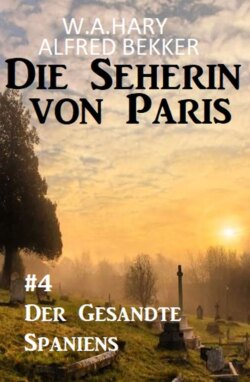Читать книгу Der Gesandte Spaniens: Die Seherin von Paris 4 - Alfred Bekker - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Robert de Malboné hatte insgeheim gehofft, sein spurlos verschwundener Freund François Delacroix sei von denselben Leuten entführt worden wie Marie de Gruyére, alias Marie de Chambourac. Dann hätte er ihn gemeinsam mit dieser aus den Fängen der Entführer befreien können.
Doch er hatte sich geirrt. Zwar war die Befreiung von Marie gelungen, aber Delacroix war nicht mit anwesend gewesen in jener versteckten Kapelle, die den Satansanbetern vom Zirkel zum Abhalten sogenannter Schwarzer Messen gedient hatte.
Zumindest war es im Zuge der Befreiung gelungen, endgültig dem Satanspriester Etienne Guibourg für immer das schändliche Handwerk zu legen. Wenngleich François Delacroix weiterhin verschwunden blieb.
Marie, die auch nach der Befreiung ziemlich angeschlagen wirkte, musste sich erst einmal in ihren eigenen Gemächern auf Schloss Versailles von den Strapazen erholen. Robert hatte seinen Helfer Milan dazu abgestellt, über ihr Wohl und Wehe zu wachen. Es war ja nicht auszuschließen, dass die Verschwörergruppe auch ohne ihren Anführer auch noch weiterhin tätig war auf dem Schloss und alles unternehmen würde, um Marie als Opfer für eine Schwarze Messe erneut zu entführen.
Gern hätte Robert auch seine restlichen vier Helfer dafür eingesetzt, doch Marie hatte dies kategorisch abgelehnt. Ihr war Milan allein schon zu viel des Guten. Wobei sie behauptete, auch sehr gut für sich selbst sorgen zu können, für ihre eigene Verteidigung.
Für Robert sah das allerdings ganz und gar nicht danach aus: Wenn sie es tatsächlich vermocht hätte, sich ausreichend selbst zu schützen, wäre ihre Entführung ja wohl niemals gelungen.
Dass Marie dagegen argumentierte, ihre seherische Begabung hätte sie sozusagen gezielt in diese schlimme Situation gebracht, wohl nur deshalb, um von ihm befreit werden zu können, so dass sie beide endlich sich nicht mehr weiter gegenseitig aus dem Weg gehen konnten, ließ Robert nicht gelten. Für ihn war so etwas wie eine seherische Begabung reiner Humbug. Er vertraute der Wissenschaft, wie sie neben dem ansonsten alles dominierenden Aberglauben 1680 in Frankreich dennoch zur Blüte geraten war unter den sogenannten Aufgeklärten. Und er war natürlich begeisterter Anhänger der Mathematik, in der Annahme, diese allein könnte alles erklären, was es an Rätseln in der wahren Welt zu geben schien.
Er hatte zaghaft versucht, Marie das klar zu machen, doch diese hatte gar nicht darauf reagiert. Für sie war wohl ihre seherische Begabung etwas durchaus Gegenständliches, Greifbares, Wahrhaftiges, eben etwas, das der Wirklichkeit auch dann entsprach, wenn jemand wie Robert nicht daran zu glauben vermochte.
Sie selbst hielt sich somit für die eigentlich Aufgeklärte, verstand Robert. Was für ihn natürlich die Frage aufwarf, welche Art von seelischer Krankheit hinter einer solchen Haltung stecken mochte. Er hatte da einen guten Tipp betreffend eines berühmten Arztes in Paris bekommen, der sich darin durchaus auszukennen vermochte. Deshalb hatte er längst beschlossen, diesen einmal persönlich und natürlich in aller diskreter Heimlichkeit zu Rate zu ziehen. Auch und vor allem, was seine zukünftige Haltung in dieser Sache gegenüber Marie betraf. Wobei er kaum zu hoffen wagte, dass es ihm jemals gelingen würde, Marie selbst zu dem Arzt zu bringen, um sich einmal von diesem persönlich beraten zu lassen.
Es blieb ihm also nur die aus seiner Sicht gesehen berechtigte Sorge um ihr geistiges Wohl. Immerhin war Marie die einzige Frau, die ihm jemals begegnet war und dabei solche Gefühle in ihm hochwallen ließ. Allein nur, wenn er ihren Namen dachte, spürte er es wie einen Stich mitten durch sein Herz. Wenn er gar intensiv an sie dachte und dabei wagte, die Augen zu schließen, hatte er das Gefühl, regelrecht ohnmächtig zu werden. Etwas, was er mit seinen dreißig Jahren, die er bereits mit beiden Füßen mitten im Leben stand, niemals auch nur für möglich gehalten hätte. War er denn nicht gerade für seine nüchterne Art bekannt? Immerhin das, was man ein Bild von einem Mann nannte. Als jemand, der Eindruck schinden konnte allein nur mit seiner Erscheinung und sich durchaus gegen jegliche Unbilden zur Wehr zu setzen vermochte.
Was durchaus auch nötig gewesen war bislang. Nicht nur, weil er jahrelang im Polizeidienst als Ermittler tätig gewesen war, sondern auch, weil sein Vater einer jener treuen Anhänger des Königs gewesen war, als damals die Adelsgemeinschaft versucht hatte, diesen als Erben seiner königlichen Mutter zu entmachten. Ohne seinen Vater und dessen Mitstreiter wäre der Putsch wohl gelungen.
Mit anderen Worten: Ohne Männer wie seinem Vater wäre König Ludwig XIV. schon sehr lange nicht mehr auf Frankreichs Thron gewesen, und allein schon von daher gesehen war der Sohn eines solchen Mannes der Erzfeind vieler Adeliger, die nicht wagten, ihre Feindschaft gegenüber dem König offen zu zeigen.
Kein Wunder mithin, dass am Hofe Frankreichs auch so etwas wie die okkulte Verschwörung so gut hatte Fuß fassen können. Denn hier fand sie sicherlich reiche Nahrung.
Inzwischen versuchte Robert de Malboné mit Hilfe seiner verbliebenen vier Helfer endlich doch noch eine brauchbare Spur zu finden, die zur Erklärung des Verbleibs seines Freundes führen könnte.
Sie hatten sich für ihre Suche getrennt. Schloss Versailles war eine eigene Welt, komplex, um nicht zu sagen verzwickt, weitläufig, schier unergründlich und vor allem unüberschaubar. Es gab unzählige Möglichkeiten hier, jemanden spurlos verschwinden zu lassen. Man musste es eigentlich nur wollen.
Doch wer hatte es gewollt?
Die Erklärung, der Schreiber Delacroix sei aus freien Stücken von hier verschwunden, wollte Robert nicht gelten lassen. Dafür kannte er seinen alten Freund zu gut. Dieser würde niemals freiwillig das Schloss verlassen, zumal dies einem Schreiber ausdrücklich untersagt war.
Aber hatte er es überhaupt verlassen? Vielleicht befand er sich ja immer noch hier, allerdings als Gefangener?
Hatte er bei seinen Ermittlungen den Unwillen der okkulten Verschwörer erregt, die ihn auf diese Weise hatten beiseite schaffen wollen? Oder wer sonst kam in Betracht?
Robert dachte nicht zufällig auch an das Exorzisten-Kolleg. Er wusste ja längst, dass dieses jegliche Konkurrenz hinsichtlich Ermittlungen gegen den Circle Rufucale höchst ungern sah. Aber würden sie tatsächlich dabei so weit gehen und einen angesehenen Hofschreiber wie François Delacroix entführen?
Solchermaßen in Gedanken versunken durchstreifte Robert das riesige Schloss. Ohne Augen zu haben für die prunkvolle Ausstattung, all die üppigen Verzierungen, Reliefs und aufwändigen Stuckarbeiten, die einem hier allerorten begegneten. Genauso wie kostbare Gemälde und ähnliche Kunstschätze, mit denen Schloss Versailles überreichlich beschert war.
Er unterbrach seine Gedankengänge nur, wenn er Befragungen anstellte, um endlich eine passende Spur zu finden. Wo hatte sich Delacroix das letzte Mal aufgehalten? Wo war er das letzte Mal gesehen worden – und wann?
Doch niemand hatte ihn anscheinend zu Gesicht bekommen am Tag seines Verschwindens. Oder wollte sich nur niemand darüber äußern? Belogen ihn die Adeligen, die er befragte, weil sie nicht in eine Angelegenheit hineingezogen werden wollten, die sie im höchsten Maße ängstigte?
Es wäre jedenfalls mehr als typisch gewesen für das allgemeine Verhalten der Adeligen, die hier gegen ihren freien Willen ihrer Residenzpflicht genügten, vom König per eindeutigem Dekret dazu gezwungen.
Und dann sah sich Robert plötzlich von Maskierten umringt. Sie trugen nicht dieselben Masken wie jene, die er bei der Entführung von Marie beobachtet hatte. Doch das hatte nichts zu bedeuten. Es konnte sich dennoch um Angehörige der okkulten Verschwörer handeln. Und sie waren für ihn wie aus dem Nichts aufgetaucht, um ohne zu zögern vor zu preschen und ihn zu ergreifen.
Robert sah die Klinge eines gezückten Messers aufblitzen und verstand, dass die ihn nicht nur einfach entführen wollten, sondern sie wollten ihn sogar hier und jetzt töten!
Eigentlich eine Übermacht. Immerhin handelte es sich um ein halbes Dutzend Angreifer, die gleichzeitig ihn attackierten, doch Robert bewies, was er als polizeilicher Ermittler gelernt hatte. Immerhin eine Situation, die nicht völlig neu war für ihn. Von daher wusste er, dass in einem Bereich, in dem ständig die Gefahr bestand, überrascht zu werden, ergo höchster Zeitdruck bestand, die Übermacht sich eher gegenseitig im Weg war als dass dies zu ihrem Vorteil gereichte.
Robert kauerte sich blitzschnell nieder. Das Messer verfehlte sein Ziel und ging knapp über seinem Kopf hinweg.
Robert ergriff rechtzeitig das Handgelenk des Angreifers und wirbelte einmal um die eigene Achse, womit er den Angreifer über sich nicht nur zum Taumeln brachte, was die restlichen fünf Angreifer daran hinderte, an ihr Opfer heran zu kommen, sondern auch dazu zwang, das Messer los zu lassen.
Noch während es auf dem Weg zum Boden war, richtete sich Robert zur vollen Größe auf und schlug wahllos zu, mitten hinein in diese maskierten Visagen, was nicht nur den leichten Masken nicht bekam, sondern das entstandene Chaos kurzzeitig vergrößerte.
Robert gelang dabei das Kunststück, den Ring zu sprengen, der sich um ihn geschlossen hatte.
Jetzt zogen alle ihre Messer. Anscheinend hatten sie ihn nur fixieren wollen, damit dieser eine den tödlichen Streich hätte verüben können, ohne dem Opfer die Chance zum Ausweichen zu lassen. Diese Strategie war eindeutig misslungen. Also wandten sie sich jetzt geschlossen gegen ihn, mit blitzenden Klingen, um ihn zu durchbohren.
Mit einer Ausnahme: Der eine, der ihn ursprünglich allein hatte niederstechen sollen, rieb stöhnend seine Schulter, die Robert halb ausgekugelt hatte. Er bückte sich gleichzeitig nach seinem fallengelassenen Messer, mit der unverletzten Hand.
Sonst bekam Robert nichts mehr mit, denn er hatte sich bereits zur Flucht gewandt, wobei er einen gellenden Schrei ausstieß. Wohl sprichwörtlich dazu geeignet, sogar Tote aufzuwecken, um endlich andere auf die Vorgänge hier aufmerksam zu machen.
Fragen wie beispielsweise, ob die Maskierten ihn schon länger unter Beobachtung gehalten hatten, um auf den richtigen Moment zu warten für ihren Überfall, kamen ihm schon gar nicht. Er wollte nur noch weg von hier, den Angreifern entfliehen, um in einen Bereich zu gelangen, in dem es mehr Zeugen der Vorgänge geben konnte.
Dazu musste er gar nicht mehr so weit laufen, und als er sich dabei nach seinen Verfolgern umdrehte, waren diese nicht mehr vorhanden.
Robert de Malboné blieb keuchend stehen, während ihn die Adeligen, denen er hier zufällig begegnete, befremdlich betrachteten. Sie fragten sich wohl, was ihn geritten haben mochte, hier schreiend herum zu rennen.
Robert de Malboné beschloss, dies einfach zu ignorieren. Währenddessen ging er weiter. Diesmal nicht, um weiter nach seinem verschwundenen Freund Delacroix zu suchen, sondern um zurückzukehren zu Marie. Wenn die Gegner schon bereit waren, ihm am helllichten Tag aufzulauern, um ihn umzubringen, war Marie erst recht gefährdet.
Wobei die Frage, wer denn nun hinter diesem Überfall wirklich steckte, noch nicht einmal so sehr von Belang erschien. Vorerst jedenfalls nicht.