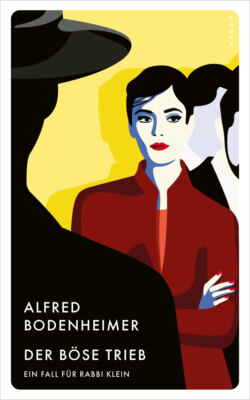Читать книгу Der böse Trieb - Alfred Bodenheimer - Страница 5
2
ОглавлениеRabbiner Bunem Kletzki war überrascht über Kleins Anruf.
»Ich wusste nicht, dass Sie mit Doktor Ehrenreich in Kontakt waren.«
»Seit einigen Jahren, ja.«
»Eine fürchterliche Geschichte. Weiß man denn schon mehr über den Tathergang? Gibt es eine Spur?«
»Das müssen Sie die Polizei fragen. Ich rufe Sie vor allem wegen eines Anliegens von Frau Ehrenreich an.«
Kletzki schwieg einen Augenblick. »Sie hat Ihnen gesagt, dass unser Verhältnis …«
»Ich habe aus ihren Worten herausgehört, dass es … angespannt ist. Warum eigentlich?«
»Das müssen Sie Frau Ehrenreich fragen. Von meiner Seite gibt es dazu keinen Anlass.«
»Lieber Reb Bunem«, sagte Klein freundlich und dennoch leicht gereizt. »Wir wissen alle, dass es immer zwei Seiten gibt. Sie werden vielleicht den Grund von Frau Ehrenreichs Zorn nicht verstehen. Aber kennen werden Sie ihn.«
»Ich hatte nie einen Konflikt mit Frau Ehrenreich. Mit ihrem Mann schon, das stimmt. Ich glaube, ihre Abneigung gegen mich ist mehr eine Form der Loyalität zu Viktor, als dass sie persönlich wäre.«
»Und was war Ihr Konflikt mit Viktor?«
Kletzki seufzte. »Ich will keinen Laschon hara sprechen.«
»Und ich will keinen Laschon hara hören«, sagte Klein leicht genervt. »Aber vielleicht hilft es ja, den Konflikt zwischen Ihnen und Sonja Ehrenreich beizulegen, wenn die Ursache analysiert werden kann. Gerade nachdem jetzt der Monat Elul begonnen hat.«
»Es fing eigentlich sehr gut an«, sagte Kletzki nach kurzem Zögern schließlich. »Die Ehrenreichs und unsere Familie kamen beide ungefähr gleichzeitig hierher. Ich war einer der ersten Absolventen des neuen Berliner Rabbinerseminars, Viktor übernahm die Praxis in Inzlingen vom Vater eines Studienfreunds, wenn ich mich nicht irre. Jeden Schabbat marschierte er stramm eine Dreiviertelstunde in die Synagoge und wieder zurück, am Freitagabend und am Schabbatmorgen. ›Sie durchqueren ein ganzes Land, um am Schabbat in die Synagoge zu kommen‹, sagte ich ihm damals. Wir haben uns gut verstanden.«
»Ein ganzes Land?«
»Na ja, die Eiserne Hand.«
»Reb Bunem, Sie sprechen in Rätseln.«
»Die Eiserne Hand ist ein schmales Stück Schweiz, das ins deutsche Staatsgebiet hineinragt. Das muss man durchqueren, um von Inzlingen ohne Umweg nach Lörrach zu kommen. Nur ein paar Hundert Meter, aber eben ein doppelter Grenzübertritt.«
»Ach so.«
»Jedenfalls, ich sah ihn immer als eine Stütze der Gemeinde an, er war ziemlich aktiv. Bis vor etwa sechs Jahren.«
Klein horchte auf. Das war kurz nachdem er Viktor in Arosa kennengelernt und bald darauf sein erstes Seelengespräch mit ihm geführt hatte.
»Was war vor sechs Jahren?«
»Kennen Sie Anschel Fink?«, fragte Kletzki zurück.
»Sie meinen den Anwalt? Mit dem Viktor die Neue Mussar-Bewegung gründete?«
Klein hörte Kletzki leise schnauben.
»Die Neue Mussar-Bewegung. Genau die, ja.«
»Die habe ich immer als leicht exzentrisches, aber harmloses Experiment verstanden«, meinte Klein. »Ich glaube, sie hatte zu ihren besten Zeiten etwa zwei Mitglieder.«
Kletzki lachte bitter.
»Exzentrisch können Sie laut sagen. Was die Harmlosigkeit angeht – kommt drauf an, was man darunter versteht.«
»Können Sie sich etwas klarer ausdrücken?«
»Die Neue Mussar-Bewegung verstand sich als Speerspitze gegen Chabad Lubawitsch. Oder jedenfalls verstand Viktor Ehrenreich sie so. Und weil ich Chabad Lubawitsch angehöre, hat er alles zu torpedieren versucht, was ich aufgegleist habe. Zuerst waren das nur diffuse Vorwürfe: Dass wir ein Feelgood-Judentum verkaufen und den Leuten mit unserem Maschiach-Gerede, wie er es nannte, den Kopf verdrehen. Was so üblicherweise von denen gesagt wird, die Chabad nicht mögen. Aber später hat er begonnen, regelrechte Komplotte gegen uns zu schmieden. Er hat behauptet, ich hätte Gelder der Gemeinde veruntreut, um eine Chabad-Veranstaltung zu bezahlen.«
Klein schwieg. Viktor Ehrenreich war mit seiner Skepsis gegenüber Chabad bei Weitem nicht allein. Die Bewegung lebte von Spenden, versuchte, säkulare Juden wieder für die Religion zurückzuerobern, und sei es nur für einige Minuten oder Stunden. Sie hatte über die letzten vierzig Jahre weltweit viel Dynamik in jüdische Gemeinden getragen, zuweilen aber auch viel Streit, weil sich manche Gemeinden durch ihre hervorragend organisierten Aktivitäten mit Konkurrenz konfrontiert und in die Enge getrieben fühlten. Wenn der Rabbiner einer Gemeinde selbst der Bewegung angehörte, gab es zuweilen auch Ängste, er wolle seine Gemeinde ›auf Kurs‹ bringen. Das musste keine finanziellen Implikationen haben – aber offenbar hatte Viktor solche vermutet.
»Frau Ehrenreich ist nie mit solchem Moizi Schem ra hervorgetreten«, sagte Kletzki, nachdem er vergebens auf eine Reaktion von Klein gewartet hatte. »Aber offenbar hat sie die Ansichten ihres Mannes verinnerlicht. Wenn sie meine Frau und mich traf, hat sie immer weggeschaut. Es sei fern von mir, dass ich cholile einer Almune nicht meine Unterstützung anbieten würde, aber …«
Kletzkis Gesülze ging Klein auf die Nerven. Auch wenn er es übertrieben und respektlos fand, dass Sonja Kletzki als Ratte bezeichnete und nicht wusste, ob Viktors Anwürfe gegen ihn eine wahre Grundlage besaßen – viel hatte er nicht für ihn übrig. Wenn Bunem Kletzki beleidigt war und es nicht über sich brachte, Sonja anzurufen, dann sollte er dazu stehen und sich nicht in umständlichen Redeschleifen winden.
»Hören Sie, Reb Bunem«, unterbrach er ihn deshalb. »Ich habe eigentlich vor allem angerufen, um Sie zu fragen, ob es Ihnen recht ist, wenn ich den Hesped auf Viktor halte. Frau Ehrenreich hat mich ausdrücklich darum gebeten.«
Rabbiner Kletzki räusperte sich.
»Wie gesagt, fern sei es von mir, dass ich cholile einer Almune einen Wunsch verwehre, nur …«
»Das ist sehr großzügig von Ihnen«, fiel Klein ihm ins Wort. »Ich werde es Frau Ehrenreich ausrichten. Kol tuv.« Während er auflegte, hörte er Kletzki noch eine verdatterte Abschiedsformel stottern.
Wie immer, wenn Klein an der Welt und den Menschen verzweifelte, die sich und einander die Existenz zur Hölle machten, suchte er Halt bei seiner Frau Rivka. Sie war zwar in diesen Tagen auch etwas nervöser als sonst, was in erster Linie damit zusammenhing, dass Dafna, die ältere Tochter der Kleins, vor wenigen Wochen, nach Abschluss ihrer Matur, nach Jerusalem abgereist war, um dort ein Jahr in einer religiösen Lehrinstitution für junge Frauen zu verbringen. Sie war nur für ein Jahr gegangen, aber sowohl sie selbst als auch ihre Eltern hatten gespürt, dass sie kaum je wieder für längere Zeit heimkommen würde. Die ganzen letzten Schuljahre hindurch hatte sie davon geträumt, in Israel ihr Jüdischsein nicht mehr als »Extrawurst«, wie sie es zu nennen pflegte, zu leben, sondern als Teil einer großen jüdischen Gemeinschaft. Seit Dafna weg war, las Rivka täglich die englischen Newsseiten der israelischen Presse, befürchtete dauernd Kriegsausbrüche oder Terrorwellen und machte sich überhaupt Sorgen. Als Dafna vor zwei Tagen mit etwas belegter Stimme angerufen hatte, da hatte sie sofort erkannt, dass ihre Tochter Fieber hatte und das Bett hüten musste.
»Ein normales Virus«, sagte Dafna.
»Du musst zum Arzt.«
»Ach, Mami.«
»Sofort.«
»Ich hab jetzt echt nicht die Kraft aufzustehen und zum Arzt zu gehen.«
»So schwach bist du? Soll ich kommen?«
Das war das beste Argument, um Dafna dazu zu bewegen, einen Arzt aufzusuchen. Dessen Diagnose lautete: ein normales Virus.
Doch Rivka wusste sich von der Besorgnis um ihre Tochter, die sie in dieser zuweilen aufflammenden Heftigkeit selbst etwas zu überraschen schien, auch abzulenken. Sie arbeitete enthusiastisch an der Übersetzung eines Romans, den eine junge rumänische Autorin geschrieben hatte. Sie war besonders stolz, weil sie selbst dem Verlag das Buch vorgeschlagen hatte und dieser begeistert darauf eingestiegen war. Sie konnte während eines ganzen Essens nur über diesen Roman sprechen, und Klein schaffte es nicht immer, die erwartete Aufmerksamkeit aufzubringen.
Rivka hatte schon damals in Arosa erkannt, dass Sonja Ehrenreich psychisch labil war. »Sie ist angespannt wie eine Feder, die nächstens zu springen droht«, hatte sie Klein noch auf der Rückfahrt erklärt.
»Sonja hat mich gebeten, den Hesped auf Viktor zu halten«, sagte Klein nun, als beide sich zum Nachtisch noch eine Orange schälten.
»Du musst wirklich für alles herhalten.«
»Sie ist mit dem Rabbiner dort verkracht.«
»Warum verkracht sich nie jemand mit dir?«
Klein war nicht unglücklich, dass Sonja sein Angebot, eine Weile bei ihnen zu wohnen, ausgeschlagen hatte.
»Ich habe ihn halt schon auch etwas gekannt«, meinte er matt.
Rivka nahm seine Hand.
»Mein Geliebter. Mein einziger, geliebter Mann. Ich mache mir Sorgen um dich. Du lässt dich dauernd in neue Sachen reinziehen. Ich möchte, dass du auch mal zur Ruhe kommst.«
»Es ist ja nur eine kurze Rede«, meinte er, »einfach hundert Kilometer weiter weg als sonst.«
Sie hielt seine Hand weiter, festigte etwas den Griff.
»Ehrlich gesagt fürchte ich sehr, dass es bei dieser Rede nicht bleibt. Immer in den letzten Jahren, wenn du auch nur in die Nähe eines Gewaltverbrechens geraten bist, hat dich das mit voller Macht reingezogen. Und so was kannst du jetzt wirklich nicht brauchen.«
Er lächelte.
»Warum soll ich in irgendwas reingezogen werden? Das Verbrechen ist weder in unserer Gemeinde passiert noch war ich dabei, und so nahe war ich Viktor nun auch nicht, dass mich die Ermittlungen irgendwie betreffen würden.«
Rivka gab ihm einen Kuss, einen etwas zu flüchtigen, wie er fand. Der Duft der Orange hatte sich auf ihren Körper gelegt und weckte seine Lust.
Doch Rivka trug ungerührt die Teller und Gläser zum Abwasch, und Klein trottete ihr mit den Schüsseln nach. Während er die Sachen in die Spülmaschine räumte, tauchte vor seinem Geist wieder die Fotografie vom Mann mit dem Bowler Hat auf, die etwas deplatziert wirkend bei Ehrenreichs im Salon hing. Es überkam ihn eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte, und er eilte zu seinem Computer, um nachzuprüfen, ob seine Vermutung stimmte. Sie stimmte. Es fanden sich im Internet noch einige wenige andere Bilder von Israel Salanter, die der Vorstellung von einem osteuropäischen Rabbi des 19. Jahrhunderts eher entsprachen, aber auch ihm gefiel dasjenige, das Viktor aufgehängt hatte, bei dem die beiden verschiedenfarbigen Augen des Rabbi den Betrachter fast hypnotisch anschauten, am besten.
Rabbi Israel Salanter und seine Schüler. Das sind meine Leute, Herr Rabbiner Klein.
Die Mussar-Bewegung? Eine anspruchsvolle Schule.
Ja, genau das gefällt mir. Dienst am Oibersten durch tiefste Selbstprüfung. Du und deine freie Wahl gegen die Lust und den Trieb, dich über andere zu erheben. Du hast deine Selbstvervollkommnung in der eigenen Hand. Kein metaphysischer Hokuspokus. Kein Erlebnisjudentum. Kein Disneygott.
Disneygott! Sie gebrauchen vielleicht Worte!
Sie wissen, was ich meine. Allzeit wunderbereit.
Allmächtig nannte man das früher.
Gegen allmächtig hab ich nichts. Das Allmächtige hat auch Rabbi Israel beschäftigt. Aber von menschlicher Seite her gefällt mir am Mussar dieses nach innen Gewendete.
Und wie steht Ihre Frau dazu?
Meiner Frau gefällt, wenn ich schön den Schabbes halte, koscher esse und während der Nida-Zeit meine Hände von ihr lasse. Das tue ich zwar schon lange, seit bei ihr diese religiöse Umkehr eingesetzt hat. Aber nun habe ich wenigstens einen geistigen Überbau. Mussar eben.
Immer im Kampf gegen den bösen Trieb.
Sehen Sie, eigentlich ist es ganz einfach: Sie versuchen, das Ich mit dem Über-Ich in Übereinstimmung zu bringen und damit dem Es den Meister zu zeigen. Und das Über-Ich nennen Sie Gott.
Gott oder Sonja?
Vor Sonja nenne ich es Gott.
Ich glaube nicht, dass Rabbi Israel Salanter große Freude an Ihnen gehabt hätte. Der meinte immer Gott.
Ich bin am Anfang.
Über diesen Satz allerdings hätte sich Rabbi Israel gefreut.
Das wiederum freut mich. Und wissen Sie, wer mich überhaupt mit der Mussar-Bewegung bekannt gemacht hat? Ein Landsmann von Ihnen. Ebenfalls aus Zürich.
Keine Ahnung.
Anschel Fink. Sie kennen ihn, er war ja auch bei diesem Wochenende in Arosa. Wir sind in Kontakt geblieben.
Ein origineller Typ.
Hochintelligent.
Arbeitet als Anwalt in Zug, wenn ich mich nicht irre.
So ist es. Rohstoffsachen, viel Genaueres weiß ich auch nicht. Aber er hat mir gezeigt, dass du richtig religiös sein und dennoch mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität stehen kannst.
Das hätte ich für mich auch gerne in Anspruch genommen.
Rabbiner laufen außer Konkurrenz.
Berufsjuden, meinen Sie. Und Anschel Fink ist also auch ein Mussar-Vertreter?
Ja, und wie. Ich meine, der kennt ja auch die ganzen Schriften von Salanter und seinen Adepten. War jahrelang in der Jeschiwa. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich da eingeführt hat. Ich war schon kurz davor, alles fahren zu lassen. Diese Salbadereien von Kletzki und Konsorten, das kotzt einen ja nur noch an.
Herr Ehrenreich, nun wollen wir doch aber versuchen, in Richtung Tschuwa zu gehen. Es ist Anfang Elul. Deswegen sind Sie doch hier.
Sehen Sie, deswegen verehre ich Sie, Herr Rabbiner. Sie lassen sich nie von Ihren Emotionen forttragen.
Wenn Sie wüssten, Herr Ehrenreich, wenn Sie wüssten!