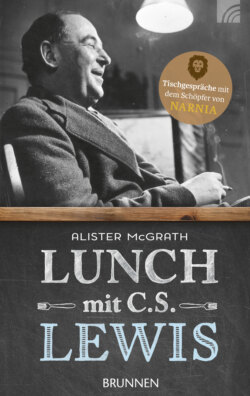Читать книгу Lunch mit C. S. Lewis - Alister McGrath - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Das große Panorama:
C. S. Lewis über den Sinn des Lebens
Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist – nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann.
C. S. Lewis, „Ist Theologie Dichtung?“, in: Das Gewicht der Herrlichkeit und andere Essays (Basel: Fontis – Brunnen Basel, 1982, 2005), 58.
Man kann sich leicht vorstellen, wie wir bei unserem ersten Lunch mit Lewis eintreffen und so viele Fragen im Kopf rumschwirren, dass wir kaum wissen, womit wir anfangen sollen. Aber vielleicht wäre das Erste, was Lewis herausstellen würde, dies: Die Sinnfrage ist entscheidend.
Um diese Tatsache zu unterstreichen, hätte Lewis vielleicht auf den Tisch gehauen, sodass das Besteck geklirrt hätte – und uns damit irritiert. Sollten wir hier nicht die Fragen stellen? Und nun fordert er uns zum Duell! Nun, vielleicht tut er das, weil ihm klar ist, wie wichtig es ist, diesem Thema den Stellenwert zu geben, der ihm zukommt: Priorität. Wir alle müssen unser Leben auf etwas gründen, das verlässlich, solide und sicher ist. Und bevor wir dieses Fundament nicht gefunden haben, können wir nicht wirklich anfangen zu leben. Um eine Unterscheidung zu bemühen, die Lewis in Pardon, ich bin Christ herausgearbeitet hat: Zwischen einfach existieren und wirklich leben besteht ein großer Unterschied.
Warum also ist die Frage nach dem Sinn entscheidend?
Menschen sind sinnsuchende Wesen. In uns allen steckt eine tiefe Sehnsucht, herauszufinden, worum es im Leben geht und was wir tun sollen. Der Student, der sich fragt, welches Fach er wählen soll; der Christ, der nach dem Willen Gottes sucht oder der Stammtischphilosoph, der nach dem Zweck seines Daseins in der Welt fragt – die meisten Menschen wünschen sich ein verlässliches Fundament für ihr Leben und stellen Fragen, die damit zusammenhängen. Warum lebe ich überhaupt? Worum geht es in diesem Leben? Was macht Leben eigentlich aus? In welcher Beziehung stehe ich zur physischen Welt und zu anderen Menschen? Gibt es einen Gott – und wenn ja, was ändert sich dadurch?
Wir brauchen alle eine bestimmte Brille, durch die wir die Wirklichkeit betrachten, um ihr einen Sinn zu geben. Haben wir die nicht, dann überfordert die Realität uns. Der Dichter T. S. Eliot betonte diesen Gedanken in einem seiner Gedichte. Die Menschen, so bemerkt er, „ertragen nicht sehr viel Wirklichkeit“. Wir müssen einen Weg finden, Schwerpunkte für unsere Wahrnehmung zu setzen oder die verschiedenen Fäden miteinander zu verweben, wenn wir ein Muster erkennen wollen. Finden wir diesen Weg nicht, erscheint uns alles chaotisch – verzerrt, unscharf und sinnlos.
Für den französischen Philosophen Jean-Paul Sartre, einen Atheist, der viele junge Intellektuelle in den 1960er-Jahren geprägt hat, war das Leben sinnlos, und er bemerkt, „dass wir hier sitzen, alle, wie wir hier sind, und essen und trinken, um unsere kostbare Existenz zu erhalten, und dass es nichts gibt, nichts, keinen Grund zu existieren.“1 Aber in einer Welt ohne Sinn zu leben ist hart. Was sollten wir dann hier?
Wenn wir einen Sinn und eine Zielrichtung für unser Leben erkennen, hilft uns das, auch Zeiten durchzustehen, in denen wir orientierungslos sind und Schwierigkeiten zu meistern haben. Diesen Zusammenhang hat Viktor Frankl betont. Frankl hat während des Zweiten Weltkriegs die Konzentrationslager der Nazis erlebt und aus diesen Erfahrungen heraus nachgewiesen, wie wichtig es gerade in traumatischen Situationen ist, einen Sinn zu erkennen.2 Er stellte fest, dass die Überlebenschancen im Lager davon abhingen, ob jemand überleben wollte, und dies wiederum beruhte auf der Fähigkeit, selbst in der aussichtslosen Situation einen Sinn und Zweck für das eigene Leben zu finden. Am besten haben die Menschen die scheinbar aussichtslose Situation bewältigt, die an einem „Willen zum Sinn“ festhielten, der es ihnen ermöglichte, ihre Erfahrungen als sinnvoll zu deuten.
Frankl vertrat die These: Wenn wir Ereignissen und Situationen keinen Sinn abgewinnen können, sind wir unfähig, mit der Realität fertigzuwerden. Er zitierte Friedrich Nietzsche: „Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie.“ Wir brauchen sozusagen eine geistige Landkarte der Wirklichkeit, die es uns erlaubt, unseren Platz darin zu ermitteln und die Richtung unseres Lebenswegs zu bestimmen. Wir brauchen ein Objektiv, das die grundlegenden Fragen über das Wesen des Menschen, der Welt und Gott in den Brennpunkt rückt.
Die jüngere Traumaforschung betont, wie wichtig ein „Sinn für Kohärenz“3 als Bewältigungsstrategie für anscheinend sinnlose oder irrationale Ereignisse ist, besonders, wenn diese leidvoll sind.4 Mit anderen Worten: Am besten kommen Menschen zurecht, die fähig sind, hinter die Oberfläche einer scheinbar zufälligen und sinnlosen Welt zu sehen und die tiefere Struktur der Wirklichkeit zu erfassen. Der große Harvard-Psychologe William James hat schon vor etlichen Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass dies der Kern jedes religiösen Glaubens ist. James zufolge brauchen wir einen „Glauben an die Existenz irgendeiner unsichtbaren Ordnung, in der sich die Rätsel der natürlichen Ordnung wiederfinden und erklären lassen“.5
Natürlich werden einige hier einwenden, dass jede Suche nach einem Sinn zwangsläufig in die Irre geht. Es gibt nichts zu finden, also braucht man auch nicht zu suchen. Richard Dawkins, der nach eigener bescheidener Aussage berühmteste und anerkannteste Atheist der Welt, beharrt darauf, dass hinter dem Universum „kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit“.6 Wir können einen Sinn erfinden, um uns selbst zu trösten, aber es gibt kein „Großes Ganzes“. All das ist eine Täuschung, etwas, das wir selbst erfunden haben.
Diese Sicht der Welt habe ich als Jugendlicher selbst geteilt. Menschen, die an Gott glaubten, hielt ich für verrückt, verrucht oder verzweifelt. Und darüber war ich natürlich hoch erhaben! Mein Atheismus war ein Akt der Auflehnung, mit dem ich mein Recht geltend machte, zu glauben was ich wollte. Zugegebenermaßen war diese Weltsicht ein wenig öde. Aber wenn kümmerte das schon? Sie mochte streng sein, um nicht zu sagen trostlos, aber sie war richtig! Und die Tatsache, dass sie mir nichts einbrachte, war geradezu der Beweis dafür, dass ich sie deshalb angenommen hatte, weil sie wahr war, nicht, weil sie etwa attraktiv oder zweckdienlich gewesen wäre. Dennoch gab es da in mir eine leise Stimme, die flüsterte: Ist es wirklich so einfach? Was, wenn es im Leben doch mehr gibt als das?
Lewis hat mir nicht geholfen, mich von dieser öden und unlebendigen Weltsicht zu befreien. Aber in einem entscheidenden Punkt half er mir doch, als ich 1974 begann, seine Schriften zu lesen. Er ermöglichte es mir, zu benennen, was ich am Atheismus bemängelte. Er half mir, ein wildes Durcheinander von Einsichten und intuitiven Erkenntnissen in Worte zu fassen. Und als ich später darum rang, meinen Weg und meinen Platz in der Welt des christlichen Glaubens zu finden, wurde er rasch mein inoffizieller Mentor. Ich war ihm nie begegnet, und doch wurden seine Worte und seine Weisheit mir wichtig – und sind es bis heute. Ich hätte ihn in der Tat sehr gern einmal zum Lunch getroffen, weniger, um ihn mit Fragen zu bombardieren, sondern vor allem, um ihm dafür zu danken, dass er mir geholfen hatte, im Glauben zu wachsen.
Jetzt ist es an der Zeit, C. S. Lewis selbst ins Gespräch zu bringen. Lewis war als junger Mann Atheist. Nach und nach kam er zu der Überzeugung, dass der Atheismus intellektuell verwundbar und existenziell unbefriedigend war. Finden wir heraus, warum. Nehmen wir an, bei unserem Lunch-Treffen mit ihm fragt jemand, wie es kam, dass er schließlich einen Sinn im Leben fand – oder, in seinem Fall, wie er Christ wurde. Was würde er antworten?
Lewis’ Zweifel an seinem „glatten und platten Rationalismus“
Mit sechzehn war Lewis überzeugter Atheist. Er war sich sicher, dass die führenden Wissenschaftler in den Jahren nach 1910 die Religion wegerklärt hatten. Die beste Forschung der Zeit hatte erwiesen, dass Religion nichts anderes war als ein primitiver menschlicher Instinkt. Diese Forschung schien zu sagen: „Wir sind jetzt erwachsen und brauchen so etwas nicht mehr.“ Ein Glaube an Gott war einfach nicht mehr ernst zu nehmen.
Lewis’ Auffassung wurde erhärtet durch das Leid und die Gewalt, die er als Soldat in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs erlebte. Im Sommer 1917 hatte er in Oxford in einem Offizierskadetten-Bataillon die Grundausbildung absolviert und wurde dann als Offizier der Somerset Light Infantery nach Nordfrankreich kommandiert. Was er dort an Leid und Zerstörung sah, überzeugte ihn, dass das Leben sinnlos ist und es keinen Gott gibt.
Die Kriegserfahrungen hatten in Lewis einen Zorn auf Gott hinterlassen – obwohl er doch glaubte, dass es diesen Gott nicht gab, auf den er zornig sein könnte. Wie so viele desillusionierte und zynische junge Männer brauchte Lewis jemanden, den er hassen und für alle Übel der Welt verantwortlich machen konnte. Und wie viele andere vor und nach ihm machte er Gott für alles verantwortlich. Wie konnte Gott es wagen, ihn zu erschaffen – ohne seine Einwilligung!7 Aber sein Atheismus bot ihm keinen „Sinnrahmen“, der die Verwüstungen und die Qual erklärt hätte, die der Krieg hinterlassen hatte. Und er musste sich einer unbequemen Tatsache stellen: Wenn es keinen Gott gab, waren es die Menschen, denen man die Schrecken des Krieges zur Last legen musste. Lewis scheint allmählich erfasst zu haben, dass die Gewalt und Brutalität des Krieges nicht nur Fragen an den christlichen Glauben stellten, sondern ebenso an einen gottlosen Humanismus. Sein „feindseliger und tödlicher“ Atheismus konnte seinem Kriegstrauma keinen Sinn verleihen, und noch weniger half er ihm, es zu bewältigen.8
Die Literatur über den Ersten Weltkrieg und seine Folgen betont die physischen und psychischen Schäden, die er in den Soldaten hinterließ, im Krieg und auch nach der Heimkehr. Die Irrationalität des Krieges stellte jeden Glauben daran infrage, dass es einen Sinn im Universum oder in der individuellen Existenz geben könnte. Viele Studenten, die nach dem Krieg nach Oxford zurückkamen, hatten erhebliche Schwierigkeiten, wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Nervenzusammenbrüche waren an der Tagesordnung.
Lewis selbst erwähnt den Krieg kaum. Er scheint sein Leben in verschiedene Bereiche „aufgespalten“ zu haben, um sich seine geistige Gesundheit zu bewahren. Die Literatur – vor allem die Dichtung – wurde sein Schutzwall. Sie half ihm, die chaotische und sinnlose Welt auf sicherer Distanz zu halten und schirmte ihn von der existenziellen Verwüstung ab, die andere erlitten.
Dass Lewis in den 1920er-Jahren am Atheismus festhielt, gründete sich auf seine Überzeugung, dass diese Weltsicht richtig war, eine heilsame Härte, wenn er auch zugeben musste, dass sie nur eine Sicht der Welt ermöglichte, die „grob und töricht“9 war. Aber die intellektuelle Aufrichtigkeit des Atheismus wöge schwerer als seine emotionale und existenzielle Unzulänglichkeit. Für Lewis war der Atheismus weder befreiend noch verlockend; wie es scheint, hat er ihn ohne Begeisterung einfach deshalb akzeptiert, weil er ihm als einzige intellektuelle Option für einen denkenden Menschen erschien – eine zwangsläufige Position, ohne besondere Vorzüge oder Attraktivität.
In den 1920ern überdachte Lewis seine Haltung gegenüber dem Christentum. Ausführlich erzählt er die Geschichte seiner Rückkehr zu dem Glauben, von dem er sich schon als Junge abgewandt hatte, in seiner Autobiografie Überrascht von Freude. Seine Auseinandersetzung mit den Hinweisen auf Gott, die er im menschlichen Verstand und in der Erfahrung fand, führte ihn schließlich zur Entscheidung, dass die intellektuelle Redlichkeit ihm gebot, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Eigentlich wollte er es gar nicht; er hatte jedoch den Eindruck, ihm bliebe keine andere Wahl.
In Überrascht von Freude berichtet Lewis, wie er diese Annäherung an Gott erlebte, und vergleicht sie mit einem Schachspiel. Jeden Zug, den er machte, um sich zu verteidigen, konterte Gott mit einem besseren Gegenzug. Seine Argumente gegen den Glauben erschienen ihm zunehmend unzureichend und nicht zwingend, bis er schließlich glaubte, keine andere Option mehr zu haben, als zuzugeben, dass Gott Wirklichkeit war und so „der vielleicht niedergeschlagenste und widerwilligste Bekehrte in ganz England“ wurde.
Was brachte Lewis also dazu, seine Meinung zu ändern? Wie wurde aus einem hartgesottenen dogmatischen Atheisten einer der größten Apologeten des Christentums im 20. Jahrhundert und darüber hinaus? Und was können wir daraus lernen? Beginnen wir mit einem Blick darauf, wie Lewis’ Ernüchterung im Blick auf den Atheismus begann und wohin sie ihn führte.
Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass diese Ernüchterung in den frühen 1920ern begann. Zum einen spürte er, dass der Atheismus der Vorstellungskraft wenig zu bieten hatte. Lewis ging allmählich auf, dass der Atheismus die tiefste Sehnsucht seines Herzens und seiner Intuition nicht zufriedenstellte – und es auch nicht konnte, nämlich das Verlangen, dass es im Leben mehr gäbe als das, was vor Augen lag. In einer berühmten Passage aus Überrascht von Freude formuliert er es so:
Die beiden Hemisphären meines Verstandes standen im schärfsten Gegensatz zueinander. Auf der einen Seite lag ein Ozean der Dichtung und der Mythen mit unzähligen Inseln; auf der andern ein glatter und platter „Rationalismus“. Fast alles, was ich liebte, hielt ich für imaginär; fast alles, was ich für real hielt, empfand ich als feindselig und sinnlos.10
Was meinte er damit? Zunächst einmal gibt er mit diesen Worten seiner wachsenden Unzufriedenheit mit der vereinfachenden Darstellung der Dinge Ausdruck, die der Atheismus ihm bot. Sein „glatter und platter Rationalismus“ umging die tiefen Fragen des Lebens und bot nur oberflächliche Antworten. Der Atheismus war existenziell bedeutungslos, denn er hatte zu den tiefsten Fragen des menschlichen Geistes und dem Verlangen des menschlichen Herzens nichts zu sagen. Seichte, oberflächliche und unwichtige Dinge lassen sich beweisen. Aber das, was wirklich zählt – die Wahrheiten, von denen wir leben, seien sie nun politisch, moralisch oder religiös – lassen sich nicht in gleicher Weise beweisen.
Allmählich gestand Lewis sich ein, dass er sich in einer Art rationalistischem Käfig oder Gefängnis hatte festsetzen lassen. Er hatte die Wirklichkeit auf das begrenzt, was der Verstand beweisen konnte. Aber, so wurde ihm klar, der Verstand vermochte nicht einmal zu beweisen, dass auf ihn Verlass war. Warum nicht? Weil wir dann den Verstand benutzen würden, um den Verstand zu beurteilen. Der menschliche Verstand wäre Richter und Beklagter zugleich! Später hat Lewis es einmal so formuliert: „Wenn der Maßstab nicht unabhängig ist vom zu messenden Gegenstand, dann können wir nicht messen.“11
Aber wenn es nun doch etwas jenseits der Reichweite des menschlichen Verstandes gab? Und wenn diese größere Welt Hinweise für ihre Existenz in unserer Welt hinterlassen hätte? Was, wenn ein Bogenschütze aus jener größeren Welt Pfeile in die unsrige schösse, die uns auf die andere Welt aufmerksam machten? Lewis wandte sich dem Gedanken zu, dass die äußere Welt ebenso wie unsere Erfahrungen voller „Hinweise“ auf den Sinn des Universums steckten.
Und diese Hinweise verwiesen auf eine Welt jenseits der Grenzen des Verstandes. Ein paar Takte ihrer Musik hören wir vielleicht in den stillen Momenten des Lebens. Oder wir spüren sie in einem Duft, den ein Lufthauch an einem kühlen Abend uns zuweht. Oder wir hören die Geschichten anderer, die dieses Land bereits entdeckt haben und von ihren Abenteuern berichten. All diese „Signale der Transzendenz“ – eine Formulierung des amerikanischen Soziologen Peter Berger – helfen uns zu erkennen, dass unsere Existenz mehr umfasst als nur unsere Alltagserfahrung. Schon vor langer Zeit hat der große britische Apologet G. K. Chesterton (den Lewis sehr verehrte) dargelegt, dass die menschliche Vorstellungskraft die Grenzen des Verstandes überwindet, um ihr wahres Ziel zu finden. „Jeder wahre Künstler“, sagt er, fühle, „dass er an transzendente Wahrheiten rührt; dass seine Bilder Schatten der Dinge hinter einem Schleier sind.“12
Die Bedeutung der Intuition
Neben dem kühlen Denker Lewis finden wir einen Denker ganz anderer Art – einen Mann, der um die Macht der Imagination wusste und darum, was sie für unser Verständnis der Wirklichkeit bedeutet. Vielleicht einer der originärsten Aspekte von Lewis’ Werk ist es, dass er immer wieder und sehr wirksam an die religiöse Vorstellungskraft appelliert. Lewis wusste um bestimmte tiefe Emotionen und intuitive Erkenntnisse, die auf eine reiche und bereichernde Dimension unserer Existenz jenseits von Raum und Zeit hindeuteten. Es gibt, sagt er, ein tiefes und intensives Gefühl der Sehnsucht im Menschen, das kein irdisches Objekt und keine irdische Erfahrung stillen kann.
Lewis nannte dieses Empfinden „Freude“ und glaubte, es weise uns auf Gott als Quelle und letztes Ziel dieses Verlangens hin. Gott schießt „Pfeile der Freude“ in unser Herz, um uns aus einem vereinfachenden Atheismus oder trägen Agnostizismus aufzuwecken und uns zu helfen, nach Hause zu finden.
In einer bemerkenswerten Predigt unter dem Titel „Das Gewicht der Herrlichkeit“, die er im Juni 1941 in Oxford hielt, sprach Lewis davon, „dass wir ein Verlangen in uns tragen, das durch kein natürliches Glück gestillt werden kann“, einen „Wunsch, umherirrend und das Ziel noch nicht kennend und immer noch unfähig, es in der Richtung zu suchen, in der es liegt“. Im menschlichen Verlangen liege etwas Selbstzerstörerisches, denn wenn wir das, was wir ersehnen, schließlich bekommen, scheint es das Verlangen dennoch nicht zu stillen. Diese Tatsache verdeutlicht Lewis am Beispiel des uralten Menschheitsstrebens nach der Schönheit. „Die Bücher oder die Musik, in denen wir die Schönheit vermuteten, werden uns verraten, wenn wir unser Vertrauen in sie setzen; sie war nicht in ihnen, sie kam nur durch sie, und was durch sie kam, war Sehnsucht.“13 Menschliche Sehnsucht, das bittersüße Verlangen nach etwas, das uns erfüllt, weist auf etwas jenseits dieser Objekte. Es verweist den Menschen auf sein eigentliches Ziel und seine Erfüllung in Gott.
Der Atheismus musste solche Empfindungen und intuitiven Erkenntnisse als illusionären Unsinn abtun. Und eine Zeit lang tat Lewis das auch. Dann ging ihm auf, wie lächerlich das war. Er hatte sich festgefahren in einer Weise die Dinge zu betrachten, die ihn daran hinderte, ihre wahre Bedeutung zu erfassen. Nun begann er, seiner Intuition zu trauen und zu erforschen, wo sie ihn hinführen würde. Es gab, so erkannte er schließlich, ein „Gesamtbild“, in dem das Leben sinnvoll war. Man nannte es Christentum.
Das „große Ganze“: Eine neue Sicht der Dinge
Säßen wir jetzt mit Lewis beim Lunch, würde er ganz sicher ein paar wunderbare Aussagen von sich geben, die wir mitnehmen und im Nachhinein verkosten würden. Wir würden sie im Geist bewegen, bis wir sicher sind, dass wir sie in ihrer ganzen Tiefe und Brillanz erfasst haben. Dies könnte eine solche Aussage sein: „Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist – nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann.“14
Worauf zielt Lewis hier ab? Im Grunde genommen fasst er hier einen der wichtigsten Gründe dafür in Worte, dass er Christ wurde. Der christliche Glaube war für ihn zum Objektiv geworden, durch das er die Dinge scharf sehen konnte. Es war, als schalte man das Licht ein und könne zum ersten Mal alles so sehen, wie es ist. Dieses eindrucksvolle Bild der aufgehenden Sonne, die eine dunkle Landschaft erhellt, fasst Lewis’ Grundüberzeugung zusammen, dass das Christentum das große Ganze der Welt darzustellen vermag – und zwar viel besser als der Atheismus, den er früher vertreten hatte.
Lewis stellte fest, dass Wahrheit darin besteht, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und ihre tiefe wechselseitige Abhängigkeit zu begreifen. Sie hat es mit etwas zu tun, das wir eher „sehen“ als logisch formulieren. Für Lewis bietet der christliche Glaube ein Instrument, die Dinge zu sehen – so, wie sie wirklich sind, trotz ihrer äußeren Erscheinung. Das Christentum bietet uns einen intellektuell weiträumigen und auch die Vorstellungskraft befriedigenden Weg, die Dinge zu betrachten und ihre Verbundenheit zu begreifen, selbst wenn es uns schwerfällt, dies genau in Worte zu fassen.
Lewis’ starker Glaube an die Vernünftigkeit des christlichen Glaubens beruht selbst auf seiner eigenen sehr besonderen Weise, die Vernünftigkeit der geschaffenen Welt und ihrer letzten Verankerung in Gott zu sehen. Mit dem eindrucksvollen Bild lädt er uns ein, Gott in doppelter Weise zu sehen: als den Grund für die Vernünftigkeit der Welt und zugleich als den, der es uns ermöglicht, diese Vernünftigkeit zu erfassen. Lewis hilft uns, die Tatsache zu würdigen, dass das Christentum uns einen Standpunkt anbietet, von dem aus wir die Dinge untersuchen und ihren inneren Zusammenhang ergründen können. Wir können sehen, wie alles zusammenhängt.
Diese grundlegende Vorstellung findet sich in einem der großen literarischen Werke des Mittelalters – in Dantes Göttlicher Komödie, geschrieben im vierzehnten Jahrhundert, ein Werk, das Lewis liebte. Der große Florenzer Dichter und Theologe verleiht darin der Vorstellung Ausdruck, dass das Christentum uns eine umfassende Sicht auf die Dinge anbietet – etwas Wundervolles, das man sehen, aber nur schwer in Worte fassen kann.
Und tiefer, größer war mein Schau’n fortan,
Dass solchen Blick die Sprache nicht bekunden,
Nicht die Erinnerung ihn fassen kann.15
G. K. Chesterton hat herausgearbeitet, wie eine verlässliche Theorie es uns erlaubt, die Dinge so zu sehen, wie sie sind: „Wir setzen uns eine Theorie auf wie einen Zauberhut, und die Geschichte wird durchsichtig wie ein Glashaus.“16 Für Chesterton bemisst sich der Wert einer Theorie an dem Ausmaß an Erhellung, die sie bietet, und an ihrer Fähigkeit, dem, was wir in der Welt, die uns umgibt, sehen und in uns selbst erfahren, Rechnung zu tragen. „Haben wir diese Idee einmal in unserem Kopf, so werden eine Million Dinge transparent, als habe man dahinter eine Lampe angezündet.“17 Und genauso bestätige sich auch das Christentum, weil es über die Fähigkeit verfüge, unsere Beobachtung der Welt sinnvoll zu erklären. „Die Erscheinung beweist nicht die Religion, sondern die Religion erklärt die Erscheinung.“18
Lewis verwendet ein beachtlich weites Spektrum von Metaphern, die es mit dem Sehen zu tun haben – etwa Sonne, Licht, Blindheit und Schatten –, um uns zu zeigen, auf welche Weise wir die Dinge wirklich verstehen können. Das hat zwei wichtige Konsequenzen. Zum einen bedeutet es, dass für Lewis Verstand und Imagination sich gegenseitig ergänzen und zusammenarbeiten und nicht gegeneinanderstehen. Und zweitens führt es dazu, dass Lewis in seiner Apologetik ausführlichen Gebrauch von Analogien macht, um es uns möglich zu machen, die Dinge auf neue Weise zu sehen. In seiner berühmten Verteidigung der Trinitätslehre in Pardon, ich bin Christ vermutet er beispielsweise, dass unsere Schwierigkeiten mit dieser Vorstellung darin begründet sind, dass wir sie nicht richtig sehen. Würden wir mit anderen Vorstellungen an die Trinitätslehre herangehen – etwa als Bewohner einer zweidimensionalen Welt, die versuchen, die Struktur einer dreidimensionalen Wirklichkeit zu beschreiben –, dann begännen wir etwas davon zu begreifen, warum diese Vorstellung außerordentlich sinnvoll ist. „Versuchen Sie, die Dinge einmal so zu sehen!“
Lewis versucht nicht, die Existenz Gottes allein mit rationalen Gründen zu beweisen. Seine Herangehensweise ist viel interessanter. Statt ein Argument für die Existenz Gottes abzufeuern, lädt er uns ein, erst einmal hinzusehen, welche unserer Beobachtungen in der uns umgebenden Welt und in unserer Erfahrung mit der christlichen Weltsicht übereinstimmt. Lewis’ Genius als Apologet – den wir später noch genauer untersuchen werden – lag in seiner Fähigkeit, aufzuzeigen, inwiefern eine christliche Perspektive die allgemeine Lebenserfahrung auf befriedigendere Weise zu erklären vermag als ihre Rivalen, insbesondere der Atheismus, dem er einmal selbst eifrig das Wort geredet hatte.
In all seinen apologetischen Schriften appelliert Lewis an eine gemeinsame menschliche Erfahrung und Beobachtung. Wie erklären wir uns das, was wir in uns erfahren oder um uns herum beobachten? Lewis gelangte zu der Erkenntnis, dass die christliche Sicht der Welt die Dinge viel besser einzuordnen vermag als ihre Alternativen.
Die Dinge richtig einordnen: Die Sache mit der Sehnsucht
Sehen wir uns ein Beispiel dafür an – Lewis’ „Sehnsuchtsbeweis“. Dabei geht es nicht um einen Beweis im strengen Sinn. Vielmehr dreht es sich darum, wahrzunehmen, wie Theorie und Beobachtung zusammenpassen. Es ist ein wenig so, wie wenn man anprobiert, ob ein Hut oder ein Hemd passen und sich dabei im Spiegel beobachtet. Wie viele Beobachtungen der Welt stehen im Einklang mit einer Theorie, und wie überzeugend ist diese Übereinstimmung? Lewis’ „Sehnsuchtsbeweis“ fordert uns auf, uns klarzumachen, wie leicht und selbstverständlich sich unsere Erfahrungen von Sehnsucht in den Rahmen einer christlichen Weltsicht einfügen.
Wir haben bereits gesehen, dass Lewis davon ausgeht, dass wir Wünsche und Sehnsüchte haben, die nichts in dieser Welt befriedigen kann. Wie sollen wir diese Tatsache erklären? Lewis bietet drei mögliche Erklärungen an:
Erstens: Wir sind nie zufrieden, weil wir in dieser Welt nach den falschen Dingen streben. Unsere Lösung: Wir müssen das Spektrum unserer Suche erweitern! Dann werden wir schließlich doch über etwas stolpern, das uns wirklich glücklich macht. Diese Haltung, meint Lewis, führt allerdings nur zu einer langen und hoffnungslosen Suche nach etwas, was wir nie finden.
Zweitens: Wir geben die Suche überhaupt auf in der verzweifelten Überzeugung, dass es nichts gibt, das die Sehnsucht in uns stillt. Warum also weitersuchen? Geben wir’s besser auf.
Aber Lewis ist überzeugt, dass es eine dritte Antwort gibt – eine, die mit seiner eigenen Erfahrung zusammenklingt. Wenn wir unsere Sehnsüchte durch die Brille des christlichen Glaubens ansehen, erkennen wir, dass sie genau das sind, was wir erwarten sollten, wenn das Christentum wahr ist. Das Christentum sagt uns, dass diese Welt nicht unsere wahre Heimat ist und dass wir für den Himmel erschaffen wurden. „Wenn ich aber in meinem Innern ein Verlangen spüre, das durch kein Erlebnis in dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür die, dass ich für eine andere Welt gemacht bin.“19
Lewis’ expliziter Appell an die Vernunft ist zugleich ein impliziter Appell an die Vorstellungskraft. Vielleicht erklärt uns das die Tatsache, dass Lewis moderne Leser ebenso anspricht wie postmoderne. Lewis schenkt uns eine Perspektive auf die Welt, die den tiefen Graben zwischen Moderne und Postmoderne überbrückt. Jede dieser Perspektiven hat ihre Stärken, denn beide sind Teil eines größeren Ganzen. Ihre Schwächen treten aber dort zutage, wo sie vorgeben, ein vollständiges Bild zu bieten, wo sie doch in Wirklichkeit nur einen Teil des Ganzen darstellen. Erst, wenn wir tatsächlich das „Große Ganze“ sehen, erscheinen auch die beiden Perspektiven im richtigen Licht.
Lewis wandte sich unter anderem deshalb dem Christentum zu, weil es ihm half, einen Sinn in seinem Leben zu erkennen. Leben bedeutet mehr als Zusammenhänge zu erkennen; es geht darum, mit Uneindeutigkeit und Verwirrung zurechtzukommen und etwas zu finden, wofür sich das Leben lohnt und das uns Richtung und Sinn angibt.
Das Panorama und die Schnappschüsse
Wie also half das Christentum Lewis, einen Sinn zu entdecken? Ein Schritt dazu war, dass er erkannte, dass es ein „Gesamtbild“ gibt, das den „kleinen Bildern“ einen Sinn verleiht. Oder, um das Bild leicht zu variieren: Es gibt ein Panorama, in das die Schnappschüsse sich einordnen lassen. Lewis selbst verwendet dieses Bild nicht, aber es eignet sich gut, um seinen Grundansatz zu verdeutlichen. Lewis erklärte die Bedeutung eines solchen „Gesamtbilds“ 1936 im Rahmen von Überlegungen zur Literatur des Mittelalters – wie etwa Dantes berühmter Göttlicher Komödie. Dieses Werk biete eine überzeugende imaginative Sicht einer einheitlichen Ordnung von Kosmos und Welt. Werke wie die Göttliche Komödie spiegelten eine „Einheit höchster Ordnung“ wider, denn es gelinge ihnen, „der größtmöglichen Verschiedenheit von untergeordneten Einzelheiten“ Rechnung zu tragen.20 Lewis’ Sprache ist hier technisch und präzise. Es gibt eine bestimmte Weise, die Dinge zu sehen, die sie klar konturiert ins Blickfeld rückt, die Schatten erhellt und uns die zugrunde liegende Einheit sehen lässt. Das ist für Lewis eine „erkennende Vorstellungskraft“ – eine Weise, die Realität zu sehen oder „abzubilden“, die dem gerecht wird, wie die Dinge tatsächlich sind.21
Um zu würdigen, worum es Lewis hier geht, müssen wir diese Vorstellung ein wenig entfalten. Seine Grundidee ist die: Das Christentum bietet uns eine Sicht auf die Wirklichkeit, die im Wesentlichen zwei Dinge leistet. Erstens erklärt es die Welt nicht für sinn- und zwecklos oder chaotisch. Die Wirklichkeit mag uns verschwommen und verzerrt erscheinen, sodass wir keine Ordnung darin erkennen können. Aber das liegt dann daran, dass wir ein Objektiv brauchen, das es uns erlaubt, klarer zu sehen. Ein solches Objektiv ist das Christentum für Lewis. Oder, um ein anderes Bild zu verwenden: Statt einfach nur Lärm zu hören, hören wir jetzt eine Melodie.
Zweitens sagt Lewis: Das „Gesamtbild“ hilft uns auch, den Sinn der kleinen Einzelheiten zu erkennen – etwa den unseres eigenen Lebens. Und zwar, indem wir die Einzelheiten in das Gesamtbild einordnen. Wir selbst gehören in das Bild hinein. Ohne uns ist das Bild nicht vollständig. Wir erkennen, dass die uns vertraute Welt als Reflexion von etwas Dauerhafterem und Beständigerem verstanden werden muss. Wenn wir uns diese umfassendere Perspektive auf die Dinge zu eigen machen, verstehen wir auch unsere Welt – und uns selbst – besser.
Mit dieser Vorstellung befand sich Lewis in guter Gesellschaft. Auch die Autorin Dorothy L. Sayers hatte bemerkt, wie auffällig gut der christliche Glaube die Welt zu erklären vermag, und sie sah darin ein klares Zeichen für seine Wahrheit. Der christliche Glaube, so schrieb sie an eine Kollegin, „scheint die einzige Erklärung des Universums zu bieten, die intellektuell zufriedenstellend ist“.22 Tatsächlich zog dieser Aspekt des Christentums Sayers so an, dass sie sich fragte, ob sie sich „in ein intellektuelles Modell verliebt habe“.23 Im Gegensatz zu ihr sah Lewis in der Tatsache, dass das Christentum die Welt sinnvoll zu erklären vermag, einen Teil seiner Attraktivität. Es gab auch noch andere Vorteile – nicht zuletzt den Umstand, dass das Christentum seine Vorstellungskraft anregte und seine Beschäftigung mit dem Thema Schönheit bereicherte.
Inwiefern war das wichtig? Das lässt sich vielleicht am besten durch einen Vergleich zwischen C. S. Lewis und Richard Dawkins erklären. Für Dawkins gibt es im Universum weder Sinn noch Zweck. Und auch kein Konzept von Güte oder Tugend. Aber das hindert uns nicht daran, Vorstellungen von Sinn und Tugend zu erfinden. Damit gründen wir unser Leben allerdings auf unsere eigene Fantasie. Wir tun so, als hätte das Leben einen Sinn oder als gäbe es bestimmte verlässliche moralische Werte. Aber wir wissen zutiefst, dass all dies eben nur unsere eigene Erfindung ist, etwas, das wir geschaffen haben, um das Leben besser zu meistern und seinen Rätseln und Schmerzen standhalten zu können.
Lewis bietet uns einen ganz anderen Ansatz. Das Leben hat einen Sinn. Im Universum gibt es eine tiefere moralische Ordnung. Sobald wir beides erst einmal entdeckt haben, können wir unser Leben darauf gründen. Wir erfinden Tugend und Sinn nicht, wir finden beides und nehmen es wahr. Lewis entdeckte Gott als den, der Sinn und Moralität sowohl enthüllt als auch gewährleistet. Wir sind aufgerufen zu einer neuen Sicht auf die Wirklichkeit – nicht, weil jemand uns diese Sicht aufzwingt, sondern weil wir sie entdeckt und als zutreffend und vertrauenswürdig erkannt haben.
Wenn wir unser Leben auf diesen Sinn gründen, verändert das unsere Perspektive. Schon G. K. Chesterton hatte festgestellt, es mache das Leben interessanter, wenn man um einen tieferen Sinn im Leben wisse: „Im Dschungel des Skeptizismus findet man keine Bedeutungen; wandelt man aber durch einen Hain von Gedankengebäuden und Plan; wird man immer mehr Bedeutungen entdecken. Hier zieht alles eine Geschichte hinter sich her.“24
Einen Sinn zu erkennen, macht unser Leben nicht nur interessant. Es verleiht ihm auch eine Bedeutung. Wir sind nicht länger bloße Beobachter. Wir haben vielmehr eine Rolle zu spielen, und sie zu spielen, ist keine Option, sondern eine Verpflichtung. Am Ende von „Das Gewicht der Herrlichkeit“ erwähnt Lewis auch, dass ein Sinn in unserem Leben auch eine belastende Seite hat. Unsere zukünftige Herrlichkeit (und die unserer Nächsten) sollte die Weise beeinflussen, wie wir heute unser Leben gestalten.
Die Last, das Gewicht oder die Bürde der Herrlichkeit meines Nächsten sollte sich täglich auf meinen Rücken legen … Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Wir haben nie mit bloßen Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen, Künste und Zivilisationen sind sterblich – ihr Leben ist gegenüber dem unseren wie das Leben einer Mücke. Aber es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, die wir kurz abfertigen und ausbeuten – unsterbliche Schrecken oder ewig währender Glanz. … Auch unsere Nächstenliebe muss wirklich opferbereite Liebe sein, mit einem tiefen Empfinden für die Sünde, deren ungeachtet wir den Sünder lieben … Neben dem Heiligen Sakrament ist unser Nächster das Heiligste, was sich uns in den Weg stellt.25
Dies ist eine gänzlich andere Perspektive als das selbstsüchtige „Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot“ – eine Haltung, die in der Welt heute so verbreitet ist. Aber unter anderem diese Perspektive ist der Grund dafür, warum so viele soziale Initiativen, gemeinnützige Organisationen oder Krankenhäuser sich auf christliche Wurzeln berufen. Die Sinnfrage ist entscheidend. Wenn wir auf die Frage, worum es im Leben geht, eine angemessene Antwort finden, richtet sich unser ganzes Leben danach aus und sie wendet unseren Blick von uns weg nach außen.
Es gäbe in diesem Zusammenhang noch viel mehr zu sagen, und auf manches kommen wir später noch zurück. Aber für ein erstes Lunchtreffen soll dies erst einmal genügen. Unterbrechen wir also unser Gespräch und bereiten wir uns auf die nächste Begegnung mit Lewis vor. Dann werden wir über die Bedeutung der Freundschaft nachdenken.