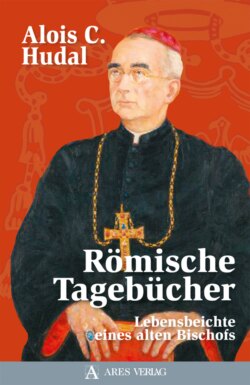Читать книгу Römische Tagebücher - Alois C. Hudal - Страница 11
2. Nach Rom (Erste Eindrücke)
ОглавлениеDer Weg nach Rom führte mich über drei denkwürdige Stätten, die erste war das Heiligtum von La Salette, ein einsames Dorf in der Dauphiné. Schon als Theologe interessierte mich gerade diese Marienerscheinung, so merkwürdig hart und lieblos die Worte der Madonna über Priester und Kirche klangen, ganz anders als jene von Lourdes und Fatima. Es ist die erste große Marienerscheinung im 19. Jahrhundert, deren Eindruck noch stärker wird, wenn man das Privatgeheimnis, das die Madonna dem elfjährigen Hirtenmädchen Melanie anvertraute, langsam überlegt, das teils im wirklichen, teils im gefälschten Wortlaut der Öffentlichkeit bekannt wurde, gebilligt, verurteilt, maßlos angegriffen, um schließlich als ein „Angriff auf die Ehre der Geistlichen jener Zeit“ von höchsten kirchlichen Stellen versenkt zu werden. Ein Vergleich der Worte der Madonna mit jenen späterer Erscheinungen, besonders von Lourdes, kann aber auch zugunsten von La Salette ausfallen. Ein erschütternder Ernst, eine Sprache, die an die großen Bußprediger des Mittelalters erinnert, und eine prophetische Voraussage über die kommende religiöse Krise, wie sie deutlicher nicht sein konnte. Das alles gibt gerade dieser Marienerscheinung, die später gegenüber Lourdes stark in den Hintergrund gerückt wurde, eine Bedeutung, die unter allen Privatoffenbarungen den ersten Rang einnimmt. Es genügt, nur die folgenden Worte herauszunehmen (in deutscher Übersetzung):
„Der Stellvertreter meines Sohnes wird viel zu leiden haben, denn eine Zeitlang wird die Kirche großen Verfolgungen ausgesetzt werden; das wird die Zeit der Finsternisse sein, die Kirche wird eine furchtbare Krise durchzumachen haben.
Indem der heilige Gottesglaube in Vergessenheit gerät, wird ein jeder sich durch sich selber führen und über seinesgleichen stehen wollen. Man wird die staatliche und die kirchliche Gewalt abschaffen, alle Ordnung und alle Gerechtigkeit werden mit Füßen getreten werden; man wird nur noch Mord, Haß, Mißgunst, Lüge und Zwietracht sehen, ohne Liebe für Vaterland und Familie. Der Heilige Vater wird viel leiden. Aber ich werde mit ihm sein bis ans Ende und sein Opfer empfangen. Die Bösen werden ihm mehrmals nach dem Leben trachten, ohne seinen Tagen einen Schaden zufügen zu können; aber weder er noch sein Nachfolger … werden den Triumph der Kirche Gottes sehen.
Die Inhaber bürgerlicher Gewalt werden allesamt ein und denselben Plan haben, nämlich jeden religiösen Grundsatz abzuschaffen und zum Verschwinden zu bringen, um Raum zu schaffen für den Materialismus, den Atheismus, den Spiritismus und für alle Arten von Laster.
Während dieser Zeit wird es geschehen, daß der Antichrist geboren wird, von einer hebräischen Nonne, einer falschen Jungfrau, die Verbindung hat mit der alten Schlange, dem Meister der Unreinheit; sein Vater wird Ev. sein; bei seiner Geburt wird er Lästerungen aussprechen, er wird Zähne haben; mit einem Wort, er wird der Fleisch gewordene Teufel sein. Er wird schreckliche Schreie ausstoßen, Wunder tun, sich nur von Unreinem nähren. Er wird Brüder haben, die, wenn auch nicht wie er Fleisch gewordene Dämonen, doch Kinder des Bösen sein werden; mit zwölf Jahren werden sie sich bemerkbar machen durch ihre heldenmütigen Siege, die sie davontragen werden; bald werden sie an der Spitze eines Heeres stehen, und die Legionen der Hölle werden ihnen Beistand leisten.
Die Jahreszeiten werden sich ändern, die Erde nur noch schlechte Früchte hervorbringen, die Gestirne werden ihren regelmäßigen Gang verlieren, der Mond nur noch ein schwaches rötliches Licht zurückwerfen; Wasser und Feuer werden der Erdkugel konvulsivische Bewegungen und schreckliche Erdbeben bescheren, darin Gebirge und Städte verschlungen werden (usw.).
Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Antichrist werden.
Die Dämonen der Luft werden zusammen mit dem Antichrist große Wunder auf der Erde und in der Luft verrichten, und die Menschen werden immer verderbter werden. Gott wird für seine treuen Diener sorgen und für die Menschen, die guten Willens sind. Das Evangelium wird überall gepredigt werden, alle Völker und alle Nationen werden Kenntnis der Wahrheit erlangen!“
Eine andächtige Schar von Pilgern kniete im Heiligtum, als fühlte sie die Schwere dieser Worte, obwohl seitdem fast neunzig Jahre verflossen sind. Eine eigenartige Atmosphäre herber Frömmigkeit strömt von diesem Heiligtum aus, dessen Heilquelle seit 1846 ununterbrochen fließt und in dem das Wort des Täufers „Tuet Buße“ im Munde der Madonna gleichsam einen zeitgemäßen Kommentar erhalten hat. Mit welcher Andacht beten hier die Pilger, wie ein grandioser Rahmen umschließen die Berge das Heiligtum!
Meine zweite Station war die Klosterzelle Savonarolas in San Marco zu Florenz. Unser Kirchengeschichtslehrer schilderte ihn als politischen Revolutionär und halben Ketzer. Sobald ich Pastors Papstgeschichte mit den tiefschürfenden Forschungen des Münchner Professors Schnitzer und des Italieners Guicciardini verglichen hatte, änderte sich dieses uns jungen Theologen aufgedrängte Urteil. Da ist wenig zu retouchieren, Kirche und Christentum werden nicht glaubhaft durch Worte, sondern in erster Linie durch Taten, sonst müßten wir in das Pharisäertum des Alten Testamentes zurückkehren, der Karikatur des Christentums in Alexander VI., dessen Leben den bereits überall gärenden Reformbestrebungen das beste Material für die Anklagen gegen die römische Kurie lieferte (obwohl sein Zeremoniar und Mitankläger, Jakob Burkart von der Anima, in nichts besser war). Wie sehr haben sich die Zeiten geändert! Wie viele edle heilige Papstgestalten hat allein die Kirche des 19. Jahrhunderts gehabt.
Savonarola, eine rätselhafte Figur der Renaissance, ein katholischer Prophet und wahrer Gottesmann, dessen Verurteilung ein Unrecht war und seine Rehabilitierung fordert, ein Idealist und Weltreformer, der scheitern mußte, wie Macchiavelli ihn treffend nannte „un profeta disarmato5)“, ein Träumer und Kämpfer für eine bessere Zeit. Sein Prozeß wurde in unwürdigster Form geführt mit Fälschungen, um ihn auf jede Weise zu „erledigen“, genau wie seinerzeit jener der Jungfrau von Orleans. Wäre ein Alexander VI., ein Borgia, sein Hauptgegner, durch einen Beschluß des Kardinalkollegs rechtzeitig abgesetzt worden, hätte die ganze Kirchengeschichte einen anderen Lauf genommen; so mußte dieser arme Klosterbruder im Gewande des heiligen Dominikus schauerlich als Märtyrer seiner religiösen Überzeugung und als Opfer einer Zeitenwende enden, in der später andere das Strafgericht Gottes an der Kirche vollzogen haben — zum Schaden des gesamten Christentums, das heute, gespalten und zerrissen, nicht mehr die religiöse einheitliche Welt des Mittelalters verkörpert. Die vielen Fremden, die nicht bloß die Meisterwerke von Fra Angelico betrachten, stehen meist ratlos vor dem Bilde dieses Mönches, dessen Leben und Tod eine ständige Mahnung ist, Reformen rechtzeitig durchzuführen, bevor der grausame Arm der Geschichte eingreift, Böses und Gutes vernichtet und neue Wege weist.
Vor Rom muß man in Assisi — es war meine dritte Station — haltmachen, am Grab des Poverello, des Vertreters eines simplifizierten Christentums, wenn dieses Wort nicht mißverstanden wird. Vielleicht hätte Franziskus in sozialer Hinsicht die Welt, wenigstens Mitteleuropas oder Italiens, geändert, wenn es nach ihm gegangen wäre. Ein wahrer Nachfolger Christi als Weltverbesserer und merkwürdiger Kontrast zu seinem Zeitgenossen Innozenz III., der, um die überlieferte Ordnung nicht zu stören, den starken religiösen Individualismus dieses Armen von Assisi in feste kirchenrechtliche Formen spannen mußte, so daß, wenn man die ursprünglichen Absichten des Poverello mit seinen fast romantischen idealistischen Zielen betrachtet, anderes herausgekommen ist. Es sind die großartigen Leistungen seiner Ordensbrüder in späteren Jahrhunderten in Kunst, Wissenschaft, im Werke der Mission und in kühnen theologischen Spekulationen. Mit ihm ist auch sein eigenes Ideal untergegangen, um in einer gemäßigten, der Wirklichkeit entsprechenden Lebensform zu enden. So umfängt ein mystisches Halbdunkel sein Grab.
Während diese Gedanken mich begleiten — je näher ich Rom bin —, leuchtet im Glanz der Abendsonne wie ein in den Himmel gebauter Dom das Symbol aller katholischen Universalität die Kuppel von St. Peter. Ein Idealismus ohne Grenzen umfaßt meine Seele, als ich längst vor San Lorenzo ihre Umrisse am Horizont erkannte. Ein unbändiger Tatendrang erfüllte mich, den großen gesamtdeutschen Zielen zu dienen, die mein Vorgänger, der Gründer des Priesterkollegs der Anima, der Nordtiroler Alois Flir, das Mitglied des Frankfurter Parlaments, seinen Nachfolgern als heiliges Erbe hinterlassen hatte. Ich will, wenn einmal das Schicksal in mein Leben eingegriffen hat, nicht umsonst als Österreicher und Deutscher nach Rom gerufen sein. „Den Besitzstand der altehrwürdigen deutschen Nationalstiftung der Anima gegenüber den Forderungen der Belgier zu retten, die eine Entschädigung für die im Weltkrieg zerstörte Universitätsbibliothek von Löwen verlangten, die Deutschsprechenden Roms aller Staaten zusammenzuführen oder wenigstens mitbauen zu können im Sinne einer kulturellen Schicksalsverbundenheit, die Seelsorge der Deutschen neuzuordnen, das während des Krieges völlig verwahrloste Kolleg modernen Ansprüchen anzupassen und die Anima bewußt zum Mittelpunkt und zur festen Burg der deutschen Katholiken Roms und Italiens auszubauen“ — das waren Aufgaben und Pläne, wert, ein Leben für sie einzusetzen.
Als mir mitten aus dem engen Straßengewirr vom Glockenturm der Anima der deutsche Reichsadler des 16. Jahrhunderts einen Willkommensgruß zu entbieten schien, kannte deshalb meine Freude keine Grenzen. Ich war wieder in Rom, nach zwanzig Jahren. Noch waren die Straßen ungepflegt wie vor dem Ersten Weltkrieg, als wir sorglos unsere Studien machen konnten. Noch hatte der Reformdrang des Faschismus im römischen Stadtbild nichts geändert. Es war das alte Rom der Vorkriegszeit, verwahrlost, in vieler Hinsicht noch jenes der siebziger Jahre mit derselben zum bequemen Leben neigenden Menschenart, die das „vivere e lasciar vivere6)“ zum Grundsatz auch des politischen Denkens erhoben hatte. Als ich die Pforte der Anima überschritt, wühlte ein Gebet meine Seele auf, einst nach Jahren ruhig Antwort geben zu können auf jene Schicksalsfrage, die der erste Brief meiner teuren Mutter, den ich mit einem Strauß von Alpenrosen der Heimat auf meinem Arbeitstisch fand, in so wohltuender milder Form für meine Arbeiten in Rom an mich richtete, daß mein religiöser Idealismus durch nichts geschwächt werde und keine rauhe Lebenserfahrung jenes Bild zerstören möge, das ich mir vor dem Eintritt ins Priestertum erworben hatte. Im alten Höfchen der Anima, das mit seinen Skulpturen und Resten des mittelalterlichen Kirchenbaues noch aus den Tagen der lutherischen Reformation eine eigenartige Atmosphäre atmet, begrüßte mich als erster ein biederer Schweizer, der Freund von Liszt und Mitbegründer des italienischen Cäcilienvereines, der St. Gallener Priester Peter Müller, der vom Germanicum an die Anima als Chormeister übersiedelt war und hier eine weitausgreifende Reformtätigkeit auf dem Gebiete der Kirchenmusik entfaltete. Der Gruß dieses Schweizer Geistlichen war echt und aufrichtig. Ein deutscher Mann, der trotz seiner äußerlichen Italienisierung innerlich seiner herrlichen Heimat verwurzelt blieb. Er hatte seine Ausbildung an der Regensburger Kirchenmusikschule erhalten und brachte die große Überlieferung der Meister des 16. und 17. Jahrhunderts (Palestrina, Vittoria, Orlando di Lasso, um nur wenige zu nennen) auch nach Rom, wo die Kirchenmusik mit Ausnahme der Sixtinischen Kapelle niedergegangen und verweltlicht war. Seit 1870 leitete er einen Chor von dreißig Knaben, die in einem Konvikt der Anima lebten und die päpstliche Mittelschule Sant’Apollinare besuchten. Von der Anima aus wurde dieser Priester zum geistigen Anreger der gesamten Kirchenmusik in Rom. Von prächtigen Männerstimmen unterstützt, wurde dieser Knabenchor so berühmt, daß Scharen von Musikbegeisterten der Stadt Rom zu den kirchenmusikalischen Aufführungen in die Anima strömten, bei großen Jubiläen und Festlichkeiten der Stadt, bei Pilgerempfängen und Jahrhundertfeiern (besonders Papst Gregors I.). Im Quirinal, in der Sixtina und in St. Peter war dieser Chor, aus dem eine Reihe angesehener italienischer Musiker hervorgegangen ist, Gegenstand der Bewunderung. Die Meister des 16. Jahrhunderts und der Gregorianische Choral wurden nach der Regensburger Überlieferung gepflegt. Josef Sarto (der spätere Papst Pius X.), der als Bischof von Mantua in der Anima wohnte, lernte dortselbst den genialen Chormeister kennen und schrieb in einem Brief vom 9. November 1884 mit Bewunderung von den kirchenmusikalischen Überlieferungen der Nationalkirche (in deutscher Übersetzung):
„Monsignore Jacuzzider, der immer soviel Freude an der Musik hatte, kannst Du sagen, daß ich, obwohl ich um 11 Uhr heute morgen im Vorzimmer Seiner Eminenz des Staatssekretärs sein mußte, doch der heiligen Versuchung nicht habe widerstehen können, vorher noch zur Messe in die Kirche der Anima zu gehen. Ich habe das Asperges, den Introitus, das Offertorium im Cantus firmus zu drei Stimmen mit Harmoniumbegleitung und den Rest im Cantus semifiguratus auch zu drei Stimmen, aber ohne Begleitung, genossen. Etwas ganz Wunderbares, besonders der Cantus firmus ist zum Sichdareinverlieben.“
Eine eigenartige, glückliche Fügung war es, daß die von der Regensburger Schule ausgehenden Grundsätze über die Anima durch Peter Müller, dessen Freunde Lorenzo Perosi und Josef Sarto schließlich im Jahre 1903 zum päpstlichen „motu proprio“ über die Reform der Kirchenmusik überhaupt führten. Die Namen Haberl, Mitterer gehören in diese glanzvolle Zeit der Anima hinein. Es war mein großer Kummer, daß ich, veranlaßt durch die überaus schwierige Finanzlage der Anima, nach dem Weltkrieg diesen Knabenchor im Jahre 1924 auflösen mußte. Im folgenden Jahre wurde Peter Müller, einer der bescheidensten und anspruchslosesten Priester, die mir untergekommen sind, im hohen Alter im deutschen Friedhof bei St. Peter begraben, während ein Stein in der Animakirche das Gedächtnis dieses genialen Kirchenmusikers kommenden Geschlechtern weitergibt.
Das Zusammentreffen mit einem Vorgänger, Prälat Brenner, der vom Schlag gerührt, aber noch geistig auf der Höhe in seinem bescheidenen Bette lag, war eine Seelenqual, denn er erfaßte die Schwere seiner Erkrankung nicht, die bald mit einer völligen Lähmung enden sollte. Er war ein befähigter, kluger Mann, aufgewachsen in der Habsburgermonarchie, zum Rektor der Anima durch Kaiser Franz Joseph ernannt, hoffte er auf seine Restauration mit der Wiederkehr des legitimen außer Landes vertriebenen Herrschers Kaiser Karl. Die Begriffe Nation und Deutschtum lagen ihm nicht. Die römische Kurie kannte er genau. Er fand sie dürftig und verbesserungswert im Menschenmaterial und Arbeitsrhythmus, allein er gab mir den Rat, daß es besser sei, nach außen alles zu loben, vieles nicht zu sehen, gegebene kirchliche Slogans wie ein Lautsprecher zu wiederholen, um der Gefahr der in Rom besonders verbreiteten „invidia clericalis7)“zu entgehen, das weise Wort Talleyrands sei hier am Platze: „Surtout pas trop de zéle8)“. Ich habe diesem unglücklichen Prälaten, der vom kirchlichen Beamtentum sehr geschätzt war, alle priesterliche Liebe erwiesen, bis er eines Tages, da die Krankheit stationäre Züge aufwies, dem Rate der Ärzte folgend in seine Heimat zurückkehren mußte. Wenn nicht ein tückisches Schicksal ihn frühzeitig arbeitsunfähig gemacht hätte, wäre ihm eine große kirchliche Laufbahn sicher gewesen.
Mit seiner Abreise war die Verantwortung auf mich allein gekommen. Ich war nicht der erste Steiermärker in der Anima, wenn auch die geschichtlichen Beziehungen des Bistums Seckau zur deutschen Nationalstiftung in den ersten Jahrzehnten wegen des norddeutschen Übergewichtes (Paderborn — Rheinland) gering gewesen sind. Schon im Jahre 1500 wird im Priesterverzeichnis ein Markus Trost genannt, und zwei Steiermärker (Christoph von Zach 1502, Andreas Frühwirth 1907) waren in der Animakirche zu Bischöfen geweiht worden, deren feierliche Grundsteinlegung im Jubeljahr 1500 der Seckauer Bischof und kaiserliche Gesandte Matthias Scheidt vorgenommen hatte. Im päpstlichen Reformbreve der Anima vom Jahre 1858 wurde die Ernennung des Rektors in gleicher Weise wie jene der Bischöfe Österreichs zum ausschließlichen Recht des Monarchen. Auch als 1918 das Kaisertum untergegangen war, wollte Kardinalprotektor Merry del Val diese Richtlinie beibehalten, wenigstens was die Staatsangehörigkeit des Rektors betraf. So wurde ich als erster vom päpstlichen Staatssekretariat zunächst als Koadjutor mit dem Rechte der Nachfolge ernannt. Während die reichsdeutschen katholischen Laien der Gemeinde Roms diese Auffassung keineswegs bekämpften — mit dem Wegfall der Monarchie hatte der betreffende Paragraph des alten päpstlichen Breves den geschichtlichen Sinn verloren —, arbeitete gegen die Berufung eines Österreichers an das Rektorat der Anima überaus heftig der deutsche Jesuiten-Kurienkardinal Franz Ehrle unter Heranziehung mehrerer ähnlich gesinnter Geistlicher, zu denen der Rektor des Päpstlichen Bibelinstitutes, mein früherer Lehrer, P. Leopold Fonck S. J., gehörte, dessen Einfluß aber an der Kurie seit dem Tode Pius’ X. zurückgegangen war. Wie mir der österreichische Gesandte, von Pastor, erzählte, bearbeitete Ehrle den Kardinalprotektor, um einen reichsdeutschen Priester der Kölner Erzdiözese, Emerich David, der Rektor des deutschen Campo Santo war, in die Anima zu bringen. Schließlich ging die Sache an Pius XI., der in der entscheidenden Audienz dem österreichischen Vatikangesandten erklärte: „Sollen auch Wir beitragen, das arme, klein gewordene Österreich zu verdemütigen?“ Damit war die Entscheidung gefallen, während die Rechtsfrage selbst ungelöst blieb, ob künftighin nur Priester österreichischer Bistümer zu Rektoren der Anima ernannt werden sollen. Dieses Vakuum einer Rechtserklärung angesichts des veralteten päpstlichen Breves 1858 brachte mir zahlreiche Schwierigkeiten in der Leitung dieser ehrwürdigen Stiftung. Mein erster Besuch in Rom galt dem Geschichtsschreiber der Päpste und österreichischen Gesandten, Ludwig Freiherrn von Pastor, dessen Hand bei meiner Ernennung zum Rektor im Spiele war. Er wohnte bescheiden in einer besseren bürgerlichen Wohnung in der Via della Croce, die gleichzeitig der Sitz des österreichischen Geschichtsforschungsinstituts war. Das Österreich der ersten Nachkriegszeit war verarmt und ohne jede Möglichkeit großer internationaler gesellschaftlicher Repräsentanz. Universell gebildet, von umfassender Kenntnis der Geschichte und der Kunstdenkmäler Roms, päpstlicher als der Papst, der ihn als Gelehrten überaus hoch einschätzte, hatte Pastor, wie man mir im Wiener Außenministerium sagte, einen bedeutenden Einfluß im Vatikan, nach dem Urteil der Diplomaten fürchtete er sich geradezu vor seinem eigenen Schatten. Als ich ihn am frühen Morgen nicht rechtzeitig angemeldet in seiner Arbeit störte, war er zunächst nicht erfreut. Über seinem Arbeitstisch war der Wahlspruch, die leuchtende Devise dieses reichen deutschen Gelehrtenlebens: „Vitam impendere vero9)“. Seine unheimliche Arbeitskraft wurde auch durch engherzige Kritik nicht gemindert. Kehr, der Direktor des Preußischen Geschichtsforschungsinstituts, machte ihm den Vorwurf, daß seine Bücher nur eine Verherrlichung der Päpste, aber nicht eine Geschichte der Idee des Papsttums seien.
Was immer auch das Urteil darüber sein mag, es war ein Gelehrtenleben einziger Art, das in dieser Form nicht schnell wiederkehren wird. Wie war es möglich, in diesem ungeheuren Chaos von Urkunden aus vier Jahrhunderten mit ordnender Hand das Wesentliche vom Nebensächlichen zu scheiden, die große Linie nie zu verlieren und aus tausend Mosaiksteinchen buntester Details das Gesamtbild großer Zeitperioden und die Vollbilder markantester Persönlichkeiten derart souverän zu gestalten? Nur ein großer Idealist, der auf vieles im Leben verzichten konnte, war imstande, sein Leben restlos einer so gewaltigen problemhaften Aufgabe zu widmen. Ich dankte Gott, dieser Persönlichkeit meine Aufwartung machen zu dürfen. Eben hatte ihn ein gelehrter italienischer Franziskaner in einer wissenschaftlichen Arbeit öffentlich wegen seiner Stellungnahme zum Pontifikat des aus dem Minoritenorden stammenden Papstes Clemens IV. angegriffen, unter dem die Gesellschaft Jesu aufgelöst wurde, was die beiden Staaten Preußen und Rußland nicht zur Kenntnis genommen hatten. Man warf dem alternden Gelehrten, der die Höhe des gewaltigen wissenschaftlichen Schaffens überschritten hatte, Abhängigkeit von den Jesuiten vor, er arbeite nicht mehr selbständig. Deutsche Jesuiten aus München, die verschiedenen Abschnitten seiner Werke sozusagen die letzte Feile gaben, benützten nach dem Urteil der Gegner diese Möglichkeit, um in die letzten Werke Pastors ihre persönlichen Geschichtsauffassungen, das heißt jene des Jesuitenordens, hineinzubringen. Pastor beruhigte sich nur langsam wegen solcher Angriffe. Seine einzige Erholung waren Spazierfahrten, besonders auf die Via Appia antica, wo ich später wiederholt die Freude hatte, ihn mit Kardinal Ragonesi, dem früheren spanischen Nuntius, begleiten zu dürfen. Als Wahlösterreicher besorgte er gleichzeitig die diplomatischen Angelegenheiten des neuen Staates beim Heiligen Stuhl. Seine immer klassisch geformten politischen Berichte waren auserlesene Lektüre des Bundeskanzlers Seipel. Unter vier Pontifikaten lebte Pastor in Rom. Zahlreiche höchste Persönlichkeiten des kirchlichen und politischen Lebens sind mit ihm in engem Verkehr gestanden. So war vielleicht meine erste Bitte an ihn verständlich, aus der reichen Lebenserfahrung des Geschichtsschreibers einige Richtlinien für mein Wirken an der Anima zu erhalten, die fast sämtliche deutschen Diözesen bei den päpstlichen Kongregationen zu vertreten hatte. Er hatte gerade den Bericht eines spanischen Botschafters aus dem Ende des 18. Jahrhunderts in den Händen, der ein wenig günstiges Urteil über Rom enthielt. Er werde, so erklärte er mir, ihn nicht benützen, weil ihm das Ansehen der Kirche an erster Stelle stehe, auch wenn manche darüber anders denken. Es sei manches anders geworden, und längst könne man Äußerungen selbst eines heiligen Bernhard (Considerationes IV, 2) nicht mehr als richtig in allem anerkennen („Romani importuni ut accipiant, ingrati, ubi acceperint, docuerunt linguam suam grandia loqui, cum operantur exigua, largissimi promissores et parcissimi exhibitores, blandissimi adulatores et mordacissimi detractores, simplicissimi dissimulatores ecc.: Die Römer sind ungestüm im Verlangen und undankbar, wenn sie etwas erhalten haben. Ihre Rede ist groß, aber ihre Taten sind klein. Sie versprechen alles und halten nichts, süße Schmeichler und beißende Verleumder, arglistige Heuchler und nichtswürdige Verräter.“). Ich brachte den Einwand, da ich diese Stelle zum ersten Mal gehört hatte, ob jemand, der solches geschrieben habe, heute noch heiliggesprochen werden könnte. Pastor, der äußerlich betrachtet wenig Gemüt zu besitzen schien und mir auch die Antwort auf diese Frage schuldig blieb, meinte dann: „Verlassen können Sie sich hier allerdings nur auf wenige, wenn es um Versprechen und Worthalten geht. Der Italiener ist stark Levantiner und diesbezüglich von der Moral des Ostens beeinflußt. Ausländer, vor allem Ordensleute, sind sehr erwünscht, wenn sie unbeachtet in stiller Zurückgezogenheit arbeiten. Die oberste Leitung ist italienisch und war es immer seit der Reformation, denn die Weltkirche ist auch die wesentliche Stütze der romanischen Kultur. Manchen Kurialisten fehlt auch das geschichtliche Denken und ein Sich-Hineinfühlen in die Gedankengänge anderer Nationen. Sie beherrschen aber vorzüglich das theologische System und besonders das Kirchenrecht. Ich sah manche Fehler in einem halben Jahrtausend der Papstgeschichte, die ich wie kein anderer durchforscht habe, aber ich liebe die Kirche wie ein guter Sohn seine Mutter, auch wenn sie mir nicht immer und nicht in allem ein Vorbild ist. Die römische Kirche ist mir Heimat und Vaterland. Mein letzter Herzschlag wird ihr gelten, denn ihr bin ich verschworen und ihr habe ich mein Leben und meine Forschungen geweiht“.
Es waren herrliche Bekenntnisse, die mich mit größter Freude erfüllten. Als wir auf das wissenschaftliche Arbeiten zu sprechen kamen, gestand er mir seinen Unwillen, daß auch ihm trotz der mündlichen Zusage Pius’ X. niemals eine Einsicht in das reiche Archivmaterial des Heiligen Offiziums gewährt worden war. Ein glücklicher Zufall vermittelte ihm aber die Kenntnis von nicht wenigen Urkunden dieser höchsten päpstlichen Behörde, die unter Napoleon nach Venedig und Paris verschleppt worden waren. So war es verständlich, daß manches in seinen Darstellungen im Urteil der Kritik als einseitig empfunden wurde. Daß er selbst an der römischen Kurie Gegner hatte, obwohl seine Papstgeschichte ganz in katholischer Schau geschrieben wurde, sah ich, als ich Kardinal De Lai, Sekretär der Konsistorialkongregation, den wichtigsten Berater Pius X., besuchte, der auch beim Pontifikatswechsel als Vertreter eines zentralistischen Kurses und wesentlicher Mitarbeiter am kirchlichen Rechtsbuch in großem Ansehen stand. Als wir zufällig auf die Papstgeschichte zu sprechen kamen, als ich ihm von meinem Besuche bei Pastor berichtete, meinte er: „Meno verità e più carità sarebbe stato meglio10).“ Es war ein hartes Urteil über das wissenschaftliche Schaffen eines Mannes, der Jahrzehnte der Wissenschaft im Sinne des Papsttums verwendet und zahlreiche Angriffe von Nichtkatholiken geerntet hatte. Warum dunkle Seiten im Buche der Kirchengeschichte überschlagen? Warum eine idealistische Frisierung nach Art von Legenden und frommen Andachtsbüchern! Warum Kirche und Papsttum mit Wolken stützen, während doch beide auf ehernen Säulen ruhen und letzten Endes auch durch eine Darstellung der menschlichen Entwicklung mit Fehlern, Armseligkeiten und tief bedauernswerten Verfallserscheinungen (es genügt an das 9. Jahrhundert, Tuskulaner und an die Vor-Renaissance-Zeit zu erinnern) nichts vom Goldgrund göttlicher Führung verlieren können. Pastors Ruhmesblatt ist nicht bloß das monumentale Werk seiner Papstgeschichte, die kein Panegyrikus nach Art romanischer Darstellung ist, sondern daß er als Laie trotz vieler Tiefenblicke in das Dämonische und Untermenschliche auch in der Welt des Religiösen seinen Kindesglauben rein und unversehrt bewahrt hat. Das ist das Heldische in seiner Persönlichkeit. Feinde, Intrigen, lieblose Kritik, da er von seinem großen Gegner P. Ehrle als „integraler“ Katholik wenig geschätzt war, nichts war imstande, ihn von der Liebe zur Kirche zu trennen. Es war mir oft, als sehe er die Menschen nicht mehr, sondern nur die „civitas supra montem“10a) — das himmlische Jerusalem, die entmenschlichte, geläuterte Kirche.
Pastors Lebenswerk wird aber die Jahrhunderte überragen, auch wenn Nichtkatholiken und einzelne katholische Geschichtsforscher manche Abschnitte seiner Darstellung anders beurteilen, mehr vom Standpunkt einer natürlichen Entwicklung oder des Dämonischen, das auch vor dem Kirchenportal nicht haltmacht. Die Gefahren begannen für ihn, als drei Fragen ein klares und, soweit menschliches Wissen ein sachliches Urteil überhaupt ermöglicht, ein solches forderten: Savonarola, dessen klassische Geschichtsdarstellung durch Schnitzer nicht überboten werden konnte — der Heilige gegenüber einem Alexander VI. —, der Ritenstreit in China, in dem Jesuiten, die weitblickende Männer unter sich hatten, und Dominikaner sich als Gegner gegenüberstanden —, in Wirklichkeit hatte diese Geschichte mit Religion nicht das Geringste zu tun; es war nur eine machtpolitische Frage der europäischen Protektoratsstaaten, für die China als Kolonie ein Geschäft war, dessen Betrieb nicht durch religiöse Neuheiten gestört werden durfte, und endlich die heikelste aller Fragen, die Aufhebung des Jesuitenordens durch Papst Klemens XIII. Hier mußte er, wie immer sein Urteil war, in einen Gegensatz kommen zu den Söhnen des Spaniers Ignatius und den bereits im Niedergang befindlichen Minoriten, die für den Papst als ihren Ordensbruder leidenschaftlich Stellung nahmen. Als dieser letzte literarische Kampf tobte, ohne je wirklich ausgefochten zu werden, da schließlich jeder Teil Gründe für und gegen sich hatte, trat Ehrle hinter den Kulissen in Erscheinung, um Pastors weitere wissenschaftliche Arbeit zu unterbinden. Die wahre Wissenschaft lebt aber nur von der Freiheit des Irrtums, und so habe ich mich niemals dazu hergegeben, Dienste gegen Pastor über Wunsch dieses Jesuitenkardinals zu besorgen. Schmerzlich berührte es mich, als eines Tages der Jesuitenkardinal Ehrle mich ersuchte, in geschickter diplomatischer Form auf Pastor einzuwirken, damit er seine wissenschaftliche Arbeit einstellen möge, „er sei nicht mehr auf der Höhe“. Ich habe dem alten Kirchenfürsten erwidert: „Warum machen Sie denn das nicht selbst angesichts Ihrer hohen Stellung?“ Es war unvermeidlich, daß Pastor, der in Rom als Vertreter des katholischen Integralismus betrachtet wurde, in einen Konflikt mit verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft Jesu kommen mußte, obwohl in München mehrere Jesuiten einen Großteil seiner Arbeiten besorgten. Das Kapitel über die Auflösung dieser bedeutenden Ordensgesellschaft war zu gefährlich, auch wenn er es noch so vorsichtig schreiben wollte. Es ehrt den genialen und wahrheitsliebenden Jesuitengeneral Ledochowski, daß er Pastor stets in enger Freundschaft verbunden war. Ich danke Gott, der Bitte Ehrles niemals entsprochen zu haben.
Spät abends besuchte ich den Kurienkardinal Andreas Frühwirth. Der Sohn einer schlichten Bauernfamilie aus dem Grenzgebiet Steiermarks wurde später einer der eifrigsten Vorkämpfer der deutschen Sprache und des Deutschtums im bedrohten Gebiet überhaupt. Er liebte Österreich und Deutschland und fühlte sich in dankbarer Erinnerung an seine Münchner Nuntiaturzeit auch als Anwalt deutscher Angelegenheiten und Wünsche in Rom. Seine besondere Sorge galt der Erhaltung einer deutschen Seelsorge und des Religionsunterrichtes in deutscher Sprache in den öffentlichen Schulen Südtirols. „Die päpstliche Kurie denke in einzelnen ihrer Vertreter zu realpolitisch, da es schließlich nicht wesentlich sei, in welcher Sprache das Christentum von einem Menschen aufgenommen werde.“ Er hatte eben einen Hilferuf der Brixener Bischöflichen Kurie gegen die nationale Unterdrückungspolitik der Faschisten an das Staatssekretariat weitergeleitet. Dann sprach Kardinal Frühwirth, der Mitglied mehrerer päpstlicher Kongregationen, darunter jener für die Riten, war, von den Heiligsprechungsprozessen. Ihm war es in erster Linie um jene für deutsche Heilige zu tun. Daß er mehrere Prozesse (so jenen für Albertus Magnus, die Mystikerin Margarethe Ebner) auch wegen des schleppenden Formalismus nicht weiterbringen konnte und daß im größten Tempel der Christenheit immer nur Romanen auf die Altäre erhoben wurden, als ob deutschen Menschen der Sinn für eine kanonisierte Heiligkeit abhanden gekommen wäre, das alles quälte ihn, auch wenn er andererseits zugab, daß die Kirche des deutschen Volkes an Seligen nicht Mangel hätte. Nach seiner Auffassung besteht bei den Beamten dieser Kongregation, von denen nur wenige die deutsche Sprache beherrschen, mehr Interesse für solche romanischer Länder, während deutsche Prozesse jahrzehntelang im Staub der Archive liegen. Die Weltkirche sei auf diese Weise in Gefahr, in Frömmigkeit und Heiligenkult eine romanische Farbe zu erhalten. Ich bewunderte diese Haltung des Kardinals, dem das römische Volk wegen seines ehrenhaften Lebenswandels den Beinamen eines „Santo“ gegeben hatte. Er selbst war in gewisser Hinsicht nach dem alten Spruch „Vox populi, Vox Dei“11) bereits kanonisiert. Eine Stunde flog im Zuhören wie nichts dahin. Frühwirth war ein liebenswürdiger, stets hilfsbereiter, kluger Mann ohne jede Präpotenz, der seine hohe Würde nicht eitel zur Schau trug. Er hatte sich in Rom sein deutsches Herz bewahrt. Nach dem Urteil italienischer Stellen hätte er als Nuntius versagt, da er die strengen Maßnahmen Pius’ X. gegen die modernistischen Strömungen an deutschen Hochschulen nicht durchführte oder immer wieder milderte. Als ich auf dem Heimweg meine ersten Eindrücke in Rom überlegte und die Urteile dieser beiden Persönlichkeiten Pastor — Frühwirth vergegenwärtigte, war mir eines klar geworden: Beide waren römisch gesinnt im besten Sinne dieses Wortes, aber beide dachten und fühlten deutsch, der hochbetagte österreichische Kardinal mehr als Pastor.
Heute morgen standen im Programm die deutsche Botschaft und bayerische Gesandtschaft beim Heiligen Stuhl, der reichsdeutsche Jesuitenkardinal Ehrle und mehrere päpstliche Würdenträger des Vatikans. Allen war ich ein Unbekannter, der zum ersten Mal ihren Weg kreuzte. Der deutsche Reichskanzler Wirth, der gerade bei einem Empfang in der deutschen Botschaft Villa Bonaparte in der Via Piave, zu dem ich eingeladen war, anwesend war, kannte die Steiermark und meinte, in diesem Grenzlande sei das Deutschtum kein blutmäßiges Bekenntnis, sondern ein nationaler Daseinskampf, die Revolution zweier Rassen, ein seelischer Konflikt. Ich bemerkte aus dem Gespräch mit den beiden Chefs der diplomatischen Missionen, daß die Frage des staatspolitischen Rechtsschutzes der deutschen Nationalstiftung und die Verdrängung der Österreicher vom Rektorat der Anima beziehungsweise wenigstens die paritätische Leitung von abwechslungsweise Reichsdeutschen und Österreichern ihr Sorgenkind war. Beide, Diego von Bergen und Freiherr Ritter von Groenesteyn, die im Vatikan den Einfluß des Gesandten Pastor nicht untergraben wollten, da er ihnen wegen seiner Beziehungen manche wertvolle Auskunft vermitteln konnte, stammten aus der alten Diplomatenschule. Beide waren Grandseigneurs, treffliche Vertreter des Reiches und Bayerns. Ich hatte, nachdem der Einfluß des geistlichen Botschaftsrates Steinmann, eines Schlesiers, mit dem der Breslauer Kardinal Bertram manche Schwierigkeiten durchzukämpfen hatte, zurückgedrängt war, das Glück, mit beiden führenden Diplomaten in freundschaftliche Beziehungen treten zu können. Nach 1930 gab es zwischen uns keine Reibungen mehr. Wiederholt schützte mich besonders der bayerische Gesandte gegen die Hintertreppenpolitik des Jesuiten Ehrle. Wichtige geheime Gutachten für das Berliner Auswärtige Amt sind durch meine Hände gegangen, und ich war immer bestrebt, auch wenn ich keine amtliche Stellung dortselbst annehmen konnte, wie einst der Österreicher Johannes von Montel im Sinne einer gesamtdeutschen Haltung tätig zu sein. Der Weg führte mich zum Jesuiten Ehrle, der in einem bescheidenen Ambiente des südamerikanischen, von seinen Ordensbrüdern geleiteten Kollegs in den Prati wohnte. Eine hoheitsvolle Erscheinung, Gelehrter von Weltruf, huldvoll lächelnd mich zum Ringkuß zulassend. Sein Blick gefiel mir nicht, er hatte etwas an sich, das kein großes Vertrauen einflößen konnte. Von Pius X. wegen seiner Arbeit gegen die Gründung eines internationalen katholischen Geschichtsforschungsinstituts vom Vatikan ausgeschaltet, kehrte er nach dem Krieg wieder nach Rom zurück, wo er für seinen Nachfolger Achille Ratti Stimmung machte und schließlich den Purpur erhielt. Ehrle hatte, wie ich schon bei der ersten Aussprache bemerkte, keine feste nationale Haltung. Er schätzte Österreich nicht hoch ein, obwohl er wiederholt im Jesuitenkolleg von Feldkirch (Vorarlberg) die Verhältnisse beobachten konnte. Er hatte auch kein großes Verständnis für die nationalen Belange der Südtiroler. Es schien ihm selbstverständlich zu sein, daß diese armen, vom deutschen Mutterlande gegen die Versprechungen Wilsons abgetrennten Menschen ihre völkischen Forderungen der deutschen Jugenderziehung, des Unterrichts in der Muttersprache den Interessen der Weltkirche, in diesem Falle Italiens, unterordnen müßten. Er war Römer geworden, der delikaten Fragen und Problemen auf Umwegen auszuweichen suchte. Zwischen uns beiden hat seit dem Kampf um das Rektorat eine Isolierschicht bestanden. Ich klagte diesem Ordensbruder im Purpur meine Anfangsschwierigkeiten, da mit der Anima auch die Vertretung fast aller reichsdeutschen und österreichischen Bistümer bei den päpstlichen Verwaltungsbehörden verbunden war. Ehrle, der Rom aus einem jahrzehntelangen Aufenthalt kannte, gab mir aber einige treffliche Worte: „Italiener haben uns Deutschen gegenüber allerlei voraus. Sie nehmen nichts tragisch und nichts gründlich. Sie weichen, solange als möglich, grundsätzlichen Lösungen aus. Das ‚arrangiare, combinareund dilatare‘11a) ist ihre große Weisheit in der obersten Kirchenleitung. Sie lassen die Zeit arbeiten. Wir Deutschen müßten Gott danken, daß wir nicht zur Regierung der Kirche berufen wurden. Mit unserem Organisationsfanatismus, mit Statistiken und unserer nationalen Eigenart der Gründlichkeit des ‚andare in fondo‘11b) alles ordnen zu wollen, Fragen und Probleme wissenschaftlich bis in die letzten Schlußfolgerungen auszudenken, eigene Auffassungen anderen aufzudrängen, hätten wir eine Weltkirche, die auf so viele Nationen Rücksicht nehmen muß, nur in die größten Schwierigkeiten gebracht. Der Deutsche ist religiös gründlicher als der Italiener, denn er sucht Probleme, wo sie nicht vorhanden oder nicht zu lösen sind, aber gerade seine Kritiksucht macht ihn nicht geeignet, einen so komplizierten Mechanismus, wie es der römische Katholizismus ist, ruhig und ausgleichend ohne Erschütterungen und gewaltsame Lösungen zu regieren.“
Die Worte dieses alten Kirchenfürsten, der fast fünfzig Jahre in Rom, wenn auch in erster Linie unter den Bücherschätzen der Vatikanischen Bibliothek, verbracht hatte, sind mir eine große Lebensweisheit geworden, so betrübend ich ihren Hintergrund empfinden mußte. Leider hat später gerade dieser den Einflüsterungen nicht unzugängliche Kardinal mir hinter den Kulissen viele Schwierigkeiten in der Leitung von Kolleg und deutschsprachiger Gemeinde bereitet, da er sein Vorurteil gegen Österreich nicht ablegen konnte. Ich eilte durch das Quartiere del Rinascimento — die sogenannte Spina, die damals noch beide Borghi voneinander trennte, sie war noch nicht niedergelegt — zum Vatikan. Glanzvolle Kardinalspaläste, die noch im Verfall und ihrer Verwahrlosung vom Reichtum ihrer einstigen Bewohner zeugten, dagegen armselige menschenunwürdige Schaluppen — Slums, in denen dicht zusammengedrängt oft bis zu sechs Menschen in wenigen Räumen arbeiten, essen und schlafen mußten, manche vielleicht zufrieden mit ihrem niedrigen Lebenskomfort oder wenigstens lethargisch geworden, rückständig auf sozialem Gebiet. Es kann im 16. Jahrhundert, als die Erbauer der Paläste hochherzige Mäzenaten der Kunst waren, nur noch schlechter gewesen sein, als Luthers Schatten die verweltlichte Kirche zu stören begann. Traumverloren schreite ich durch dieses Viertel mit engen Gassen und dem finsteren Borgo, vorbei am Hause des Arztes Leos X., noch einige wenige Schritte und die Kolonnaden Berninis mit dem unvergleichlichen Petersplatz sagen mir, daß ich nunmehr auf heiligem Boden stehe, wo jede Kritik verstummen soll. Ich eile nach St. Peter. Phantastisch strömt das Licht von der Kuppel in alle Arme des Baues. Es ist schwierig, hier innig zu beten. Ich gehe von einem Grabdenkmal der Päpste zum anderen und blicke zur Decke. Die Raumwirkung ist befreiend von jeder irdischen Schwere. Ich suche einen stillen Winkel, um dem Apostelfürsten oder irgendwelchem der ungezählten hier begrabenen Heiligen betend meine Aufgabe in Rom als Leiter der deutschen Nationalstiftung anzuvertrauen. Heute empfing mich Kardinalprotektor der Anima Merry del Val, ihm und dem Geschichtsschreiber der Päpste Baron Pastor hatte ich in erster Linie meine Ernennung zum Rektor zu verdanken.
Fast jedes Institut in Rom hat einen Kardinalprotektor. Der erste in der Geschichte der Anima war der Neffe Papst Pauls II., Marco Barbo, 1469, der auch der Bruderschaft der Anima angehörte und die deutschen Verhältnisse aus der Zeit seiner Kardinalslegation kannte. Viele erlauchte Namen folgen in den Jahrhunderten — unter anderen, um nur einige Namen zu nennen, Otto Truchsess von Waldburg (Bischof von Augsburg), Madruzzo-Trint, Colonna, Scipione Borghese, Alessandro Albani, Harrach, Kollonitsch, Herzan. Einige von diesen waren auch beim Vatikan Protektoren der deutschen Nation, Deutschlands oder der österreichischen Erblande.
Merry del Val war eine wahrhaft fürstliche Erscheinung. Trotz gegenteiliger Behauptungen, die in Rom verbreitet wurden, eine Persönlichkeit von hoher Geistigkeit. Er war eine glückliche Mischung und Verkörperung des Spanischen, Englischen und der Romanität. Deutschland liebte er nicht seit den üblen Erfahrungen als Staatssekretär Pius’ X. mit der Borromäus-Enzyklika und dem zurückgezogenen Modernisteneid der Theologieprofessoren. Beide mußten über Druck der preußischen Vatikanvertretung und des Berliner Auswärtigen Amtes zurückgezogen werden. Alles, was die spitze Zunge des römischen Pasquino („Merry del Val non val12)“ über diese Persönlichkeit sagte, war böswillige Kritik. Wohl konnte ein Großinquisitor des mittelalterlichen Spanien nach den Gemälden von El Greco und dem Roman Dostojewskys kein anderes Profil gehabt haben, in dem alles Würde und Strenge ohne Kompromisse war. Von diesem Fürsten der Kirche hätte ich, auch wenn ich ihm nicht zu Dank verpflichtet wäre, nur den besten Eindruck erhalten. Rede, Gesichtsausdruck, vornehme Erziehung, Würde und Liebenswürdigkeit wirkten harmonisch in ihm zusammen. Gegenüber so vielen anderen, die ich kennenlernen mußte, ein kirchlicher Grandseigneur auch in der aufrichtigen Gesinnung des Wohlwollens. Dem Wunsch seines Geheimsekretärs Monsignore Canali, der von Papst Benedikt XV., seinem Rivalen, bald nach der Wahl infolge des Wechsels der Vatikanpolitik aus dem Amt eines Substituten im Staatssekretariat entfernt worden war, konnte ich später nicht entsprechen. Er bat mich, die Geschichte Merry del Vals als Staatssekretär zu schreiben. Da wegen des Amtsgeheimnisses nur wenige Urkunden des Vatikanarchivs zur Verfügung gestellt werden konnten, mußte ich diese ehrenvolle Aufgabe ablehnen, um nicht einen Panegyricus ohne wissenschaftlichen Wert verfassen zu müssen. Merry del Val war auch eine wohltuende Ausnahme gegenüber den gewöhnlichen Kardinalprotektoren religiöser Institute in Rom. Er nahm diese Aufgabe nicht als eine Förmlichkeit, sondern als persönliche Verantwortung. Noch über Wunsch der österreichischen kaiserlichen Vatikanbotschaft zum Protektor der Anima ernannt, hat er nach 1923 wesentlich geholfen, die Rechtsansprüche der Belgier und Holländer zu klären.
Durch Kardinal Merry del Val wurde ich bald nach meiner Ernennung zum Rektor der Anima in die höchste römische Behörde, das Heilige Offizium, berufen, der ich stets in tiefer Dankbarkeit gedenke, nachdem ich die Ehre hatte, über 35 Jahre dieser als Berater angehört zu haben. Schwerwiegende Entscheidungen gingen in diesen langen Jahren durch unsere Hände. Verurteilung der Action francaise; Massenübertritte ganzer serbisch-orthodoxer Orte zum Katholizismus, um dadurch der gewaltsamen Ausrottung durch die Ustascha-Truppen des Kroatenführers Pavelič zu entgehen; Priesterweihe für zur Kirche heimkehrende protestantische Pastoren, die verheiratet waren und deshalb nicht zum Zölibat verpflichtet werden konnten; Befreiung verunglückter Priester, die als das Opfer von Beichtvätern und einer rückständigen Seminarerziehung trotz sexueller Schwierigkeiten in diesen Beruf hineingeraten sind — weitherzig, eines wahren obersten Seelenhirten war die Haltung Pius‘ XII., wenn solche Fälle ihm vorgetragen wurden, meistens unerhörte seelische Tragödien — besonders in Italien zählte man mehrere Tausende; die Verurteilung des politischen Kommunismus, mehrere Werke des NS (Rosenberg, Bergmann); „prêtres ouvriers“12a) (eineigener, meistens vergeblicher Versuch, die Arbeiterschaft der Kirche wieder zurückzuerobern); die Wiedereinrichtung des Diakonats ohne Zölibatszwang im Sinne der Urkirche; Bestrebungen der Wiener Nuntiatur, die Freimaurer über die Johannesloge von Österreich aus mit Rom zu versöhnen — Befürworter war der dortige Nuntius, der das Wesen dieser Bewegung verkannte, wie Berichte an das Staatssekretariat (1952—53) deutlich beweisen.
Dieses Crescendo in den Besuchen großer römischer Persönlichkeiten glitt etwas ab, als ich dem päpstlichen Majordomus Samper und dessen Stellvertreter, dem Maestro di Camera Caccia-Dominioni meine Aufwartung machen mußte. Ersterer, eine elegante Erscheinung von südamerikanischer Herkunft, war nicht minder liebenswürdig als der junge Mailänder Prälat, den Pius XI. nach Rom mitgebracht hatte und der bald sein vertrauter Freund geworden ist. Ersterer war ein Fremdkörper in dieser eigenartigen Welt, in die Ausländer sich selten ganz hineinleben können. Caccia-Dominioni liebte scherzend ein freies Wort. So unterbrach er mich lachend mit dem alten römischen Pasquinowort: „Cardinali sono come amici inutili e come nemici prepotenti13).“ Als ich von beiden weg in den Damasushof ging, fuhr gerade ein Stromlinienwagen, Type Maybach, eines ausländischen Vatikangesandten vor. Unwillkürlich dachte ich an die Worte, die einst Manzoni, der als guter Katholik nicht minder ein offenes Urteil über das politische Leben hatte, an seinen Verwandten Marchese d’Azeglio geschrieben hat: „Io trovo la cosa più inutile la diplomazia. Gli ambasciatori non sono che spie messe a origliare nelle anticamere. Questo poteva essere buono una volta, ma adesso che c ‘è la stampa, cosa serve 1 ’ambasciatore? A ricevere uno schiaffo come Hübner*) o come Barrili, ad assicurare che tutto va bene in Spagna la vigilia della cacciata della regina14)?“
Was würde er im Zeitalter der Demokratie sagen, da Diplomaten oft nur mehr Briefträger der gerade am Regierungsruder befindlichen politischen Parteien ihres Staates sind, abhängig nicht von den Monarchen, die eine Kontinuität des politischen Denkens verkörperten, sondern von ständig wechselnden Stimmungen der die Masse beherrschenden Zeitungsschreiber und die deshalb auch als Gesandte bestrebt sein müssen, die Personalpolitik des Vatikans nach opportunistischen Gesichtspunkten zu beeinflussen. In den langen Jahren habe ich nicht wenige Diplomaten in Rom kennengelernt. Mehrere waren ausübende Katholiken, andere liberal, religiös gleichgültig, Protestanten, Orthodoxe; auch Mitglieder der Loge konnten bei den eigenartigen Verhältnissen Südamerikas nicht fehlen. Diplomatische Rücksichten, Berechnung und politische Hemmungen sind für die Kurie unvermeidliche Begleiterscheinungen. Im Zeitalter der katholischen absolutistischen Monarchen, die den anderswo nicht verwendbaren Adel auf hohe Kirchenposten beriefen, mußte Rom nicht selten mit dem herrschenden Staatssystem gehen, wie es Rosmini in seiner Schrift „Die 5 Wunden der Kirche“ in ergreifender Weise geschildert hat.
In republikanisch-konstitutionellen Staaten mit demokratischer Parteienbildung muß dieselbe Kirche im Interesse höherer Vorteile zu manchen Dingen schweigen und die am Ruder befindlichen Parteien stützen, weil der betreffende Botschafter oder Gesandte im päpstlichen Staatssekretariat seine Minen legt oder bremst, nicht selten unterstützt von trüben Kanälen des Weltjournalismus, während ein vom Staate unabhängiges, kämpfendes, sich auf eigene Füße gestelltes Kirchenwesen schon längst öffentlich gemeldet hätte. So gibt es kein Staatssystem, mit dem der Vatikan nicht verhandeln muß und mit dem er nicht Kämpfe und Auseinandersetzungen hat, um mitten im religiösen Verfall der Zeit vom weltanschaulichen Erbe der Vergangenheit wenigstens etwas retten zu können. In gespannter Erwartung begab ich mich zum ersten Mal in das päpstliche Staatssekretariat, um mich den beiden höchsten Beamten dortselbst, Pizzardo und Borgoncini-Duca, vorzustellen. Nachdem ich die übliche Wartezeit antichambriert hatte, wurde ich zuerst zum Sostituto des Kardinalstaatssekretärs vorgelassen. Die Aufnahme war höflich und liebenswürdig, wie es italienischer Sitte entspricht. Sie galt wenigstens nach den äußeren Eindrücken mehr dem Österreicher als dem Deutschen, denn die Tragödie des Kammerherrn und Geheimsekretärs Benedikt XV., Monsignore Gerlach von Baden, war noch nicht vergessen. Er hatte das Vertrauen seines hohen Herrn im Ersten Weltkrieg schmählich mißbraucht und war vom italienischen Gericht als Spion zu langer Kerkerhaft verurteilt worden. Pizzardo, ein ehemaliger Jesuitennovize, mit dem intuitiven Blick des Italieners, äußerst beweglich, fast feminin, machte nicht den Eindruck des profunden Kenners der Verhältnisse, sondern eines von anderen im Urteil abhängigen Menschen. Er war der Vertreter mancher Schichten römischer Kurialisten, deren Kirchenpolitik immer bereit war, Verträge und Annäherungen an die jeweilige politische Machtgruppe zu erreichen, während sie für den Fall eines politischen Wechsels ihre Leute auch im anderen Lager hatten. In dieser Haltung wurden sie von der wendigen Gesellschaft Jesu gestärkt, die, um ein klassisches Beispiel aus der neuesten Zeit herauszugreifen, in der Frage von Freimaurerei und Kirche kompromißfreudige Mitglieder (besonders in Frankreich und Amerika) hatte (P. Bertheloot) und deshalb überall für Demokratie, Persönlichkeitsrechte, Freiheit des Gewissens und Individuums (die alten zu Beginn des 19. Jahrhunderts verurteilten Auffassungen von Lamennais) eintraten, während andere wiederum eine ablehnende Stellung bezogen, so daß der Orden, wie immer die Sache schließlich endigen sollte, für alle Fälle etwas in Händen hatte, um durch Schwierigkeiten hindurchzukommen. Das Opfer sind die linientreuen Charaktere und Idealisten, denen das „salvarsi la pelle15)“ nicht gelungen ist. Seine erste Frage war, wie weit Österreich schon im Ausbau der katholischen Aktion fortgeschritten sei. Ich mußte ihm leider erwidern, daß praktisch sich nur wenige damit beschäftigen können; niemand wisse recht, ob es sich nur um eine straffere Zentralisation der zahlreichen in Österreich seit Jahrzehnten bestehenden Vereine und Verbände handle oder um Neuorganisation der gesamten katholischen Front für politische Endziele, um, wie Bischof Besson (Fribourg) es so geistreich formulierte, der „insufficience du Clerque e sufficience des laiques16)“ nachhelfen zu können. Tatsächlich steckte damals Österreich ganz in den politischen und wirtschaftlichen Daseinssorgen, um diesen Rumpfstaat von Saint-Germain, der nicht recht leben, aber andererseits auch nicht sterben konnte, über die Wirtschaftskrise der unmittelbaren Nachkriegszeit für eine bessere Daseinsform hinwegzuretten. So kamen auch die Beschlüsse der ersten Katholikentage Österreichs über gewisse allgemeine Richtlinien ohne politische Zielsetzung nicht hinaus. Wesentlich günstiger war der Besuch bei Monsignore Borgoncini-Duca, dem späteren Nuntius in Italien. Er kannte Österreich vom Hörensagen aus den Berichten der Wiener Nuntiatur und katholischen Presse. Auch er war von feinen gesellschaftlichen Umgangsformen, wenn auch ein Vertrauensmann der deutschen Botschaft ihn mir als wenig zuverlässig geschildert hatte. Den Hauptpunkt des Tages bildete mein Besuch bei Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri. Äußerlich wenig gepflegt, fast vernachlässigt wie manche Vertreter des armen italienischen Landklerus, war er huldvoll, mir trotz seiner gewaltigen Arbeitslast eine lange Audienz zu gewähren, nachdem Gesandter Pastor mir geraten hatte, das Gespräch sofort auf das neue kirchliche Rechtsbuch zu bringen, dessen geistiger Vater Gasparri war. Sogleich erzählte er von den reichen Erfahrungen, die er im Verkehr mit den Konsultoren verschiedenster Nationen und mit den Mitgliedern der Kardinalkommission gesammelt hatte, deren Aufgabe die Festlegung der einzelnen Paragraphen des Codex iuris canonici war. Neben Merry del Val die interessanteste Persönlichkeit des Kardinalskollegs, war er von einer rührenden Bescheidenheit, ein einfacher, schlichter Mensch aus dem Bauerndorf Uscita in Umbrien, der mitten in der monotonen Hofetikette der Kurie seine Natürlichkeit bewahrt hatte. Während des Weltkrieges nahm er eine äußerst kluge Haltung ein, gegenüber den Bestrebungen von Erzberger-Flotow die römische Frage mit den Kriegszielen staatlicher Mächte zu koppeln. „15 Jahre habe ich freiwillig auf jeden Urlaub verzichtet, um das kirchliche Rechtsbuch zu vollenden, das ich bereits als Professor des Institut catholique in Paris begonnen hatte, aber ich bin mir bewußt, daß nicht weniges darin einer Überarbeitung und einheitlicheren Begriffsfassung schon heute bedürftig ist.“
Als ich 1930 ihm die Bitte des Dekans der theologischen Fakultät in Bonn, Professor König, unterbreitete, dem dortigen kirchenrechtlichen Seminar sein Lichtbild mit Unterschrift widmen zu wollen, holte er persönlich ein solches mit prächtigem Rahmen aus dem Salon und fragte mich so ganz natürlich: „Wie soll ich unterschreiben? Ich bin ja nicht mehr Staatssekretär!“. „Eminenz“ — unterbrach ich ihn — „unterschreiben Sie als solcher, denn Sie sind in die Geschichte als der bedeutendste nach Consalvi eingegangen.“ Er war von einer rührenden Bescheidenheit und demutvollen Einfachheit, dankbar bewegt, wenn man seine Riesenarbeit der Kodifikation des kirchlichen Rechtsbuches würdigte. Ihm merkte man es an, daß er die Ehrenstelle nicht gesucht, sondern daß eine höhere Fügung ihn dorthin gebracht hatte, wo seine ganze Lebensaufgabe ihre Erfüllung finden sollte. Da ich aus seinen Worten auch etwas von Liebe zu meinem unglücklich gewordenen Vaterland fühlte, suchte ich das Gespräch auf die Folgen des Friedensvertrages hinzulenken, der für die Dauer unhaltbar sei. Aufmerksam hörte der hohe Kirchenfürst mir zu, da er die Bedeutung Altösterreichs für den Katholizismus im Donauraum zu würdigen wußte. Schließlich meinte er — darin erwies er sich als Rechtsgelehrter und Realpolitiker — „Warum habt ihr Österreicher diesen Vertrag von Saint-Germain unterschrieben? Jetzt seid ihr leider gebunden.“ Dann fand er Worte herzlicher Teilnahme für das Schicksal der Habsburgermonarchie, die ich als durchaus aufrichtig empfinden konnte, auch wenn man in römischen Kreisen ihn einer besonderen Vorliebe für Frankreich beschuldigte. Als ich nach dieser bedeutsamen Audienz nochmals in das päpstliche Staatssekretariat zurückkehren mußte, um mich einigen untergeordneten, aber für die Anima wichtigen Beamten vorzustellen, meinte ein junger italienischer Monsignore: „Qui si fa la politica17).“
Am Abend sprach ich mit einem katholischen Laien, der aus jahrzehntelanger Beobachtung diese halb religiöse, halb politische Welt kannte und vielleicht Enttäuschungen erfahren hatte — „questi sono pronti di vendere la propria camicia18)“, war sein sonderbares Urteil. Und doch schlägt in dieser merkwürdigen Welt des Vatikans das Herz der römischen Kirche. In dieser Gralsburg des Glaubens an ewige Ideale in der Wüste moderner Zweifelsucht, mit dem schwerelosen, scheuen Lächeln der Beamten, die sich alle langsam ändern, je länger sie in einer Atmosphäre nicht selten gegenseitigen Mißtrauens leben müssen, klingen alle Sorgen, Kümmernisse und Siege des katholischen Gedankens aller Kontinente und menschlicher Armseligkeit zusammen.
Das Staatssekretariat ist mit dem Heiligen Offizium die wichtigste Zentralbehörde der römischen Kirche. In gewisser Hinsicht übertrifft es an Einfluß die letztere Kongregation, weil die Entscheidungen wesentlich von politischen Erwägungen des Augenblicks beeinflußt werden müssen. Keine Bischofsernennung, auch nicht jene der an sich dazu berufenen Konsistorialkongregation, kann ohne vorherige Fühlungnahme und Billigung seitens des Staatssekretariats erfolgen. Es ist natürlich, wenn man von Missionsländern oder von Staaten ohne bedeutendes politisches Parteileben und wenn man von Nordamerika absieht, daß jede Ernennung irgendwie mit den gerade herrschenden politischen Strömungen des öffentlichen Lebens einen Zusammenhang haben muß, um überflüssigen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. Die Vatikandiplomaten der einzelnen Staaten sind nicht minder interessiert, Komplikationen oder eventuell notwendige Epurationen des politischen Systems ihrer Heimat zu unterbinden, farblosen und konzilianten Vertretern eines sogenannten diplomatischen Christentums im Episkopat die Wege zu ebnen. Nicht wenige Dokumente der Botschafts- und Nuntiaturarchive des 19. Jahrhunderts könnten diese Behauptung geradezu als Dogma der kirchlichen Personalpolitik Roms erhärten, das durch Ausnahmen nichts von seiner Kontinuität verliert. Im Staatssekretariat werden auch die vom Heiligen Offizium, der obersten Stelle für das Gebiet des Glaubens und der Sitten, ausgearbeiteten Maximen, wenn sie nicht rein religiös-spekulative Wahrheiten von Theologenschulen beinhalten, auf ihre augenblickliche politische Tragbarkeit und Opportunität einer Veröffentlichung überprüft, um allen Schwierigkeiten mit den Staaten auszuweichen. So kann heute etwas an sich absolut Richtiges als inopportun verurteilt werden, was übermorgen, wenn ein parteipolitischer Szenenwechsel eintritt, von der gleichen Stelle als eigene Auffassung vertreten wird. Klassische Fälle sind die Namen Bonomelli, Rosmini und jener des Demokratenführers Murri und Don Sturzo, um nur wenige zu nennen. Politik und Religion müssen, wo immer eine Bindung zum Staat besteht, ein Connubium eingehen, in dem Gegensätze nicht kompromißlos ausgetragen, sondern durch Taktik, Ausweichen und Abwarten klug gemildert werden. Ein Mikrokosmus ist deshalb die „casa del padre comune“,18a) das Eigenartigste auf religiösem Gebiet, das die Geschichte in Europa hervorgebracht hat. „Denn welcher Kluge fand’ im Vatikan nicht seinen Meister“, diese Worte des Gesandten von Ferrara im Drama Goethes haben auch für die Gegenwart ihre Bedeutung. Für Rom arbeitet als der mächtigste Kampf- und Bundesgenosse die Zeit. Der Vatikan kann warten, was Parteien, besonders aber Diktatoren und Totalitätssysteme nicht können, ohne an Prestige im Volke einzubüßen. Rom aber gewinnt, je langsamer es arbeitet. Gegenüber manchen Vorwürfen, die von verschiedenen Seiten erhoben werden, als ob gerade das päpstliche Staatssekretariat durch einen „sacro opportunismo19)“ Kämpfer und religiös führende Gestalten nicht vorwärtskommen lasse im Interesse des diplomatischen Christentums, das Kompromisse eventuellen Schwierigkeiten vorzieht, kann man vielleicht mildernd sagen, daß es einen anderen Weg heute nicht gibt. Die Kirche muß jenen klugen Weg des „minus malum20)“, oft des Augenblickserfolges, wählen, nachdem ihr nicht mehr wie im Mittelalter katholische Armeen und die Gerichtshöfe der Inquisition zur Verfügung stehen. Vielleicht hat Joseph Bernhart in seinem Buche über den Vatikan richtig geurteilt, wenn er schreibt: „Ein Bau von geordneten Gliedern in wuchtiger Geschlossenheit, einfach und gewaltig zugleich, so steht die Kurie vor den Augen der Welt und nötigt selbst ihren Feinden Bewunderung ab. Nur ist sie nicht das, wozu ihre Lobredner sie machen wollen, die ideale Verknüpfung gegensätzlicher Regierungsformen. Sie ist vielmehr die reinste Inkarnation des Absolutismus, gestützt nicht nur auf das Gottesgnadentum, die alte Idee der Monarchie, sondern vielmehr auf das Bewußtsein der Statthalterschaft Gottes auf Erden“.
Zwei Erlebnisse. — Eine Feierlichkeit in St. Peter — meine erste Audienz bei Pius XI.
Ein Pontifikalamt des Papstes ist ein gewaltiges Schauspiel, ein Stück Mittelalter in jener Kirche zum Leben erweckt, deren Baugeschichte, äußerlich gesehen, den religiösen Spalt in Europa mitverursacht hat. Vor zwanzig Jahren konnte ich als Kaplan der Anima zum ersten Mal eine solche Feier erleben. Zuviel haben unterdessen Weltkrieg, Revolution und das Schicksal meines armen Vaterlandes in meiner Seele geändert, um mit gleichen Augen alles zu sehen. St. Peter wirkt an gewöhnlichen Tagen wie ein Museum, in das die Menschen hinein- und herausgehen aus Neugierde und kaum das allerheiligste Sakrament beachten. Der Barock wirkt wie Kulissenkunst eines übergroßen Festsaales. Künstlerischer und tiefer ist jener in den süddeutschen und österreichischen Stiftskirchen. Ein Gemurmel von Zehntausenden, die im Petersdome schon eine Stunde vor Beginn der Feierlichkeit versammelt sind, bildet die Einleitung. Fürsten, Grafen, Marchesi und Barone, die Überreste des europäischen Adels, haben eigene Plätze. Kein von allen Teilnehmern gesungener feierlicher Choral und kein gemeinsames Gebet bereitet die Seelen für den großen Festakt vor. Schon erklingen die silbernen Trompeten. Der Festzug, den Ordensgeistlichkeit eröffnet, setzt sich in Bewegung. Interessante Profile, nicht wenige scharfgezeichnete Gesichtszüge. Als der General der Gesellschaft Jesu, P. Wladimir Ledochowski, der schwarze Papst, vorüberzieht, richten sich viele Blicke auf ihn. Viele Zehntausende Ordensmitglieder aller führenden Nationen und in fast allen Staaten unterstehen seinem Kommando. Es ist der Generalstab der Kirche in vielen Dingen. Längst vergessen, überholt und als Unrecht bewiesen klingen heute die harten Worte des Hauptgegners der Jesuiten, Papst Klemens XIV., der in seiner Aufhebungsbulle 1773 schreibt: „Die Jesuiten haben in allen Jahrhunderten den Frieden der Weltkirche gestört.“
Dagegen war einer der ersten Ratschläge, der mir bei meinem Eintreffen in Rom gegeben wurde, ein anderer: „Trachten Sie in Rom mit der Gesellschaft Jesu gut zu stehen, das kann ihrer Stellung beim Vatikan nur nützen, sonst sind Sie verloren.“ Ich konnte demgegenüber darauf hinweisen, daß ich einer der ersten Schüler des vom deutschen Jesuiten Leopold Fonck gegründeten päpstlichen Bibelinstituts war und auch als erste wissenschaftliche Abhandlung in deutscher Sprache „Das Buch der Sprüche“ dortselbst veröffentlichen konnte. Überdies zogen in meinem Geiste verschiedene hochangesehene Mitglieder dieser Gesellschaft vorüber, so Hummelauer, ein Bibelforscher mit selbständigem Urteil, die aus diesem Orden hervorgegangen sind, Hermann Muckermann, der intuitiv die Bedeutung der Rassenfrage und Eugenetik erfaßte, Lippert, der vornehme Essayist, der nicht Weniges in seinem geistvollen Stil Nietzsche zu verdanken hatte, und endlich Przywara, der Philosoph und Ästhet, dessen blendende Gedankengänge besonders die katholische Jugend der Nachkriegszeit begeisterten. In diesen Persönlichkeiten, zu denen später Karrer und Balthasar von Urs kamen, glaubte ich schon in Graz den geistigen Ausdruck der Gesellschaft erblicken zu können. In Rom wurde diese meine Beurteilung nicht geteilt. Sie galten als Außenseiter und nicht als Normaltyp eines Jesuiten.
Prächtige Gestalten sind im Festzug des Papstes die Ordensgeneräle der Dominikaner und Franziskaner. Trotz ihrer in die Zehntausende gehenden Mitgliederzahl können sie sich in der Weltkirche vor allem an der Kurie nicht so durchsetzen wie die Gesellschaft Jesu, obwohl Thomas von Aquin, Albertus Magnus, Bartholomäus Las Casas und Lacordaire nicht bloß für den Dominikanerorden, sondern auch für die gesamte Kirche Sterne ersten Ranges sind. Die Nachfolger des heiligen Thomas vertreten ein wundervolles theologisches System, einheitlicher, geschlossener und konsequenter als jenes anderer Orden. Wenn nicht die letzten Schlußfolgerungen im Mysterium enden, während der forschende Menschenverstand noch weiterschreiten möchte, wäre die Theologie eines Thomas von Aquin das großartigste System theologischen Denkens, das je eine Religion in Europa aufgestellt hat. Daß die Lehre von der ewigen Vorausbestimmung des Menschenschicksals nicht bei Zwingli und Calvin geendet hat, ist das Verdienst der Thomaserklärer, die rechtzeitig aufhören oder sich in die Geheimnisse Gottes flüchten. An uns schreitet vorüber die ehrwürdige Gestalt des Benediktiner-Abtprimas aus der freiherrlichen Familie von Stotzingen. Etwas vom großen antiken Menschentum der Römer lebt in der monumentalen einfachen Mönchregel eines Benedikt bis heute weiter. Unsterblich bleiben die Verdienste dieses Ordens und seiner Abzweigungen in der Kolonisation des deutschen Lebensraumes. Durch Jahrhunderte waren mehrere seiner Abteien in Italien (Farfa, Nonantula) Burgen und Festungen des Römischen Reiches Deutscher Nation. Gegenüber diesen drei alten Orden treten die übrigen, deren Generäle im Farbenreichtum der Trachten einander folgen, weniger hervor, so überaus verdienstvoll ohne Zweifel ihr Wirken im Gesamtorganismus der Weltkirche ist. Ihre manchmal eigenartigen Uniformen, die in romanischen Ländern entstanden sind und mit ihrer fremdartigen Ästhetik kaum in das moderne Stadtbild passen, gehen nach der Lebensgeschichte ihrer Gründer auf Anweisungen Christi oder seiner Mutter zurück.
Vorbei zieht das Heilige Kolleg. In würdig gemessenem Schritt folgen einander die Purpurträger: ehrwürdige Erscheinungen, vom Alter gebeugte Männer, die alle mehr oder weniger ein interessantes Leben hinter sich haben. Seit 1870 wurden sie immer stärker auf die Rolle hoher Verwaltungsbeamten oder vortragender Räte herabgedrückt, abhängig von Ordens- oder Weltgeistlichen, die ihre Referate besorgen, da sie in merkwürdiger Ämterkumulierung meistens vier bis sechs päpstlichen Kongregationen angehören und deshalb auch bei genialster Begabung unmöglich von einer Sitzung zur anderen das gewaltige Arbeitspensum auch nur flüchtig lesen können. Mit Ausnahme von Merry del Val, Gasquet, Billot, Ehrle und Frühwirth gehören alle der italienischen Nation an, die seit Jahrhunderten der römischen Kurie die Angestellten vermittelt, manche aus Süditalien oder Sizilien, wo nicht wenige Heilige geboren wurden, aber im Volke noch viel aus den Religionen der Antike mitgezogen wird. Mein Begleiter, der zum ersten Mal in Rom eine solche große Feierlichkeit mitmachen konnte, fragte mich etwas naiv: „Umfaßt dieses hohe Kolleg in seiner Zusammensetzung alle Nationen? Ist es der Ausdruck einer Weltkirche?“ (Pius XII. hat unter dem Druck der politischen Verhältnisse nach 1945 manches daran geändert.) Ich konnte ihn bald mit der Antwort beruhigen, die ich erst vor wenigen Tagen von einem der besten Kenner Roms erhalten hatte, dem ich ähnliche törichte Fragen vorlegen wollte. Im absolutistischen System der Weltkirche haben Kardinäle wenig zu reden, da ihre Meinung den Papst nicht bindet. Die letzte Entscheidung muß er selbst fällen. Er kann machen, was er nach seinem Gewissen und Urteil für gut findet. Eine Appellation oder irgendwelche Kontrolle im Sinne der Urkirche ist nicht mehr möglich. Deshalb spielt es keine Rolle, wer gerade den Purpur trägt. Die Urteile der Römer sind geistreich, aber hart. Ich höre sie über diese und jene Kardinäle, über den Spanier Merry del Val, den Engländer Gasquet, der die Nichtigkeitserklärung aller anglikanischen Weihen in Rom durchgesetzt hat, den Franzosen Billot, der die in romanischen Ländern besonders urgierte Herz-Jesu-Verehrung als dogmatisch fragwürdig erklärte und eine Vorliebe für eine geläuterte Action française hatte, den deutschen Jesuiten Ehrle, der seiner Würde bewußt, trotz des hohen Alters in aufrechter Haltung dahinschritt. Nichts würde sein Ordensgelübde verraten, irdische Ehren abzulehnen. Das Kardinalskolleg, das in den Jahrhunderten seines Bestandes, weil es (bis ins 19. Jahrhundert hinein) auch Nichtpriester unter sich hatte, auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann, die wissenschaftlich noch nicht geschrieben ist, ist heute gegenüber der großen Bedeutung im Mittelalter eine „umbra magni nominis21)“, wenn auch religiös vorwärtsstrebende Kämpfergestalten und Persönlichkeiten von hoher Kultur in ihm immer vertreten sind. Ihr Privatleben ist opfervoll geworden, ohne Abwechslung, in manchen Dingen ein weiterlebender Barock entschwundener Zeiten. Mich fesselt nur mehr eines, die Gestalt des Papstes, die wie eine Erscheinung vergangener Jahrhunderte mit religiöser Begeisterung durch die Menge auf dem Tragsessel durch St. Peter zieht. Feierlich klingen Perosis Melodien „Tu es, Petrus“ durch die Kirche. Der Jubel hat kein Ende. Wie eine Symphonie von Musik, Religion und Kunst zieht der Ritus des päpstlichen Hochamtes an unserem Auge vorüber — alles ist Einheit, Harmonie, Zusammenklingen.
Als der letzte Segen erteilt wird, dieselben Posaunen erklingen, die Menge im Beifall jubelt, blicke ich hinüber, wo einst die Grabstelle der Mutter Heinrichs IV., Agnes, der Tochter des Herzogs Wilhelm von Aquitanien war, dem die Lombarden ihre Krone angeboten hatten. In der Petronillakapelle liegt sie begraben, unweit vom Papstaltar, an dem die feierlichen Zeremonien der Missa papalis sich vollziehen. Niemand beachtet mehr die letzte Erinnerung an diese deutsche Mutter, nachdem ihr Grab verschollen ist. Beim Neubau von St. Peter wurde alles beseitigt, was den Architekten störte. So teilt Agnes das Schicksal der deutschen Päpste, deren Gräber in Sankt Lorenzo vor den Mauern, im Dom zu Florenz und in Ravenna verschwunden sind. Kein Gedenkstein erinnert mehr an ihre Namen. Sie sind ausgelöscht und leben nur mehr in den Büchern der Geschichte. Nur zwei Fürstlichkeiten der deutschen Nation, Agnes und Otto II., haben als die einzigen gekrönten Häupter aus der langen Geschichte des Römischen Reiches Deutscher Nation hier ihre Ruhestätte gefunden. Auch Agnes erlebte einst in St. Peter den Triumph eines Papstes, als ihr Sohn Heinrich IV. von der Kardinalskommission des Reiches und der Krone verlustig erklärt wurde. Schon beim Ausgang von St. Peter ruht Mathilde von Tuscien, die Gegnerin der Italienpolitik Heinrichs IV., der ihren großen Feudalbesitz bedrohte. Ein weiteres Stück deutscher Tragik. Wie wenn Hieroglyphen sich entziffern, sprechen diese Grabinschriften in die Gegenwart hinein.
Ein zweites Erlebnis. — Das erste Mal beim Papst. Erwartungsvoll schreite ich durch die vielen Säle des vatikanischen Palastes, bis die Glocke das Zeichen gibt, daß ich eintreten darf. Hinter einem schlichten Paravento noch einige Schritte, und ich knie vor dem Steuermann der Weltkirche. Eine wenig künstlerisch ausgeführte Glasmalerei auf dem Fenster hinter dem Thronsessel des Papstes stört den ersten Eindruck, das Geschenk einer Mailänder Firma. Schon auf dem Wege hörte ich, daß der gelehrte Papst mehr Prunk als echte Kunst liebe. Der Oberitaliener hat ein schärferes Profil als der Römer. Kraft, Arbeit und Energie sprechen aus dem Antlitz dieses Papstes. Die Gesichtszüge sind fast hart zu nennen. Der Römer ist der geborene „fra commodo22)“, der Fragestellungen ausweicht oder sie erst dann erledigt, wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind und eine Verurteilung oder positive Einstellung der Weltkirche niemand mehr besonders aufregt. Das bekannte Wort „Roma lavora con piedi di piombo23)“ erklärt sich aus dieser römischen Vorliebe für ein ruhig dahinfließendes Leben. Der Rhythmus der Arbeit und der Dynamismus des Nordmenschen mit seiner Faustischen Unruhe liegen ihm nicht. Er will nicht überall „Ordnung machen“, kennt nicht den Fanatismus für die Wahrheit und nimmt deshalb auch vieles im Leben nicht tragisch. So bildet er das statische Element innerhalb der Weltkirche, das aber für eine so große, nur auf dem Glauben und ohne äußere Machtmittel aufgebaute religiöse Organisation eine Notwendigkeit ist. Pius XI. ist aus einem anderen Holze geschnitzt. Kühl und nüchtern, eine geborene Herrschernatur. Ein Mann mit Linie, Kirchenfürst durch und durch. Der Norditaliener mit der Tiara, der den Besucher trotz aller väterlichen Güte seine hohe Stellung fühlen läßt. Ein ragender Fels im Toben der Zeitgeschichte, kein Opportunist oder Diplomat im Sinne Talleyrands. Gegenüber dieser Säkularerscheinung machte der übrige Hofstaat einen wenig bedeutenden Eindruck. Die Frage dreht sich bald um meine Heimat, um Österreich. Ich hörte aus den Worten des Papstes viel Sympathie und spürte Wärme. Er war geboren, als Österreich noch Mailand besetzt hatte. Seine Verwandten standen im Dienste der alten Habsburgermonarchie. Die Namen Kardinal Geysruck, Erzbischof von Mailand, dessen Ernennung Wien nur mit Drohungen beim Vatikan durchgesetzt hatte, und Feldmarschall Radetzky bedeuten für ihn als Italiener Josefinismus, Knechtung und Fremdherrschaft. Er scheint aber das jetzige Österreich zu schätzen, das klein und machtlos geworden ist. Das Gespräch ging bald auf deutsche Belange über. Er sprach voll Bewunderung über deutsche Arbeit und Wissenschaft, nachdem er als Gelehrter so oft die Bibliotheken Deutschlands, Österreichs und Böhmens besucht hatte, und von der Genauigkeit und Disziplin des deutschen Menschen. Deutschland werde sich wieder aus der Katastrophe herausarbeiten. Dann zeigte er mir einen langen, vom Reichspräsidenten Hindenburg an ihn gerichteten Brief mit dem Dank der deutschen Regierung für alles, was der Vatikan nach dem Kriege auf karitativem Gebiete getan hatte. „Welche Persönlichkeit!“, rief er aus, als er die machtvolle Unterschrift des Generalfeldmarschalls betrachtete. Vielleicht liebt er Deutschland in seiner Not und Verdemütigung, ob auch in Glanz und außenpolitischer Größe, wenn es einmal national erwachen sollte? Ich konnte den Gedanken nicht loswerden, daß er Deutschland mehr bewunderte, als sich ihm seelisch nahe fühlte. Ich erinnerte ihn daran, den Namen „Achille Ratti, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana“ eingetragen gefunden zu haben in der Bibliothek des Prämonstratenserklosters Strahov bei Prag und in einem ärmlichen Pfarrhaus des Ennstals, in dem er vor seiner Bergpartie auf den Dachstein in der Steiermark übernachtet hatte. Diese Audienz umfaßte kostbare Augenblicke, die mir unvergeßlich sind. Die Kirche hat in Pius XI. einen großen Führer erhalten, auch wenn die Wellen der Zeit den kleinen Kahn stürmisch emporhoben. Er ist mehr als jener „dolce Cristo in terra24)“, von dem italienische Zeitungen in einem eigenartigen Byzantinismus mit Catherina von Siena sprechen. Er ist eine durchaus männliche Erscheinung. Er weiß, was er will, und ist sich seiner Würde, aber auch des Bleigewichtes seiner Verantwortung in dieser Zeitenwende ganz bewußt. Er ist leidenschaftlich bemüht, das Ansehen des Vatikans zu mehren und dem Papsttum den Anschluß an die große Weltpolitik im Interesse der Weltkirche zu sichern. Mit tiefem Dank für die erste Audienz verließ ich von seinem apostolischen Segen beglückt sein Arbeitszimmer. Nur Pius XI. galten meine Gedanken. Alles andere ist Alltag und Schatten, der sich an die Sonne drängt. Die Eindrücke lassen mich nicht mehr zur Ruhe kommen. Dieser Papst mit seinen bald siebzig Jahren ist noch relativ jung zu nennen, trotz des langen Lebens eine unverbrauchte Kraft. Möge ihm in heiliger Eingebung die Gnade geschenkt werden, die Kirche aus der Vergangenheit zu einer glücklichen Synthese von Religion und nationalem Denken zu führen, wie es Millionen von Europäern heute wünschen. Unendlich groß ist seine Verantwortung. Er ist ein Märtyrer seiner Stellung, der erste Kreuzträger der Welt, darin wirklich der Vicarius Christi, umgeben von Rivalitäten der Staaten, Nationen und verschiedenen theologischen Richtungen innerhalb der Kirche. Wenn man die Bilder der Renaissancepäpste mit jenen des 20. Jahrhunderts vergleicht, welch ein Unterschied schon allein im Gesichtsausdruck einer milden Schwermut, die sich der Gefahren und Schattenseiten unserer Zeit, besonders des Niederganges des verinnerlichten religiösen Lebens, bewußt ist. „Oremus pro Pontifice nostro25)!“
5) „ein entwaffneter Prophet“
6) „leben und (andere) leben lassen“
7) „klerikale Eifersucht“ (Streberei)
8) „Vor allem nie zuviel Eifer“
9) „Das Leben für die Wahrheit einsetzen“
10) „Besser gewesen wäre: weniger Wahrheit und mehr Liebe“
10a) „Stadt auf dem Berge“
11) „Volkesstimme ist Gottes Stimme“
11a) das „Arangierene, Kombinieren und Hinausschieben“
11b) „(den Dingen) auf den Grund gehen“
12) „Mit Merry del Val ist’s nicht weit her“
12a) Arbeiter priester
13) „Kardinäle sind gleich unnützen Fieunden und präpotenten Feinden“
*) Österreichischer Diplomat in Paris und Rom.
14) „Die Diplomatie ist meines Erachtens das Allerüberftüssigste! Die Botschafter sind nichts anderes als Spione, dazu da, um in den Vorzimmern zu lauschen. So etwas mochte früher einmal einen Sinn gehabt haben; aber wozu dient jetzt, da es die Presse gibt, noch ein Botschafter? Um eine Ohrfeige zu bekommen wie Hübner oder wie Barrili, um — am Vorabend der Vertreibung der (spanischen) Königin — zu versichern, in Spanien sei alles in Ordnung?
15) „die eigene Haut in Sicherheit bringen“
16) „der Unfähigkeit des Klerus und der Fähigkeit der Laien“ (nachhelfen zu können)
17) „Hier wird die Politik gemacht“
18) „Diese sind dazu fähig (wenn es opportun ist), ihr eigenes Hemd zu verschachern“
10a) »(das) Haus des gemeinsamen Vaters“
19) „‚heiligen‘ Opportunismus“
20) des „kleineren Übels“
21) „ein Schatten eines großen Namens“
22) „bequemer Bruder“
23) „In Rom geht man mit bleiernen Füßen voran“ (Hudal dürfte jedoch hier falsch zitiert haben. Das römische Volkssprichwort lautet nämlich: „A Roma si va avanti con piedi di piombo!“)
24) (jener) „süßer (gütiger) Christus auf Erden“
25) „Beten wir für unseren Papst!“