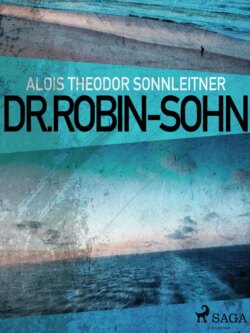Читать книгу Dr. Robin-Sohn - Alois Theodor Sonnleitner - Страница 5
Magister Robin
ОглавлениеDer Apotheker Weisswasser geleitete den jungen Landlehrer Kajetan Lorent durch die dämmerige Materialkammer und öffnete ihm die Türe zum Laboratorium.
„Servus, Koja!“ scholl es dem Ankömmling entgegen, und vom Destillierherd kam ein fröhlicher Bursch auf ihn zu, in dem er den Robin-Sohn von einst kaum erkannte. Aus dem gedrungenen Melker Studentlein von einst war ein hagerer, über mittelgrosser Mann geworden, das schwarze geringelte Haar war kürzer gehalten als einst; das Gesicht war länger geworden und bot einen durchgeistigten, etwas nervösen Ausdruck; das Wangenrot war einem eintönigen Braun gewichen, das durch kurze Bartstoppeln und ein russfarbenes Schnurrbärtchen noch dunkler wirkte. Die Schwarzkirschen-Augen glänzten lebhafter, die gesund roten Lippen waren wulstiger als einst.
Der Apotheker liess die jungen Leute allein. Koja beeilte sich, den Freund zur bestandenen Magisterprüfung zu beglückwünschen; der legte ein Buch weg, in dem er gelesen hatte, drückte Koja auf den Sessel beim Destillierherd und pflanzte sich vor ihm auf: „Was? — Da schaust?“, fragte er mit unverkennbarem Selbstbewusstsein. „Damals, als mir die Melker Herren wegen der dummen Seerosengeschichte das Consilium abeundi1) gegeben haben, hast du vielleicht gedacht, mit meinem Plan, Schiffsarzt zu werden und polynesischer Inselkönig, wär’s aus. — Und als du mir später in Wien begegnet bist, wie ich als Schlosserlehrbub vor ein Wagerl mit Eisenbändern gespannt war, magst du mich bedauert haben.“
„Ich weiss ja doch, dass du selbständig weiterstudiert hast“, wendete Koja ein, „trotz der Plag’ im Gewerb. Da hab’ ich mir schon gedacht, dass du es zu was bringst; aber du wolltest doch maturieren und Medizin studieren?“
„Hab auch maturiert so nebenbei, hab einen Schnellsiederkurs2) gemacht und bin auf dem Weg, Arzt zu werden. Im Wintersemester war ich noch ausserordentlicher Hörer der Medizin gewesen, jetzt nach der Matura bin ich ordentlicher geworden und stehe im zweiten Semester; im Juli mach ich mein Physikum; das ist für mich leichter als für einen andern; Botanik, Mineralogie, Chemie hab ich schon als Pharmazeut studiert, jetzt brauch ich nur die allgemeine Biologie3) nachzutragen.“
Koja riss in heller Verwunderung die Augen auf. Robin fuhr fort:
„Als ich die Prüfung über die Quarta hatte, starb meine Mutter. Da musst’ ich trachten, wo unterzuschlüpfen. Ich wollte mein Brot haben und dabei etwas treiben, das mich nicht weit abbrachte vom künftigen Beruf des Mediziners. So bin ich Praktikant geworden da in der Apotheke4) beim Weisswasser. Ein Glück, dass ich grad zu dem gekommen bin. Hast du dir ihn gut angesehen?“ — „Du meinst den dicklichen, blonden Herrn?“ — „Ja, den; die leibgewordene Gefälligkeit; wenn der merkt, dass einen was druckt, fühlt er sich so unbehaglich, dass er helfen muss; sonst wird ihm selber nicht wohl. Ich hab dem Weisswasser nicht nur meine Zeugnisse vorgelegt vom Gymnasium und von der Maschinistenschule in Pola, sondern auch die Grabnummern von Vater und Mutter und hab ihm gesagt, dass ich Pharmazeut werden wollt, um mein Brot zu haben, wenn ich Medizin studier’. Da hat er sich flüsternd mit seinem Provisor beraten, dem Herrn von Eisank. Ich hab nur die Worte gehört: „Der Josef, nämlich der alte Laborant5), hat Plattfüss’, der kann die Hilf’ brauchen.“ — Dann hat er mir die Hand gereicht: „Sie können morgen um 7 Uhr antreten. Sie werden schon zugreifen auch bei der schweren Arbeit; erleichtern Sie unserem braven Laboranten den Dienst, da tun Sie was Gutes.“ — Dann aber kam ihm ein Bedenken: Er zog sein Notizbuch heraus und rechnete: „Wie wird es mit der Wohnung und Verköstigung sein? — Der jetzige Praktikant, ihr Kollege, ist der Sohn eines reichen Serben. Er verköstigt sich selbst, hat seine eigene Wohnung und zahlt mir fürs Praktizierendürfen 360 Gulden jährlich. — Bei Ihnen wird das anders sein müssen: Schlafen werden Sie auf dem Diwan im Nachtdienstzimmer hinterm Laboratorium, und als Kostgeld geb’ ich Ihnen alles in allem für’n Anfang acht Gulden monatlich. Sie müssen halt mit Milch und Brot vorlieb nehmen zum Frühstück wie zum Abendmahl; und zu Mittag müssen Sie in die Volkskuchel geh’n; um zwei Kreuzer Gemüs’, um zwei Kreuzer Brot. Da bleibt Ihnen noch was auf Salzstangeln zur Jause. Später, wenn ich sehe, dass ich an Ihnen eine gute Kraft hab, leg’ ich Ihnen was zu; d. h. ich sorge auch für Ihre Kleider, für die Wäsche und die Schuhe.“
„Mensch! Koja! Hast du eine Idee, wie gern ich den Weisswasser hab? Nur um fünf Jahr älter als ich, hat er für mich gesorgt wie ein Vater. Aber auch der Herr von Eisank, den du im Laden gesehen hast, ist ein guter Mensch. Wie der gemerkt hat, dass ich nicht erst wart, bis mir eine Arbeit geschafft wird, und wie er erfahren hat, dass ich keinen anderen Ausgang beanspruch, als in der Frühe, so zwischen fünf und sieben, draussen im menschenleeren Rudolfspark herumzugehen und dabei zu studieren, hat er mich seinem Bruder vorgestellt, der Gymnasial-Direktor ist. Und der hat mir nicht bloss Bücher geborgt, soviel ich gebraucht hab, er hat auch dafür gesorgt, dass ich bei den Prüfungen menschlich behandelt worden bin.“
„Da hast du Glück gehabt!“ warf Koja ein, dem es bei aller Teilnahme am Schicksal des Gefährten soeben durch den Kopf gefahren war, ob Robin auch an den Pantherschädel denken werde, den er ihm als Weihnachtsgeschenk versprochen hatte, oder nur immerfort von sich erzählen. — „Was, Glück?!“ ereiferte sich der Magister. „Was die Leute Glück nennen, gibt’s überhaupt nicht, ich mein so etwas wie ein Zauber oder ein Wesen, das einem unverdienterweise hilft. Es kann ja vorkommen, dass eine blinde Henn’ ein Körndl findet oder ein dummer Kerl in der Lotterie gewinnt. Aber auf so was ist kein Verlass. Hennen mit guten Augen finden sicher mehr Körner als die blinden, und ein fleissiger Arbeiter, der rechnen kann, gewinnt sicherer als ein Lotteriespieler. Am ehesten hat noch der Lateiner recht mit seinem Spruch: ‚Fortes fortuna adjuvat!‘ (Die Glücksgöttin hilft den Tapfern!); nur muss man sich’s in denkrichtiges Deutsch übersetzen. Wer alle Kraft ans Ziel setzt, der erlangt’s. Immer daran denken, was man anstrebt, jede Gelegenheit dafür ausnützen, das ist’s, womit man selber das Glück macht.“
So sehr Koja vor den Erfolgen Robins Achtung hatte, es wurde ihm beim Anhören des Selbstlobes unbehaglich. Auch wollte er nicht ohne den Pantherschädel heimgehen. Darum fragte er: „Hast du jetzt Dienst oder hast du frei?“ — „Ich hätte frei, aber ich mach’ Dienst.“ — „Wie das?“ — „Ich überwach’ die Destillation des Oleum menthae piperiti6), was eigentlich Sache des Laboranten wär’; der ist derweil gegangen, das Heiderische Zahnpulver ausliefern.“ — Koja lachte auf. „Du überwachst die Destillation? Ich merk’ nichts davon!“ — „Das verstehst du nicht. Siehst du die Flaschen da droben auf dem Kühlapparat? Und auf den Gestellen? Da ist seit den Zeiten des seligen Rotziegel eine Menge Pfefferminzkraut in Alkohol eingelagert. Der hat das ätherische Öl längst ausgezogen. Aus einer Flasche haben wir, der Josef und ich, die Flüssigkeit abgeseiht und das Filtrat in die Blase gefüllt, ich meine in die zinnerne Retorte da, die im Wasserbad auf dem Herd sitzt. Dann haben wir ein bescheidenes Feuer darunter gemacht, und jetzt steigt das ätherische Öl ganz sachte als Dunst aus dem Alkohol auf, der einen höheren Siedepunkt hat; es läuft durch die Kühlrohre und tropft in die Vorlage. Dabei habe ich schon zwei Stunden lang vergleichende Anatomie studiert. „Kann da nichts geschehen, wenn du nicht nachschaust bei der Retorte?“ fragte Koja erstaunt. Robin winkte mit der Hand ab. — „Dazu ist das Sicherheitsventil da; wird der Dampfdruck zu gross, so hebt er den Kegel im Ventil, es pfeift, und ich scharr’ die Glut unter dem Wasserbad weg.“ — „Aber das Feuer kann ausgehen, wenn du nicht nachlegst“, wendete Koja ein. „Auch dafür gibt es eine Mahnung: Achte auf das leise, regelmässige Klingen in der Vorlage! Das machen die fallenden Tropfen. Hört das Klingen auf, so stört mich das, als ob eine Uhr plötzlich stille stünde, und ich leg’ eine Schaufel Kohle nach. Die Luftzufuhr unterm Rost ist gedrosselt, es brennt nur ganz sachte.“ — „Da kannst du freilich eine Menge studieren, wenn du so Dienst machst“, sagte Koja beruhigt. Dann aber mahnte er den Kameraden an sein Weihnachtsversprechen: „Hast du den Pantherschädel noch?“ — „Wir wollen sehen“, erwiderte Robin nachdenklich. Er packte Koja am Arm und zog ihn ins Nebenzimmer. Es war eine langgestreckte Kammer mit einem Bett, einem Diwan, zwei Schränken und einem ungestrichenen Tisch beim winzigen Fenster.
Der war mit Büchern, Spannbrettern und Glasstürzen bedeckt, unter denen grosse exotische Schmetterlinge auf feuchten Sägespänen lagen. — „Das mühselige Spannen der Exoten treibst du auch noch?“ staunte Koja. „Muss ja; das Studium kostet Geld. Was ich nach Verkauf der Wohnungseinrichtung meiner seligen Mutter in die Sparkasse gelegt hab’, war bald aufgebraucht. Ausserdem: Was soll ich mit den Sachen machen, die mir der Marine-Kommissär von seinen Reisen geschickt hat, als er noch lebte? Er hat meine Schwäche für das Exotische gekannt und hat mir geschickt, was er hat erlangen können. Das Schönste behalt’ ich, das andre vertäuschel’ ich oder mach’ es zu Geld.“ —
Lorent sah sich in der Kammer um. Auf den Schränken waren wunderbare Dinge zu sehen: ein Leierschwanz, ein Gürteltier, ein kleiner Ameisenbär, ein Paradiesvogel u. a. m. Und eine Menge Bücher.
Robin zog die Diwanlade heraus. Da lagen kunterbunt gebleichte und ungebleichte Tierschädel, grosse Tonnen- und Helmschnecken, Riesenmuscheln, Korallenstöcke, Walrosszähne und allerlei Bruchstücke von Krabben und Hummern eng ineinandergeschoben. Koja kniete vor dem Wust auf dem Boden; er suchte den Pantherschädel, fand ihn aber nicht. — „Verzeih’ mir“, bat Robin, „ich erinner’ mich schon, den hab’ ich verkeilt7); hab’ gar nimmer daran gedacht, dass er dir gehört. Aber du kriegst dafür etwas anderes. Es ist komisch, aber wertvoll. Dabei entnahm er der Lade eine hölzerne Doppelfigur, die einen Neger im Kampfe mit einem wunderlichen Ungeheuer darstellte.
Koja griff begehrlich nach dem seltenen Stück primitiver8) Volkskunst. Er hob fragend die Blicke zu Robin; der nickte ihm lächelnd zu. Er gab ihm noch eine riesige Helmschnecke und einen buckligen Seestern: „Bist jetzt zufrieden?“ — „Und ob!“ Robin weidete sich an der Freude des Kameraden. Beide kehrten zum Destillierofen zurück, der regelmässige Tropfenfall klang beruhigend.
Wieder sass Koja vor dem Herd, neben sich den riesigen Seestern und die grosse Schnecke, in der Rechten das kostbare Schnitzwerk. „Es ist ein Seitenstück zum Kampf mit dem Drachen.“ Robin stand vor ihm mit dem Ausdruck des glücklichen Schenkers. Endlich fand Koja das Wort: „Ich dank’ dir!“ — „Keine Ursache, ich bin dein Schuldner; du hast mir die alte Kameradschaft gehalten, obwohl ich mit Schande aus dem Gymnasium gewiesen war; damit hast du mein Selbstvertrauen gestärkt; und als ich dann Schlosserlehrling war, hast du mir durch deine Nachhilfe in Latein und Griechisch mehr genützt, als ich dir mit den Raritäten nützen kann.“ — Woher die Stücke wären, wollte Koja wissen. „Die Negerschnitzerei stammt aus dem südlichen Sudan, die Helmschnecke aus dem Indischen Ozean, der Buckelstern aus Polynesien.“ „Also alles aus der Wunderwelt, von der du schon phantasiert hast, als wir noch kleine Jungen waren,“ warf Koja ein. „Und die ich erleben werde“, versicherte Robin. „Es kommt doch nur auf mich an. Andre sind hingekommen, Tausende, Millionen von Europäern sind hingekommen; warum gerade ich nicht, der ich weiss, was ich dort will.“ —
„Merkwürdig, wie ein Gedanke, der durch irgendein Wort, ein Buch, ein Ding in eine Kinderseele gelangt ist, sich darin festsetzen und zur treibenden Macht werden kann, Jahre hindurch, Jahrzehnte hindurch, das Schicksal gestaltend“, sprach der junge Lehrer vor sich hin.
Aus einem inneren Gedankenzusammenhang heraus fragte er scheinbar unvermittelt: „Sag Robin, wie verhältst du dich zum Alkohol?“ — „Ich schätz’ ihn als Lösungsmittel für Harze; als Genussmittel lehn’ ich ihn in jeder Form ab,“ versetzte der Magister. „Sonst könnt’ es mir so gehn wie meinem Vorgänger.“ — „Was war’s mit dem?“ fragte Koja gespannt. „Der rote Anselm“, wie er bei uns wegen seiner Haarfarbe hiess, „war ein lieber und verlässlicher Mensch, als ich unter ihm zu praktizieren begann. Damals hat er oft Nachtdienst gemacht. In den Winternächten des ersten Jahres hat er mit dem Trinken von Likören angefangen, die er sich in geringen Mengen aus Alkohol, Wasser, irgendeinem Sirup und aus kaum wägbaren Würzen von ätherischen Ölen zusammenpantschte. Später hat er sich höhere Masse angewöhnt. Und so ist es gekommen, dass er im Dienst unverlässlich wurde. Er hat ohne ärztliche Verordnung bedenkliche Medikamente abgegeben; ob gegen Bestechung, konnte der Weisswasser nicht herausbringen, aber trotz seiner Güte hat er ihm den Laufpass gegeben. — Ein paar Monate später lesen wir in der Zeitung, dass unser Anselm zu zwei Jahren schweren Kerkers verurteilt worden ist. — Warum? — Wegen Beteiligung an einem Giftmord. Nach Zeugenaussagen soll er von der Tötungsabsicht gewusst haben.“ — Lorent holte sein Notizbuch hervor.
Plötzlich erscholl ein wuchtiger Knall hinter ihm, er wollte aufspringen, fiel aber vom Sessel, niedergeworfen von Robin, der über ihn wegstolperte.
Als die beiden wieder auf die Füsse kamen, warfen sie einen entsetzten Blick auf den Herd: Der metallene Helm der Retorte war samt den Randschrauben gehoben, darunter quollen, einander drängend und fauchend, schwach leuchtende Flammen hervor; vom Herdfeuer her, in dem sich der überlaufende Alkohol entzündet hatte, stiegen Feuerzungen auf, die zur Decke strebten. Robin zeigte nach rechts, wo die grossen Alkoholflaschen nebeneinander auf dem Kühlkasten standen: „Herrgott! — Wenn eine platzt!“ — weiter kam er nicht. Von Koja gezerrt, war er im Nu bei der Türe. Er riss an der Klinke, — vergeblich. Der Druck der Heissluft wirkte auf die ganze Fläche des Türflügels. Wie ein Blitz durchzuckte die Erkenntnis dieses Zusammenhanges das Gehirn des Pharmazeuten. Da stiess er mit der Faust rasch nacheinander die zwei unteren Scheiben des nahen Fensters ein. — Jetzt ging die Tür auf. Flüchtend vor der Gluthitze der nachströmenden Luft prallten die beiden mit dem alten Laboranten zusammen, der, mit der leeren Kreunze9) auf dem Rücken, von der Materialkammer heraufkam. — „Es brennt!“ brüllte ihn Robin an. „Explosion!“ Aber statt kehrt zu machen, betrat der alte Mann bedächtig das Laboratorium, warf einen Blick nach dem Brandherd, packte mit beiden Händen das grosse Wasserschaff, in dem allerlei Fläschchen der Reinigung harrten, schleppte es unbekümmert um Hitze und Gefahr zum Destillations-Ofen und „schwups!“ übergoss er die Retorte mit dem Wasserschwall. In derselben Sekunde war das Feuer gelöscht, nur das Zischen des Wassers an den heissen Metallteilen war zu hören.
Schon umstanden Lorent, Robin, Weisswasser, Eisank und der Laborant den dampfenden Ofen. Von Robins rechter Hand floss Blut auf die vom verschütteten Wasser nassen Kehlheimer Platten und mengte sich mit den Spuren der Schuhe. — „Ja, haben Sie denn das Pfeifen des Ventils überhört?“ fragte Eisank den verlegen dastehenden Magister. — „Es hat nicht gepfiffen, Herr Provisor!“ — „Es hat nicht gepfiffen!“ bekräftigte Lorent. — Weisswasser sah mit seinen etwas hervorquellenden gutmütigen Augen von einem zum andern; dann gab er der Vermutung Ausdruck: „Der messingene Regel im Ventil wird oxydiert sein; da ist er halt unbeweglich festgesessen. — Seit Rotziegels Zeiten hat ja kein Mensch die Blase benutzt. Das hätte ich sollen bedenken und das Ventil untersuchen lassen; aber wer denkt denn auch an alles!“ — Da fiel sein Blick auf die Blutspuren, dann auf Robins Hand. — „Ich hab müssen die Scheiben einschlagen, wegen des Luftdruckes“, entschuldigte sich der Magister. „Sei’n wir froh, dass nicht mehr geschehen ist, die Zimmerdecke hätt’ können einstürzen. Kommen Sie mit nach vorn, ich verbind’ Ihnen die Hand.“
Indessen zerlegte der Provisor mit dem Laboranten den Destillier-Apparat; sie nahmen den Helm mit dem etwas verbogenen Rohr ab und untersuchten das Ventil. Wie Weisswasser vermutet hatte, sass der Kegel im Lager fest. Als der Apotheker mit Robin zurückkam, freute er sich, dass hier keinerlei Verschulden des Magisters vorlag. „Das Ventil geputzt, stärkere Schrauben in den Retortenkranz, und die Destillation kann weitergehen“, war seine Meinung.
Der Laborant hatte den Besen mit einem Tuch umwickelt und wischte den Boden auf. „Josef!“ redete ihn der Herr an. „Sie sind ein lieber, alter Kerl — gut, dass Sie zurechtgekommen sind“; dabei holte er aus der Brieftasche eine zusammengefaltete Banknote und stopfte sie dem Laboranten in die Rechte, die den Besen führte. Mit breitem, verlegenem Lächeln dankte der Diener und fuhr in seiner Arbeit fort.
Koja packte Seestern und Schnecke in Papier, die Schnitzerei steckte er in die Brusttasche.
Er nahm von Robin und den Apotheker-Leuten Abschied, um rechtzeitig heimzukommen, wo noch ein Stück Feldarbeit seiner harrte.
Unterwegs holte er immer wieder das urtümliche Kunstwerk hervor und liebäugelte damit. Dann ging er in einen Hausflur, zog das Tagebuch aus seiner Tasche und schrieb in Kürze das Ergebnis seiner Betrachtung ein: „Ein Gedanke ist Ding geworden! — Was im Inneren des Menschen sich im Falle einer ‚Versuchung‘ abspielt, ist die Bedrohung seines Wesens durch etwas Böses; die Abwehr des Bösen durch einen sittlichen Gedanken wird ihm bewusst. Beides ist in ihm, er aber empfindet das Böse als etwas von aussen Kommendes, während ihm das Gute als sein Wesenskern gilt. Er erlebt den inneren Kampf der Beweggründe und Gegengründe und will den Sieg des Guten, aus dem Grundwillen, aus dem Willen zum Sein und Gedeihen. — Er hat das Bedürfnis, sich den unvorstellbaren Kampf der Gefühle und Gedanken vorstellbar, sichtbar, greifbar und so be-greifbar zu machen. Gewohnt, in Dingbildern zu denken, schafft er dinghafte Darstellungen dieses Kampfes mit Hilfe von Ähnlichkeiten an Sinnbildern. Sein sittliches Wollen veranschaulicht er sich durch einen sieghaften Helden, das Böse durch irgendein furchtbares Wesen: so ist unter dem Schnitzmesser des Negers der Sieg eines Menschen über ein Zwittertier von Krokodil und Panther entstanden, so anderswo der Sieg des vogelflügeligen Erzengels über den fledermausflatterigen Teufel, so anderswo der Sieg des schwertbewehrten Siegfrieds über den Lindwurm, so anderswo der Sieg des Ritters Georg über den Drachen. — Sieg, immer wieder Sieg des Guten über das Böse. Warum? Weil der Mensch die Vorstellung der sieghaften Überwindung des Übels braucht, um selber den Mut aufzubringen für den inneren Kampf. — Das unbeholfene Schnitzwerk des Negers mag komisch, mag lächerlich wirken auf das verwöhnte Auge des Europäers; es ist aber wertvoll als Träger und Vermittler und Eingeber der Zuversicht, dass der innere Kampf zum Siege des Guten führe. — Es ist ein ernstes, wirksames Hilfsmittel der Selbsterziehung eines nach Selbstbehauptung ringenden kindhaften Naturmenschen, der nicht denken und wollen kann, ohne geschaut zu haben.“
Der Weg von Wien nach Giesshübel war lang, das überstandene Erlebte wuchtig.
Koja kam ins Grübeln. In der Apotheke war nichts Arges geschehen; es gab keinen Schaden und keinen Kläger. Aber was wäre geschehen ohne das besonnene und doch waghalsige Eingreifen des Laboranten? Grässliche Explosionen, Hauseinsturz, Brand, Verstümmelung, Tötung schuldloser Menschen. Dann die gerichtliche Fahndung nach einem Schuldtragenden. Die kleine Kleinigkeit, der eingerostete Ventilkegel — nicht vorbeugend geprüft —, konnte Anlass geben zur Anklage wegen Fahrlässigkeit oder Versäumnis pflichtgemässer Vorsorge, Anlass zur Verurteilung des so guten, so mitfühlenden, hilfsbereiten und so verantwortlichen Apothekers. Die Strenge des Gesetzes hätte ihm ungeheure Geldbussen zugunsten der Geschädigten auferlegen, sie hätte ihn vernichten können. Aber die Toten lebendig machen, das hätte sie nicht gekonnt.
Wäre nicht auch Robin strafbar gewesen? Hatte nicht er auch versäumt, das Ventil vor dem Gebrauch zu prüfen? Armer Robin! — Abgehetzt und verbüffelt, wie er seit Jahren war, konnte er leicht etwas Wichtiges „ausser acht“ lassen, wie er den Pantherschädel verkauft hatte, der schon nicht mehr sein Eigentum gewesen war. So durfte es nicht weitergehen. Koja fühlte sich als Freund verpflichtet, den Magister zu ausgiebiger Bewegung in frischer Luft zu veranlassen, damit er nicht verkümmere.
Wie eine Gnade kam es Lorent vor, dass die Explosion weder Robin noch ihn selbst verletzt hatte. Jedem von beiden war das Leben geschenkt, das hätte genommen sein können; da galt es nun, sich der Gnade wert zu erweisen. Robin wollte Arzt werden, ein Helfer; Koja war ein schlichter Lehrer, aber auch er wollte ein Heilbringer sein: den Gedanken der Verantwortlichkeit wollte er in die Seelen der werdenden Menschen pflanzen. Für Leibesübungen und gute Beschäftigung wollte er die Kinder und die Erwachsenen begeistern, dass in gesunden Leibern gesunde Seelen seien.