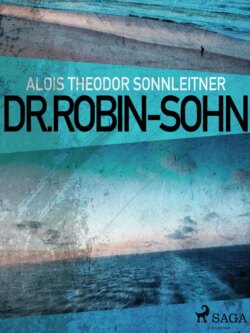Читать книгу Dr. Robin-Sohn - Alois Theodor Sonnleitner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Kameradschaftsabend
ОглавлениеMutter Maria und Agi wussten, dass ihr Koja des geselligen Verkehrs mit geistig regsamen Altersgefährten bedurfte. Da schlugen sie ihm vor, dass er monatlich einmal seine Freunde zu sich lade. Für die Bewirtung wollten sie gerne sorgen. Die Familie war ja nicht mehr in Not. Koja war schon als Aushilfslehrer an Wiener Schulen tätig und verdiente dazu als Hauslehrer und Schriftsteller. Agi, die als Handarbeitslehrerin in Wien zu lange auf eine Anstellung hätte warten müssen, war als Übersetzerin für Tschechisch bei der Direktion der Staatsbahnen tätig. Dazu kam noch, dass der Käufer des Giesshübler Anwesens, der die darauf lastenden Hypotheken und die Sorge für die alte Wabi übernommen hatte, monatlich kleine Abschlagszahlungen an die Lorentischen leistete. Es glückte Koja, zum ersten Kameradschaftsabend fast alle seine wertvollen Freunde zusammenzubringen. Es fehlte nur Dolo Karpellus, der gerade in Frankreich weilte, dafür war der Bildhauer Albert Schaff als neuer Freund da, der den andern ebenbürtig war. Als mittelloser Akademiker verdiente er sich den Lebensunterhalt durch kunstgewerbliche Arbeiten; er modellierte sogar Schachfigürchen. Aber daneben beteiligte er sich an Wettbewerben, bei denen es ums Höchste ging.
In der Einladung hatte es geheissen: „Jeder bringe etwas zur geistigen Anregung mit.“
Kolo Moser, Leo Kainradl und Wilh. von Münchhausen kamen mit ihren Skizzenbüchern, Albert Schaff mit einer Mappe photographischer Wiedergaben seiner plastischen Arbeiten. Der Germanist Hans Paul brachte seinen jüngst erschienenen Band lyrischer Gedichte und der Lehrer Raimund Peter eine Sammlung von Volksliedern aus den Karpathen. Magister Robin hatte sich mit einem sauber gebleichten Pavianschädel und einer Hummerschere eingestellt.
Nach dem Abendessen, das Mutter und Agi mit Herzlichkeit geboten hatten, wurde die Gesellschaft lebhaft. Koja griff zur Laute und trug das Paulsche Lied vom Haus der Sehnsucht vor, dann stieg das unvermeidliche Gaudeamus, von sieben lebfrischen Burschen gesungen.
Zunächst kam die Mappe des Bildhauers Schaff daran, der jüngst auf seine lebensgrosse Gruppe „Bethlehemitischer Kindermord“ den Rompreis erhalten hatte und sich jetzt vor der Italienreise verabschieden wollte.
Im Verlauf des weiteren Abends, während Hans Paul und Raimund Peter vorlasen und die Skizzenbücher der Maler durchmustert wurden, rauchte Schaff im Hintergrund der Stube sein Pfeifchen, von Koja gedeckt, von Robin unbeachtet; er bekritzelte die Manschetten mit allerlei Ansichten vom Kopf des Magisters.
Flüsternd erfragte Koja die Ursache des verstohlenen Zeichnens: Schaff hatte von einem reichen Brasilianer den Auftrag bekommen, von dessen Sohn eine Büste anzufertigen. Dazu war ihm aber nur ein Lichtbild mit der Vorderansicht des Kopfes beigestellt worden. — Nun hatte er entdeckt, dass Magister Robin eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Sohn des Brasilianers hatte, und holte sich bei guter Gelegenheit die Seitenansicht, die Dreiviertel- und Siebenachtel-Ansicht des Doppelgängers, um für das Modellieren genug Anhalt zu haben.
Schaff bestand darauf, Robin solle nichts vom Vorhandensein seines Doppelgängers erfahren. — „Es ist immer etwas Unheimliches um das Doppelgängertum“, meinte er, „es führt leicht zu Schicksalsverknotungen; wir wollen uns da nicht einmengen.“
Da fesselte der Magister durch Vorlegen des Pavianschädels die Aufmerksamkeit aller: „Was finden die Herren an diesem Schädel Besonderes?“
Einer nach dem andern nimmt das Stück in die Hand und dreht es hin und her. Da meldet sich Peter: „Die oberen Fangzähne und die meisselförmigen Schneidezähne sind ganz unverhältnismässig überentwickelt.“
Robin macht eine geringschätzige Handbewegung: „Das mein’ ich nicht!“
„Sag lieber, auf was du zielst“, fragt Koja. — „Eine organische Schere ist da!“ behauptet Robin. „Eine Schere?“ wundern sich Münchhausen und Paul zugleich. „Ich hab’s!“ ruft Peter. „Die Hinterkante des oberen Eckzahns und die lange Vorderkante des ersten Vor-Backenzahns spielen zusammen wie die Schneiden einer Schere.“ —Robin nickt befriedigt. „Aber fein ist das, was? Gerade der erste Backenzahn, der meist wegen der Nachbarschaft des Eckzahns verkümmert ist, hat hier die mächtige Entwicklung eines tüchtigen Schneid-Organs.“ — „Und seine Wurzel sitzt viel tiefer als die seiner Nachbarn!“ ergänzt Robin, „just als wär’s darauf abgesehen, dem Zahn schon von unten herauf eine lange Schneide zu geben.“ Koja holt einen Fuchsschädel von seinem Schreibtischaufsatz und legt ihn neben den Pavianschädel. „Da habt ihr gleich eine Reihe Doppel-Scheren links und rechts!“ — Alle staunen. Und sie müssen es zugeben. Die sägeförmig angeordneten Backenzähne spielen Kante auf Kante ein.
Nun legt Robin die Hummerschere neben den Fuchsschädel: „Was sagt ihr dazu?“ „Hm“, meldet sich Peter, „wir können die Schere des Hummers als seine Hand bezeichnen; dann drängt sich uns die Tatsache auf, dass er ein richtiges Gebiss in der Hand hat. Die Schneidkanten seiner Schere sind ja mit Zähnen besetzt, die aneinanderpassen wie die Backenzähne des Fuchses. Und die langen Eckzähne vorne dran weichen einander aus wie die Fangzähne eines Raubtiers.
Koja geht in die Küche und holt die stählerne Knochenschere, die zum Geflügelzerteilen dient, aus der Tischlade. Er legt sie neben die Hummerschere und schaut fragend von einem zum andern: „Was findet ihr an diesem Küchenwerkzeug?“ „Eine merkwürdige Übereinstimmung mit Fuchsgebiss und Hummerschere,“ stellt Peter fest. „Wenn der Mensch Knochen zerbeissen will, dann macht er’s ähnlich wie der Hummer. Nur hat er die Gebissschere nicht am Leibe angewachsen, sondern er hat sie ganz ausserhalb seines Leibes und regiert sie mit der Hand. — Dabei hat er den Vorteil vor dem Hummer, dass er das Werkzeug nach dem Gebrauch weglegen und ein andres zu andrem Gebrauch in Tätigkeit setzen kann, z. B. einen Hammer, um etwas zu zertrümmern. Der Hummer aber kann von seinem angewachsenen Werkzeug, dem Organ, nur einerlei Gebrauch machen; eine starkschalige Schnecke vermag er nicht zu erlangen, wenn sie ihr Haus durch einen dicken Türdeckel schliesst.“ — „Wie zum Beispiel die Ölkrugschnecke,“ warf Robin ein. „Wollt ihr behaupten, dass der Erfinder der Knochenschere die gezähnte Schere des Hummers nachgeahmt hat?“ fragte Kainradl dazwischen. — „Durchaus nicht“, erwiderte Koja mit Bestimmtheit. Die wichtigsten Werkzeuge sind in Urzeiten erfunden worden, das Verständnis der Technik in der Natur ist eine Errungenschaft neuzeitlicher Forschung. Aber der Antrieb ist in beiden Fällen gleich. Aus einem Bedürfnis heraus bildet sich im Leib und am Leib der Pflanze,10) des Tieres wie des Menschen das Organ, aus einem Bedürfnis heraus schafft sich der Mensch das Werkzeug, und zwar mit Hilfe seines ihm gewachsenen Universalwerkzeugs, der Hand.“ — Kolo Moser liess sich vernehmen: „Die Übereinstimmung zwischen Werkzeug und Organ, wie sie am verblüffendsten am Auge und bei der photographischen Kamera erkennbar ist, deutet unzweifelhaft auf etwas Gemeinsames hin, das in der organschaffenden Natur wie im werkzeugschaffenden Menschen tätig ist. „Richtig!“ pflichtete ihm Koja bei. „Im Sinne Kapps, der die ‚Philosophie der Technik‘ geschrieben hat, nennt Du Prel dieses in der Natur wie im Menschen zweckdienlich Schaffende ‚das organisierende Prinzip‘.“ „Na ja,“ liess sich Kainradl vernehmen, „ein langer Name für das kurze Wort ‚Gott.‘“ Koja fuhr fort: „Und was wir als Verlegung des Gebisses aus dem Leib heraus ins Werkzeug, nämlich in die Knochenschere, festgestellt haben, nennt Kapp ‚Organ-Projektion‘. Die Verlegung des Gebisses nur in ein andres Organ desselben Leibes, wie beim Hummer in die Hand, ist ein Beispiel für ‚halbe Organ-Projektion‘.“
Hans Paul, der Sprachkundige, griff das Wort auf: „Pro-jícere, vorwerfen, nach aussen verlegen. — Wer wirft vor? Wer projiziert? Nicht der Hummer, der von der Technik in der Natur keine Ahnung hat, gar bevor er als Krebslein im Ei sich die Schere wachsen lässt. — Der Dozent Wilhelm Jerusalem hat in einem Vortrag über die Denkform, die im Satzbau zur Geltung kommt, erklärt, warum die Menschen dem Tätigkeitswort ein Täter-Wort — den Satzgegenstand — zugesellen: weil die Erfahrung lehrt, dass überall, wo etwas getan wird, ein Täter da ist, der es bewirkt.“ — Paul nahm von Kojas Schreibtisch die faustgrosse Pyramide eines Bergkristalls, die als Briefbeschwerer diente, und legte sie mitten auf den Tisch. — „Dass eine ägyptische Pyramide einen geistigen Urheber hat, der sie erst gedacht und dann gewollt hat — und dann erst hat bauen lassen, daran zweifelt kein Mensch. — Ob aber diese genau nach sechziggradigen Winkeln gebaute Kristall-Pyramide einen Urheber hat, darüber sind die Meinungen geteilt. — Für mich gibt es da keinen Zweifel. Was wir hier beim Kristall an genauer Befolgung eines Bauplanes sehen, nach dem sich die Molekel gerade so und nicht anders aneinander gefügt haben, ist ein im Stoff betätigtes Gesetz. Und jedes Gesetz ist etwas Geistiges — ein Willensgedanke. Wunderbarer aber als an der Cheops-Pyramide, wunderbarer als an der Kristallpyramide ist das Gestaltungsgesetz im pflanzlichen Samen wie im tierischen Ei organ-wollend und -schaffend angewandt. Ob wir mit einem Fremdwort den Urheber ‚Organisierendes Prinzip‘ nennen oder mit dem volkstümlichen Worte Gott bezeichnen, wir meinen dasselbe. — Kehren wir zum Worte Organ-Projektion zurück: Denkt an die Projektions-Lampe des Skioptikons, eine Vervollkommnung der ‚Zauberlaterne‘! Da ist im Innern der Lampe ein starkes Licht, vor dem Licht ein Gegenstand, das Bild auf Glas, sagen wir das Bild einer Palme; vor dem Bild ist eine Glaslinse. Das Licht geht durch das Palmenbild und wirft es durch die Linse auf die entfernte Wand. — Die Palme ist also vom inneren Lichte nach aussen geworfen worden, — pro-jiziert, sie ist auf der Wand sichtbar geworden, dinghaft. — Und jetzt denkt an den schaffenden Künstler, den Maler, den Bildhauer, den Architekten! — „Bleiben wir beim Bildhauer, der Einfachheit halber!“ rief Schaff dazwischen und trat näher an den Tisch. Im Eifer des Vorausdenkens fuhr er fort: „In der Seele des Bildhauers ist die Vorstellung einer Gestalt, sagen wir der Gestalt Pestalozzis: ein hagerer, alter Mann mit gütigem, glattrasierten Gesicht, das lange Haar zu einem Zopf verflochten, der langschössige Rock um den mageren Leib schlotternd, die Kniehosen ungeknöpft, die Strümpfe verschoben, die Schnallenschuhe grob und schadhaft. An der Hand führt er ein Kind, das vertrauensvoll zu ihm aufblickt, er lächelt dem Kind zu. — So steht das Bild des Armeleut-Erziehers in der Seele des Bildhauers. Menschen schauen ihm ins Gesicht und ahnen nichts von der Gestalt Pestalozzis, die als Vorstellung, als Bild im Künstler ist. — Da flammt in ihm der Willensgedanke auf, die bloss gedachte Gestalt, so wie sie in ihm ist, nach aussen zu verlegen, sichtbar, dinghaft zu machen. Er knetet den weichen Ton und formt ihn so, dass die in seinem Innern gewesene Gestalt Pestalozzis mit allen Einzelheiten vor ihm ent—steht. Hört ihr das Wort: sie ‚ent—steht‘. Sie wird aus ihm herausgestellt, projiziert. — Der Gedanke, der unsichtbare, ist sichtbar, ist körperhaft geworden. Und wer die modellierte Figur sieht, fragt nach dem Bildbauer, der sie geformt hat; denn jeder weiss, dass da einer gewesen sein muss, der ‚den Gedanken‘ ver-‘wirklicht‘ hat.“ — Von den Gesichtern aller Zuhörer leuchtete klares Verständnis und stille Begeisterung. Paul riss das Wort wieder an sich:
„Was ist alles menschliche Wirken andres als das Verlegen eines Gedankens von innen nach aussen? Da ist ein Gedanke in der Menschenseele, ein Wunschgedanke, ein Willensgedanke, ein Gestaltungs-, ein Erkenntnisgedanke. In dem steckt die Bestimmung zur Mitteilung, zur Wirkung auf andere; das ist jedem Gedanken eigen. Dies ist sein Leben, sein Daseinszweck. Aber an sich ist der Gedanke nichts Dinghaftes, nichts Wahrnehmbares, wenn auch etwas Wesenhaftes, in dem Kraft ist. Als etwas Geistiges ist der Gedanke im Innern eines Menschen, noch ist seine Kraft den anderen verborgen. Da spricht der Mensch den Gedanken aus, er wirft ihn im schallenden Wort nach aussen; — schon vermag der hörbar gewordene Gedanke auf andre zu wirken, vermag Mitleid, Mitfreude, vermag Mitwollen und Mittun auszulösen. Der Mensch schreibt den Gedanken nieder, er zeichnet ihn, er malt ihn in Farben, er modelliert ihn in Ton, gestaltet ihn in Stein, Holz, Bein oder Metall.
Vorgedacht und dann gebaut, ersteht das Werkzeug, das Wohnhaus, der Tempel, die Pyramide, das Denkmal. Der sichtbar gewordene Gedanke vermag als Werkzeug zum Schaffen zu reizen, er vermag Behagen, Andacht, Begeisterung auszulösen, er vermag durch Jahrtausende auf immer neue Nachfahren des längst abgeschiedenen Urhebers zu wirken.
Wir sehen die Welt um uns, die Erde, die Gestirne und auf der Erde die Lebewesen, deren jedes, auch das kleinste, wieder eine planmässig gebaute, gesetzmässig von Bewegung durchschwungene Sonderwelt ist, ein Mikrokosmos; auch der Mensch ist eine solche Welt im kleinen, von sich selbst nur geahnt, nicht in letzten Einzelheiten gekannt, nicht durchschaut. Und dennoch atmet er; das Herz schlägt, das Blut strömt, das Gehirn dient dem Geiste, der ein inneres Kraftlicht ist, aber sich selbst ein Rätsel. — Brüder! Es gibt für mich keinen Zweifel, dass im ganzen Weltall, wie im kleinsten Wesen, ein geistiger Urheber der Naturgesetze am Werke ist, der seine Gedanken ins Körperhafte umsetzt oder — wie wir sagen können — projiziert, nicht anders, als jeder Künstler, jeder Dichter, jeder Techniker den Gestaltungsgedanken ins Dinghafte umsetzt. — Die Welt ist aus einem Grundwillen geworden, auf den wir aus seinen Wirkungen schliessen. — Wir sind wieder bei der Weisheit Platons angelangt; der hat vor zwei Jahrtausenden gelehrt, dass die Dinggedanken früher da waren als die Dinge selbst. Auch bevor die Welt wurde, musste der Weltgedanke dagewesen sein. Wie sagt Johannes? Im griechischen Urtext heisst es: ‚En archee een ho lógos, kai ho lógos een pros ton theón, kai theós een ho lógos,‘ das heisst: ‚Im Anfang war der Gedanke, und der Gedanke war bei Gott, und Gott war der Gedanke.‘ — Sagen wir für Logos11) getrost der Gedanke. Das Wort ist ja die Gestalt des Gedankens. Heraklit und Herodot gebrauchen Logos für Vernunft; also Gott der Gedanke oder die Vernunft im All. — Ich kenne keine bessere Erklärung der Entstehung der Welt; sie ist eine Projektion, eine Verkörperung des Gedankens. Darum sind alle Dinge gestaltet vom Geiste, auch der Mensch; es sind nur in Erscheinung getretene, wahrnehmbar gewordene Gedanken.“ Der letzte Satz war verklungen. Alle erhoben sich und nahmen still von Koja Abschied.
Agi und Mutter waren längst schlafen gegangen.
Nachdenklich räumte Koja seine Stube auf und machte sich das Bett zurecht. — Da fiel sein Blick auf eine Tonskizze, die er einst dem Bildhauer abgebettelt hatte. Es war eine „Ecce Homo“-Gruppe: Christus mit dem Spottrohr —, ein sichtbar gewordener Gedanke aus der Tiefe der Vergangenheit in die Gegenwart gestellt.