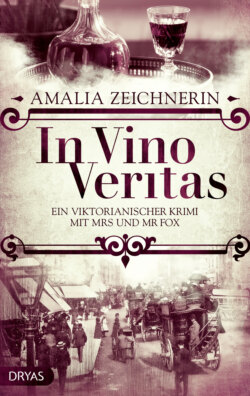Читать книгу In Vino Veritas - Amalia Zeichnerin - Страница 5
Kapitel 2 – Clarence
ОглавлениеSonntag, 5. November 1854
Eine schlaflose Nacht in der Fremde. Schmutz und Schlamm der vergangenen Tage klebten an Clarence und der starke Regen hatte seine Kleidung durchweicht. Hier draußen auf dem Schlachtfeld gab es weder Möglichkeiten, sich zu waschen, noch nasse Kleidung zu trocknen. Zum Himmel, er hatte die Schlacht von Alma Ende September überlebt, aber jeden Abend vor dem Einschlafen – wenn denn an Schlaf zu denken war – fragte er sich, wie viele Tage ihm noch auf dieser Erde vergönnt sein würden. Also tat er das, was jeder gottesfürchtige Soldat machte – beten. Manchmal waren es auch tagsüber Stoßgebete gen Himmel, doch meistens fand er dazu keine Zeit. Hoffentlich würde Gott ihn verschonen! Aber er betete nicht nur für sich, sondern auch für Martin Raynes, einen Kameraden, den er auf der Reise hierher kennengelernt hatte. Sie hatten sich unterwegs angefreundet. Martin Raynes war im gleichen Regiment und mit etwas Glück würden sie einander nicht so bald aus den Augen verlieren. Er schlief in einem der anderen Zelte.
In dieser Nacht war es eiskalt. Eine feuchte Kälte kroch Clarence in die Glieder und ließ ihn frösteln. Seine Kleidung hatte er abends zum Trocknen aufgehängt. Er schlief in Unterwäsche und die einfache Wolldecke konnte die Kälte der Nacht nicht von ihm fernhalten. An Schlaf war kaum zu denken, Clarence wachte immer wieder auf. Zwischendurch sandte ihn die Erschöpfung in einen unruhigen Dämmerzustand. Aufgrund des ständigen Frierens hatte er sich erkältet, sodass er viel hustete.
Doch das war es nicht allein, was ihn vom Schlaf abhielt. Unten in Sewastopol läuteten die ganze Nacht über Kirchenglocken, noch dazu spielten Musikkapellen – ein Lärm, der bis hinauf in die steilen Hänge des Mount Inkerman drang. Er war sich nicht sicher, welche Strategie hinter diesem Radau steckte.
In den frühen Morgenstunden schreckte Clarence noch vor Einsetzen der Dämmerung aus dem Halbschlaf hoch – Schüsse! Verdammt, und das so früh! Er hatte noch nicht mal einen heißen Tee trinken können, um sich aufzuwärmen. Von einer Mahlzeit ganz zu schweigen. Man mochte meinen, diese banalen Dinge spielten keine Rolle hier draußen auf den Schlachtfeldern, doch viele Gespräche der Soldaten drehten sich genau um das: ausreichend Schlaf, Nahrung und etwas zum Aufwärmen. Erst gestern hatte Martin ihm von einem Bratenrezept seiner Mutter vorgeschwärmt.
Draußen vor dem Zelt brüllte jemand Befehle. Sie mussten zum Dienst antreten, sofort! Hastig warf Clarence sich in die Uniform, die kaum getrocknet war. Der Stoff klebte ihm unangenehm auf der Haut, aber das war nebensächlich. Mit etwas Glück würde dieser durch die Körperwärme trocknen. Aber Himmel Herrgott noch mal, warum griffen diese Bastarde im Dunkeln an? Das war allerdings nicht das einzige Problem, wie er feststellte, als er das Zelt verließ. Draußen herrschte dichter Nebel, fast wie an manchen Tagen in London. Die Sicht lag unter zehn Metern. Verdammter Mist! Er griff nach seinem Gewehr, räumte sein Zelt leer und baute es mit wenigen Handgriffen ab. Eine Explosion in einiger Entfernung, weiter oben auf dem Berg; ein Pferd rannte mit panischem Wiehern an ihm vorbei. Um ihn herum Schreie, ein teuflisches Gebrüll, dann wieder Schüsse, das reinste Chaos!
Ein Soldat rempelte ihn mit seinem Gewehr an, während er vorübereilte.
»Was ist denn los?«, rief er ihm nach, doch der Mann hastete weiter, ohne ihm zu antworten.
Kurz darauf befand er sich in Gesellschaft seiner Kameraden. Undeutlich vernahm er einen Befehl, der im Lärm unterging. War das Offizier Wheeler gewesen? Er war sich nicht sicher. »Hast du das verstanden?«, fragte er den Mann neben ihm.
»Wir sollen in Richtung Heimatkamm, die brauchen da oben Verstärkung.«
»Verdammt, das Zündpulver ist nass geworden!«, rief ein anderer Soldat, dessen Gewehr offenbar versagte.
Immer wieder blitzte im Nebel Mündungsfeuer auf. Die feuchte Luft schmeckte durchdringend nach Schießpulver und Schlamm. Weiter oben, auf dem Heimatkamm, wie sie ihn nannten, befanden sich zwei Feldbatterien, die ohne Unterlass feuerten. Ob dieses Sperrfeuer und der Nebel vor ihrem Feind verbergen konnten, wie wenig Kampfkraft sie hier zur Verfügung hatten?
Als sich Clarence mit den Kameraden dem Kamm näherte, wurden sie angegriffen. Schüsse peitschten durch die Luft. Wieder wurde weiter vorn ein Befehl gerufen, den er in dem höllischen Lärm nicht verstand. Und dann dieser verfluchte Nebel!
Übelkeit erfasste Clarences Magen, als in seiner Nähe ein Mann getroffen wurde und zu Boden stürzte, das Gesicht zerstört und blutüberströmt, wie er im Aufblitzen des Sperrfeuers bemerkte. Rasch wandte er sich ab und feuerte in die Richtung des Feindes. Dies jedoch gestaltete sich als das reinste Rätselraten, weil er nicht auf Sicht schießen konnte. Er stolperte über einen Gefallenen und der Schlamm tat sein Übriges – Clarence verlor den Halt und stürzte in den Matsch. Weitere Männer fielen in seiner Nähe.
Clarence rappelte sich auf, ließ sämtliche Gedanken hinter sich, war nur noch Instinkt. Er durfte jetzt nicht an den Tod denken! In seinen Adern brodelte es, während sein Gesicht von Schweiß und Schlamm verschmiert war. Er fuhr sich über die Augen, doch das änderte nichts. Clarence griff nach seiner Enfield Rifled Musket, ein Vorderladergewehr, das in den Schlamm gerutscht war. Wieder das Aufblitzen des Sperrfeuers weiter oben, wie in einem Gewitter.
Ohne einen Plan stolperte er vorwärts, rutschte an manchen Stellen über den feuchten, matschigen Boden. Dabei stieß er fast gegen einen Mann, der am Boden lag, und erstarrte, als das Licht des Sperrfeuers sekundenlang dessen Gesicht beleuchtete.
Clarence ließ sich neben den Mann auf die Knie fallen. »Raynes!«
Sein Kamerad gab röchelnde Laute von sich, sein Hals war blutüberströmt. »Es geht zu Ende mit mir, Fox.«
»Nein, sag das nicht. Ich …« Aber es war zu spät. Martin Raynes schloss die Augen und verstummte. Wieder ein Schuss, diesmal ganz in der Nähe!
Clarence rappelte sich auf. Plötzlich zerfetzte ein grelles Leuchten den Nebel. Mit einem kreischenden Bersten dröhnte die Explosion in seinen Ohren; die Druckwelle schleuderte ihn durch die Luft. Ein stechender Schmerz drang in sein Bein, als er in den kalten Schlamm fiel – womöglich ein scharfkantiger Stein, der ihm die Haut aufgerissen hatte? Wankend richtete er sich auf und griff nach dem Gewehr, das vom Schlamm verschmiert war. Der Schmerz in seinem Bein war stärker geworden, aber er konnte noch gehen.
In diesem Moment riss es ihn ein weiteres Mal von den Füßen. Der Schuss erreichte seine Ohren erst Sekundenbruchteile später. Schließlich fraß sich ein beißender Schmerz in seinen Oberschenkel, der diesen auseinanderzureißen schien. Clarence stürzte zu Boden, ließ im Fallen das Gewehr los. Dann … nichts mehr. Dunkelheit senkte sich über ihn und der höllische Lärm des Schlachtfeldes verstummte.
Als er Stunden später aus jener tiefen Bewusstlosigkeit erwacht war, erfuhr er von einem Kameraden, dass sie die Schlacht gewonnen hatten, was dem Eingreifen französischer Truppen unter General Bosquet zu verdanken war. Clarence konnte nicht aufstehen, sein Bein versagte ihm den Dienst. Zwei Soldaten betteten ihn auf eine Trage und brachten ihn ins Feldlazarett. Dort roch es übelerregend, eine Mischung aus eiternden Wunden, dem metallischem Gestank von Blut, Schweiß und Karbolsäure. Ein Arzt untersuchte seine Verletzung. »Sie haben doppelt Pech gehabt«, teilte er ihm mit. »Ich habe Ihnen eine Kugel entfernt – diese hier.« Der Mann drückte ihm das blutige kleine Geschoss in die Hand. Clarence steckte es sich in die Hosentasche. Wie er annahm, stammte es aus einem russischen Gewehr. »Bedauerlicherweise haben Sie sich bei Ihrem Sturz auch noch einen Bruch zugezogen. Den kann ich hier nicht behandeln, unser Lazarett ist überlastet mit Schwerverletzten.«
Auf Anordnung von Lieutenant Colonel Holbrooks wurde Clarence zusammen mit anderen Verletzten auf eines der Versorgungsschiffe gebracht. Dieses brachte ihn nach Konstantinopel, der Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Von der Reise bekam er nicht viel mit, weil er aufgrund der starken Schmerzen in einem Dämmerzustand schwebte. In grässlichen Visionen sah er immer wieder Raynes vor sich und hörte dessen letzte Worte, ehe er aus dem Leben schied. In den wenigen Augenblicken, in denen Clarence bei Bewusstsein war, versuchte eine Krankenschwester ihm Nahrung und Wasser einzuflößen, aber er behielt nicht viel davon bei sich. Clarence verspürte keinen Hunger, nur ein dumpfes inneres Nagen, als hätten die Geschehnisse ein Loch in seinen Magen gerissen. Oder vielmehr in seine Seele. In manchen Momenten meldete sich sein Gewissen: Warum hatte er Martin Raynes nicht retten können? Warum um alles in der Welt hatte er selbst überlebt und nicht sein Kamerad?
Das Erste, was er in dem zentralen britischen Lazarett in der Selimiye-Kaserne in Konstantinopel nach weiteren Stunden fiebrigen Dämmerns bewusst wahrnahm, war das Gesicht der Krankenschwester, die seine Wunde reinigte und ihm gut zuredete. Ihre freundlichen braunen Augen fielen ihm auf, und schon bald sehnte er sich nach deren Anblick, während die Frau mit anderen Patienten beschäftigt war.
»Sie wären fast gestorben, wissen Sie das, Sir?«, erzählte sie ihm mit sanfter Stimme, nachdem sie sich ihm als Mabel Tallys vorgestellt hatte. »Und diese Infektion macht mir Sorgen, aber die werden wir hoffentlich in den Griff bekommen. Es wird schon alles gut werden, Sir.« Ihre Stimme klang zuversichtlich. Allerdings brannte die Wunde, die er selbst im Liegen nicht sehen konnte, wie Feuer. Woher nahm diese Krankenschwester nur ihre Zuversicht?
»Wegen der Entzündung konnten wir Ihr Bein weder schienen, noch war es möglich, einen Gips anzulegen. Ich muss gestehen, dass uns auch die Gipsbinden ausgegangen sind. Sie werden weiter still liegen müssen, bis es besser geworden ist. Bewegen Sie sich nicht. Rufen Sie nach mir oder einer anderen Schwester, wenn Sie den Nachttopf benötigen. Und versuchen Sie, etwas zu trinken. Hier.« Sie hielt ihm einen Becher an die Lippen.
Clarence nickte ihr zu. Er war dankbar für ihre Worte und schöpfte Hoffnung. Durstig nahm er einen Schluck. Das Wasser schmeckte nicht gut, aber diesmal konnte er es wenigstens bei sich behalten und er verspürte keine Übelkeit. Wenn nur dieses entsetzliche Brennen in seinem Bein aufhören würde! Die Luft in dem Raum, in dem er lag, schmeckte nach Blut und den Ausdünstungen der Patienten. Trotz der zum Teil geöffneten Fenster war es stickig, noch dazu erklangen immer wieder Schmerzensschreie. Einige der Verletzten wimmerten leise. Ein Mann gab wispernd das Vaterunser von sich, wieder und wieder. Wenig später glitt Clarence in einen unruhigen Schlaf hinüber.
Nachts schreckte er hoch, denn ganz in seiner Nähe leuchtete etwas auf. Er sah die Silhouette einer Frau mit einer Laterne. Sie ging durch den Krankensaal.
»Schon gut, Sir«, sagte sie zu ihm und hob beschwichtigend eine Hand – offenbar hatte sie gesehen, wie er aufgeschreckt war. Es war nicht die Krankenschwester, die tagsüber mit ihm gesprochen hatte. Diese hier war zierlich und hatte ein ernstes Gesicht. Ihr Haar trug sie streng gescheitelt. »Ich bin Miss Nightingale und gehe hier nachts eine Runde, um nach den Patienten zu sehen. Benötigen Sie irgendetwas?«
»Nein, vielen Dank. Ich habe mich nur erschrocken.«
»Das lag nicht in meiner Absicht. Schlafen Sie gut.«
Er bedankte sich und zog sich die Decke über den Kopf. An Schlaf war vorerst nicht zu denken, zu sehr schmerzte sein Bein. Aber dass hier jemand nachts mit einer Lampe umherging, um über ihn und die anderen Verletzten zu wachen, bescherte ihm ein tröstliches Gefühl.
*
Sonnabend, 19. April 1879
Clarence war wie gefangen in seinen Erinnerungen, die ihm plötzlich wieder vor Augen standen, dabei war jene Zeit doch schon so lange her! Wieder hatte er Martin Raynes’ bleiches Gesicht vor Augen, von Dreck und blutigen Spritzern bedeckt. Der Freund, dem er nicht mehr hatte helfen können. Einen Moment lang wusste er nicht, wo er sich befand und welches Jahr sie hatten. Er war wieder auf diesem nebligen Schlachtfeld bei jenem Berg, den die Briten »Inkerman« nannten. Und dann zerbrach etwas in ihm. Sein Gesicht verkrampfte sich und er fühlte Tränen über seine Wangen laufen.
Nein, das durfte er nicht. Sein Vater hatte ihm beigebracht, dass Männer nicht weinten, und das hatte er auch seinem Sohn vermittelt. Aber er konnte die Flut, die über ihn hereinbrach, nicht aufhalten. Unaufhaltsam rannen ihm Tränen über die Wangen und ein Schluchzen schüttelte seinen Körper. Er brauchte etwas Hochprozentiges, auf der Stelle! Das hier konnte er keine Sekunde länger ertragen. Allmählich dämmerte ihm, wo er sich befand. Er war nicht mehr im Krieg. Die 1850er waren lange vorbei. Doch noch immer geisterten die Geschehnisse von damals durch seine Erinnerungen.
Clarence zog die Bettdecke beiseite, stand mit wackligen Beinen auf und hinkte ins Wohnzimmer hinüber. Als er die Kerze in dem Messinghalter auf dem Beistelltisch anzünden wollte, zitterte ihm die Hand so sehr, dass ihm der Halter entglitt und mit einem lauten Knall auf die Dielenbretter fiel – dorthin, wo kein Teppich das Geräusch dämpfte. »Verdammt!«, entfuhr es ihm. Im Dunkeln tastete er nach dem Halter.
»Clarence?« Das war Mabel. Als es ihm endlich gelang, die Kerze zu entzünden, sah er seine Frau im Nachthemd und mit offenem Haar in der Tür stehen. »Ist alles in Ordnung?«, fragte sie sanft. »Ich habe ein lautes Poltern gehört.«
»Ja. Nein. Mir ist der Kerzenhalter runtergefallen«, erwiderte er heiser. »Ich … ich hatte wieder Erinnerungen an den Krieg, und dann war es auf einmal so wie damals und ich … Beim Himmel, ich brauche etwas zu trinken!«
»Soll ich dir einen Tee machen, mein Lieber?«
»Nein. Mir ist nach einem Whiskey.«
Sie nickte. »Setz dich, ich schenke dir einen ein.«
»Danke, Liebes.«
Es war nicht das erste Mal, dass ihn die Erinnerungen aus dem Krieg einholten. Und es war auch nicht das erste Mal, dass sie diese Unterhaltung führten. Clarence war Mabel dankbar, dass sie ihm keine Vorhaltungen machte. Natürlich war Alkohol nicht die Lösung seiner Probleme, das wusste er selbst. Aber es gab nichts, was er gegen die quälenden Erinnerungen tun konnte. Manchmal drängten sie sich so sehr in den Vordergrund, dass er ihnen nicht entkommen konnte. Alkohol dämpfte sie ein wenig, wenn er Glück hatte, löschte sie aber nicht aus.
Er war seiner Frau ins Wohnzimmer gefolgt und nahm auf dem Sofa Platz. Mabel reichte ihm ein Glas. Hastig stürzte er die brennende Flüssigkeit hinunter. Diese fraß sich mit einer Schärfe seine Kehle entlang, die den Schmerz in seinem Inneren allmählich betäubte. Mit dem Ärmel seines Pyjamas wischte er sich über das tränenverschmierte Gesicht. »Ich werde Raynes’ Gesicht nie vergessen«, stieß er hervor. »Aber ich habe es so satt, dass mich dieser Anblick nach mehr als zwanzig Jahren noch immer quält. Das ist doch nicht normal!«
Mabel setzte sich neben ihn und legte einen Arm um seine Schultern. Er stellte das leere Glas ab und lehnte sich an sie.
»Kann es sein, dass die Erinnerungen wegen Mr Holbrooks’ Tod zurückgekehrt sind?« Mabels Stimme war sanft und mitfühlend. »Weil ihr euch damals im Krieg begegnet seid?«
»Ja, da magst du recht haben«, räumte er mit einem Seufzen ein.
»Ach, mein Lieber, das tut mir so leid für dich.« Traurig blickte sie ihn an. »Bestimmt sieht morgen alles wieder freundlicher aus.«
»Das hoffe ich.« Clarence seufzte. Seine Frau war es gewesen, die in jenem Lazarett in der Selimiye-Kaserne den Militärarzt Doktor Tyner auf die sich verschlimmernde Infektion in seinem Bein aufmerksam gemacht hatte. Und heute, so viele Jahre später, wurde ihm wieder einmal gewahr, dass nicht viel gefehlt hatte, und man hätte ihm das Bein amputieren müssen. Unter Umständen wäre es noch schlimmer gekommen – viele Soldaten waren damals an Blutvergiftungen, Wundbrand oder Infektionen gestorben. Bis zum heutigen Tag dankte Clarence Gott dafür, dass er den Krieg überlebt hatte.
»Du warst damals mein rettender Engel, Liebes«, sagte er und küsste Mabel auf die Wange. Sie hatte sich in jenen entsetzlichen Tagen um ihn gekümmert, mit ihm geredet, ihm die Stirn gekühlt, seine Hand gehalten.
»Ach, du schmeichelst mir«, erwiderte sie. »Ich habe einfach meine Arbeit getan.«
»Nein, du hast mehr als das getan!« Clarence hatte sie damals gebeten, ihr schreiben zu dürfen, wenn der Krieg vorbei war und sie nach Hause zurückgekehrt war. Zunächst hatten sie Briefe getauscht und es war einige Zeit ins Land gegangen. Später hatte er ihr den Hof gemacht und ihr Herz erobert – so wie sie zuvor das seine. »Beim Himmel, ob wir einander unter anderen Umständen jemals begegnet wären?« Diese Frage beschäftigte ihn nicht zum ersten Mal.
»Gottes Wege sind unergründlich.« Mabel lächelte. »Es war Glück im Unglück, dass wir uns auf diesem Wege kennengelernt haben.«
Er streichelte ihre Hand. »Ja, das denke ich auch.«
»Möchtest du für den Rest der Nacht bei mir schlafen?«, fragte sie.
Das war eine tröstliche Aussicht. Er nickte, half ihr auf und umarmte sie.
Einige Minuten später schmiegten sie sich in ihrem Bett aneinander. Clarence seufzte leise, schloss die Augen und lauschte den ruhigen Atemzügen seiner Frau. Die düsteren Bilder aus dem Krieg, die ihn aufgewühlt hatten, verblassten allmählich. Der Krieg war lange vorbei und er war in Sicherheit. Wenige Minuten später schlief er ein.