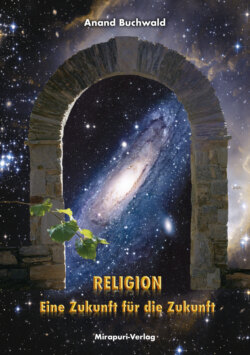Читать книгу Religion – Eine Zukunft für die Zukunft - Anand Buchwald - Страница 10
Die individuelle Evolution der Religion
ОглавлениеDie Religion und ihre Genese ist zwar am Sichtbarsten ein gesellschaftliches und in ihrer Bedeutung ein zunehmend globales Phänomen, aber sie ist in noch viel größerem Maße vor allem eine zutiefst individuelle Angelegenheit, die weit über die „Richtlinienkompetenz“ der organisierten Religion und ihrer Institutionen hinausgeht. Diese können große Veranstaltungen planen und wichtige Feste zelebrieren, sie können Reden halten und Dogmen festlegen, sie können Rituale vorgeben und Gedanken, Empfindungen, Denkweisen und Ge- und Verbote in die Gläubigen pflanzen und damit in gewissem Rahmen beeinflussen, was in den Menschen vorgeht, sie können Stimmungen, Urteile und Vorurteile erzeugen und abbauen, aber sie können dies nicht aus eigener Machtvollkommenheit tun, sondern nur das nutzen und beeinflussen, was im Menschen natürlicherweise bereits angelegt ist. Sie können den Menschen gewollt oder ungewollt auf den Weg zu Gott führen oder ihn davon abbringen, und doch sind sie nur mehr oder weniger fähige Mittler, die dem, was im Menschen schlummert, wie mehr oder weniger ungeübte und planlose Billardspieler, einen Anstoß geben.
In unterschiedlicher Tiefe ist im Menschen eine Offenheit da, eine Bereitschaft zu glauben, die wie eine Andockstation auf zellularer Ebene wirkt, wie ein Schloss, das auf den passenden Schlüssel wartet, um eine neue Dimension des Seins zu öffnen. Es ist die Fähigkeit und vor allem die Bereitschaft zu glauben. Dabei ist es erst einmal unerheblich, worum es dabei geht. Dieses Glauben-können und vielleicht sogar Glauben-wollen hat womöglich sogar eine biologische Komponente. Ganz grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Methoden, etwas zu lernen: Die eine basiert auf Erleben und Erfahren, die andere auf dem Annehmen übermittelter Erfahrungen.
Als kleines Kind ist man in seinen allerersten Lebensjahren vom Wissen der Alten abhängig, und der Versuch, nur durch Erfahrung zu lernen, wäre ausgesprochen fatal, schon allein, weil die Fähigkeit zur Wahrnehmung der Umwelt bei Neugeborenen extrem eingeschränkt ist, und später, weil man manche Erfahrungen, wie etwa giftige Maiglöckchen zu essen, nur einmal machen kann. Der größte Lernerfolg und der umfangreichste Erfahrungsschatz kommt durch die Kombination der beiden Methoden zustande, durch Erleben und die nachfolgende oder begleitende Wissensvermittlung oder durch eine Wissensvermittlung, die durch das Erleben überprüft (Feuer tut weh) oder einfach geglaubt wird (Maiglöckchen sind giftig). Ohne diese Bereitschaft zu glauben, würden wir jegliches Wissen anzweifeln und müssten alle Erfahrungen mit ihren teilweise recht negativen Folgen selbst machen, und da uns darüber hinaus der Erfahrungsreichtum unserer Vorfahren verschlossen bliebe und wir auf diesen Fremderfahrungen auch nicht aufbauen könnten, würde unsere individuelle wie gesellschaftliche Entwicklung stagnieren, es fände also keine Evolution statt, und der Mensch wäre nie entstanden. Der Mensch ist also ohne die Fähigkeit und die Offenheit zu glauben nicht wirklich vorstellbar. Sie gehört zu den Grundlagen seines Seins.
Und diese Offenheit ist ihrer Natur nach nicht diskriminierend — und kann es auch gar nicht sein —, sondern zuerst einmal für alles aufgeschlossen, was ihr begegnet. Erst in der späteren Entwicklung bekommt sie alle möglichen Arten und Größen von Scheuklappen verpasst. Dies geschieht durch negative Erfahrungen, durch die Konzentration auf bestimmte Entwicklungslinien, die bestimmte Bereiche inhaltlich oder durch Beschränkungen der Kapazität ausschließen, oder durch einseitige Wissensvermittlung und Konditionierung von Seiten der Eltern, der Freunde, der Schule oder durch gezielte Propaganda von Menschen, die ihren begrenzten Horizont für das Maß aller Dinge halten. Diese Menschen — und jeder von uns trägt etwas von ihnen in sich — sind nicht von Natur aus beschränkt, sondern haben sich einer Sache oder einem Glauben geöffnet, die sich als absolut darstellt und darum kein weiteres Wachstum, keine neuen Erfahrungen und keine Ausweitung zulässt und sich zum Teil auch auf die Hoffnung auf ein besseres Leben im Jenseits stützt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Karl Marx die Religion als „Opium für das Volk“ bezeichnet hat, denn starke, süchtig machende Rauschgifte verändern das Bewusstsein und den Blick auf die Welt, indem sie dem Menschen Scheuklappen verpassen und bestimmte Sichtweisen und Entwicklungen nicht mehr zulassen, ihn also in seiner Freiheit, in seiner Erkenntnisfähigkeit, in seiner Wahrnehmung der Welt und der Realität und in seiner Offenheit des Glaubens einschränken. Und die Religion schränkt den Menschen nicht nur in seiner Beziehung zur Welt ein, sondern auch in seiner Fähigkeit zu glauben. Sie ist also eigentlich ihr eigener und deshalb größter Feind.
Man könnte die Religion darum mit Karl Marx für überflüssig und gefährlich halten. Aber die Religion hat durchaus eine Funktion im menschlichen Sein, auch wenn diese kaum wahrgenommen und gefördert wird. Ihre Grundlage ist diese Fähigkeit zu Glauben, die Ausdruck einer grundsätzlichen Offenheit ist, und die Bereitschaft, an etwas zu glauben, das auf Anhieb nicht bewusst wahrnehmbar ist und dem wissenschaftlichen Weltbild zu widersprechen scheint, hält die kreative Neugier und die Bereitschaft, Dinge wahrzunehmen und das eigene Weltbild auszuweiten am Leben, wenn auch mit Einschränkungen, die sie zu einer Sackgasse machen können. Dies ist aber nicht unumgänglich.
Michel Montecrossa hat mit dem Bild eines sechsteiligen Bewusstseinsrades einen Ort und eine Bedeutung der Religion in der menschlichen Bewusstseinsentwicklung aufgezeigt, in der sie einen wichtigen Platz einnimmt und nicht als Sackgasse der inneren Evolution endet.
Der Ausgangspunkt dieser inneren Evolution ist genau genommen die Zeugung und Empfängnis, aber praktisch manifestiert sie sich im Einklang mit dem Wachstum der Wahrnehmungsfähigkeit des Kleinkindes. Sein Selbstempfinden ist anfangs eher global und vor allem auf der vitalen und der körperlichen Ebene egoistisch, und seine Wahrnehmung ist weniger analytisch als vielmehr künstlerisch. Ein Baby hat zwar ein Bewusstsein seiner selbst, aber noch kein denkendes und reflektierendes Bewusstsein, und dementsprechend ist seine Wahrnehmung auch ein ungefiltertes Einströmen von Eindrücken auf allen Sinneskanälen. Wahrnehmung bedeutet, dass man das, was man über die Sinne aufnimmt, mit seinem Bewusstsein und mit dem, was in diesem vorhanden ist, in Beziehung setzt. Man kann darüber nur spekulieren, was ein neugeborenes und sich entfaltendes Bewusstsein ausmacht, aber es wird gewiss keine großartige mentale Struktur enthalten. Vielmehr wird es aus Empfindungen bestehen, und wenn man davon ausgeht, dass der Mensch mit einer Seele zur Welt kommt, die in eine Weltenseele oder eine universale oder göttliche Seele oder in ein Großes Bewusstsein eingebettet ist, mit ihr in Beziehung steht und aus ihr schöpft, dann ist davon auch etwas in seinem Bewusstsein gegenwärtig. Die ersten Strukturen, die ein Kind in seinem Bewusstsein aufbaut, sind also globale Empfindungsstrukturen, die es zu seiner noch nicht völlig ausgeformten Persönlichkeit und eingebetteten Stellung in einer größeren Welt in Beziehung setzt. Das Bewusstseinsfeld, das sich somit um den Persönlichkeitskern herum ausbildet, ist darum von Eindrücken geprägt, die nichts Mentales an sich haben, sondern pure Empfindungen sind, also Licht und Dunkel, Farben in unendlichen Abstufungen und Intensitäten, Gerüche aller Art, Geschmacksempfindungen von zart bis heftig und von süß bis umami, helle und dumpfe und klare und verwaschene und leise und laute Klänge, Tastempfindungen, Kälte, Wärme, Berührungen, harte, weiche, flüssige Konsistenzen, Formen in endloser Vielfalt, Körperempfindungen wie Hunger und Durst, das Fließen des Urins, die körperliche Nähe und die Berührung anderer Menschen, die Empfindungen, die sie einem entgegenbringen, ihre Ausstrahlung, ihre Präsenz und ihr Temperament …
All dies sind Eindrücke und Empfindungen, die zueinander und zum eigenen Bewusstsein und der eigenen Persönlichkeit in Beziehung gesetzt werden, und das ist anfangs und für lange Zeit weniger eine geistige, als vielmehr eine künstlerische Arbeit, denn die Kunst beschäftigt sich, zumindest anfänglich und für eine lange Zeit nicht mit mentaler Analyse und rationalen Beziehungen, sondern mit innerer und äußerer Wahrnehmung, mit Empfindungen und Ausdruck und mit emotionalen und seelischen Verbindungen. Die synergetische Wahrnehmung, die Verarbeitung von Eindrücken, ihr gegenseitiges In-Beziehung-Setzen und die Bezugnahme zu ihnen ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Bewusstseins.
Und lange ehe die Welt mental und rational entdeckt wird, wird sie künstlerisch erforscht und entdeckt. Wenn das Kind sprechen lernt, verknüpft es Klangbilder mit optischen Bildern und einer Vielzahl weiterer Eindrücke, und erst daraus entsteht dann ein mentales Bild. Sprache und Sprechen lernen ist in diesem Alter noch ein zutiefst künstlerischer Vorgang, zu dem sich mit wachsendem Fortschritt noch mentale Elemente hinzugesellen.
Sowie das Kind mehr Kontrolle über seinen Körper erlangt, beginnt es, zusätzlich zu Mimik und Körpersprache und -kontakt physisch zu kommunizieren. Und natürlich findet diese Kommunikation künstlerisch statt, denn da das Bewusstsein bislang fast ausschließlich künstlerisch geprägt ist, ist auch der Ausdruck künstlerisch, und außerdem bedeutet Kunst ja auch die Kommunikation zwischen der inneren und der äußeren Welt; sie macht die äußere Welt verstehbar und verhilft der äußeren Welt, den anderen Menschen, zu einem Einblick in die innere Welt, sei es in ihre eigene oder in die des Künstlers.
Bislang hat das Kind Eindrücke von außen empfangen, jetzt möchte es selbst Eindrücke schaffen und sich ausdrücken, und dazu wird alles benutzt, was greifbar ist und sich in irgendeiner Form manipulieren lässt, zuerst die Stimme und dann Bauklötze, Stifte, die Gegenstände der Umgebung und die Spielsachen. Durch diesen künstlerischen Ausdruck wird das künstlerische Bewusstsein stärker ausgebildet und individualisiert. Je reichhaltiger die Möglichkeiten sind, die ihm dafür zur Verfügung stehen, desto reichhaltiger wird auch die resultierende künstlerische Persönlichkeit ausfallen. Genau genommen ist der ganze Mensch an sich ein selbst geschaffenes Kunstwerk, das sich in einem stetigen Prozess der Verfeinerung, der Konkretisierung und des Wachstums an Ausdruck und Erkenntnis befinden sollte. Dieses künstlerische Bewusstsein ist die hauptsächliche Grundlage für unsere Fähigkeit, Verknüpfungen und Beziehungen herstellen zu können; das mentale Bewusstsein ist davon nur der Nutznießer und für seine Existenz wahrscheinlich sogar darauf angewiesen.
Auch heute noch wird die Kunst, selbst wenn man sich gerne mit ihr umgibt, belächelt und als nebensächlich und unwichtig abgetan, dabei ist sie der Schlüssel für unser weiteres Leben und die Grundlage unserer Entwicklung und Entfaltung. Bei der Kunst muss man eine Unterscheidung zwischen ihrer reproduktiven und ihrer kreativen Form treffen. Die reproduktive Form ist etwas weniger wertvoll, da sie sich nicht mit der Schöpfung von Neuem befasst, aber sie vermittelt denen, die sie ausüben, die Möglichkeit, ihre technische Grundlage und ihre Fertigkeiten zu trainieren und zu verfeinern, so dass sie, wenn sie sich der schöpferischen Seite zuwenden, die Fähigkeit zu einem optimalen Ausdruck besitzen. Außerdem fördert reproduktive Kunst, vor allem in der Musik, das Eintauchen in die Seele des Kunstwerks und erlaubt dem Empfänger der Wiedergabe gleichfalls, dessen Dimensionen zu erforschen. Die kreative Kunst hingegen bietet einen weiteren bedeutenden Aspekt. Der Künstler, also der aktiv schöpferische Mensch, nimmt die Welt tiefer und reichhaltiger wahr, als der nur mentale und rationale Mensch; er kann mehr Verbindungen erkennen und herstellen, die Welt umfassender wahrnehmen und für neue Entwicklungen und Erkenntnisse offener sein.
Darum ist der künstlerische Aspekt unseres Lebens, unserer Erziehung und Bildung, und dazu zählt auch die sportliche und die kreative körperliche Betätigung, von immenser individueller, gesellschaftlicher und globaler Bedeutung und sollte in Bildungsfragen immer an erster statt an letzter Stelle stehen. Die innere Evolution des Menschen läuft nicht so ab, dass man eine Entwicklung vollzieht und sie dann mit dem Eintreten in die nächste Entwicklungsstufe abschließt, wegsperrt und ignoriert, sondern dass jede Stufe die Grundlage (und in gewisser Weise auch Bestandteil) der nächsten und aller kommenden ist, denn jede Stufe mag zwar eine größere Wahrheit in sich bergen, ist aber für sich allein nicht lebensfähig und nur ein Aspekt dieser größeren Wahrheit, so wie auch das Leben auf dem körperlichen Dasein aufbaut und ohne dieses nicht existieren könnte und keine Ausdrucksmöglichkeit hätte, oder wie der Geist für seine Existenz und seinen Ausdruck auf Leben und Körper angewiesen ist.
Darum sollte man die Kunst, in welcher Form auch immer, zeitlebens und möglichst vielfältig pflegen, andernfalls man Gefahr läuft, sich in der nächsten Entwicklungsstufe zu verlieren und sie für die einzige Realität zu halten, wie es bei zu vielen Menschen der Fall ist, weshalb wir auch in einer so zerstörten und kalten Welt leben, die von Pseudo-Rationalismus und eiskaltem Kapitalismus regiert wird.
Diese nächste Stufe besteht in der Entwicklung der Ratio, der Vernunft, des analysierenden Verstandes. Die Kunst nimmt Beziehungen wahr und empfindet und erlebt sie, und irgendwann fängt der Mensch an, diese Beziehungen und Verbindungen mit gesteigertem, aktivem Interesse zu betrachten und sie dann zu analysieren. Das ist der Einstieg in eine wissenschaftlich geprägte Seinsweise und Bewusstseinsstufe. Wenn von Wissenschaft die Rede ist, denkt man immer zuerst an Hochtechnologie, an biologische Forschung und an chemische Versuche, aber diese sind nur die hochgezüchteten und isolierten Ausdrucksformen des wissenschaftlichen Bewusstseins, das in jedem Menschen existiert. Eine der ersten Ausdrucksformen und Anwendungen dieses Bewusstseins und seiner analytischen Fähigkeiten ist das Erkennen und Erlernen der Sprache, zusammen mit der Einführung von Ordnung, durch die auch erstmals die Konzepte von Unordnung und Chaos entstehen. Analyse bedeutet, Dinge zu betrachten, sie zu vergleichen und auf mentale Weise zueinander in Verbindung zu bringen. Dabei werden sie kategorisiert, und es wird eine Systematik erzeugt, die es erlaubt, alle Dinge, die einem begegnen, einzuordnen. So wird eine Ordnung geschaffen, die mehr oder weniger optimal und vor allem künstlich ist. Jeder Mensch hat sein eigenes Ordnungssystem, mit dem er einigermaßen gut zurechtkommt und das er im Laufe seines Lebens immer wieder umarbeiten und ergänzen muss, wenn er neue Beobachtungen macht und neue Fakten in Erscheinung treten. Solange man dazu in der Lage ist, bleibt man geistig beweglich und innerlich jung und kann gut mit neuen Erkenntnissen und Entwicklungen umgehen. Wenn man aber frühzeitig und überzeugend vermittelt bekommt, dass nur eine bestimmte Sache oder Sichtweise richtig ist, leidet die Flexibilität dieses inneren Ordnungssystems, das ja nur ein eigentlich unzureichendes Hilfsmittel ist, um die Welt zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden, weil dadurch bestimmte Gedankengänge und Schlussfolgerungen oder neue Ordnungskategorien tabu, also nicht mehr „denkbar“ sind. Die schulische Erziehung beginnt langsam, sich von dieser Dogmatik zu lösen, weil wissenschaftliches Arbeiten unter der Fuchtel des Dogmas fehlerhaft und unproduktiv ist, weil die notwendige Objektivität und die Offenheit für Neues fehlen. Politik und Religion sehen diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen oder ungern, da der Mensch dadurch weniger vorhersehbar und steuerbar ist. Menschen, die dogmatisch indoktriniert sind oder die aus verschiedenen Gründen diese Flexibilität und die Anpassung der Systematik nicht trainiert haben oder dabei nachlassen, geraten dann schnell aus dem Fluss oder entwickeln sich zu engstirnigen oder bigotten Persönlichkeiten und können auch nur eine tendenzielle Auffassung der Wissenschaft haben.
Die Ordnung, die der Mensch sich schafft, ist notwendigerweise persönlich und somit subjektiv, was zu Verständnisproblemen führt, wenn zwei zu unterschiedliche Systematiken aufeinandertreffen. Das sollte uns vor Augen führen, dass diese Ordnung ihrer Natur nach künstlich ist und auf jeden Fall suboptimal. Die ideale künstlerische Wahrnehmung hat dieses Problem nicht, denn sie findet innerhalb der natürlichen Ordnung statt, die sie vielleicht nicht mental verstehen, aber doch empfinden kann. Die menschengemachte Systematik umfasst allenfalls verschiedene Ausschnitte und Teilaspekte dieser natürlichen Ordnung, die viel komplexer ist als jedes anthropogene Ordnungssystem. Der Mensch kann diese natürliche Ordnung weder vollständig erfassen noch verstehen und empfindet sie und damit auch das künstlerische Bewusstsein als unordentlich oder gar als chaotisch und unverständlich. Das Problem liegt dabei nicht nur darin, dass die gesamte natürliche Ordnung zu umfangreich für den menschlichen Geist ist, sondern vor allem in seiner Denkstruktur, die eher ein- bis zweidimensional angelegt ist und sich in multidimensionalen Bereichen nicht sicher bewegen kann. In der natürlichen Ordnung sind alle Dinge mehrdimensional und global vernetzt, während die menschliche Ordnung eher mit Schubladen arbeitet und ein Problem damit hat, eine Sache in mehrere Schubladen einzuordnen.
Wahre Wissenschaft beschäftigt sich nicht nur mit Teilaspekten und kleinen Einzelerkenntnissen, sondern versucht Verbindungen herzustellen, erst innerhalb ihrer individuellen Zweige, dann zu Randbereichen und benachbarten Disziplinen, und schließlich zu ferner gelegenen und scheinbar nicht verwandten oder gar gegensätzlichen Bereichen. Diese Arbeit ist in vollem Gange, und während immer mehr Bereiche besser zusammenwachsen und sich stärker vernetzen, sind die Atomphysik, die Quantentheorie und die Kosmologie dabei, die physikalischen Grundlagen des Universums, seiner Entstehung und unserer Genese zu erforschen und dem zusammenwachsenden Geäst einen gemeinsamen Stamm und starke Wurzeln zu geben.
Die Frage nach dem, worin sie wurzeln und worin das Geäst eingebettet ist und wächst, läutet die nächste Stufe der Bewusstseinsentwicklung ein. Mit dem Aufkommen des wissenschaftlichen und rationalen Bewusstseins beschäftigt sich der sich entwickelnde Geist zunehmend mit der Erforschung der materiellen, sichtbaren Welt, aber das ist ihm nicht genug — er möchte mehr Zusammenhänge verstehen. In der Kunst hat er sein individuelles, subjektives Sein entdeckt, in der Wissenschaft das äußere, objektive Sein der Welt, in der er lebt. Im nächsten Schritt seiner individuellen Evolution setzt er diese beiden idealerweise in Beziehung zueinander und sucht seinen Platz in der Welt, den die reine Wissenschaft ihm nicht geben kann. Damit beginnt die Phase der Philosophie, die sich mit den Dingen beschäftigt, die das Auge und der analysierende Verstand nicht wahrnehmen können.
Die Philosophie ist das Streben nach Erkenntnis, nach dem Verständnis seiner selbst und nach den größeren Zusammenhängen. Sobald wir die Mechanismen der Welt einigermaßen verstanden haben, werden wir philosophisch. Wir fragen nach Gründen, nach Abläufen, nach der Dynamik der weltlichen und sozialen Elemente in unserem Leben und diskutieren unsere Fragen und Erkenntnisse mit Freunden. Wir fischen nach Informationen, die unserer Aufmerksamkeit bisher entgangen sind oder die wir benötigen, um unser Weltbild abzurunden. Wir versuchen herauszufinden, welches unser Platz in der Welt ist, was sie bewegt und zusammenhält und was auf uns zukommen wird. Hier werden Beziehungen erforscht, Beziehungen zwischen den Dingen, zwischen Menschen und Dingen und zwischen den Menschen. Es werden Ideen entwickelt, Ideale, und aus dem Ganzen bilden sich die Anfänge einer Ethik, die für den Umgang mit der Welt und den Menschen von grundlegender Bedeutung ist. Diese Phase ist ausgesprochen wichtig, denn in ihr wird unsere Persönlichkeit zwar nicht geformt, aber doch verfeinert, vertieft und zurecht geschliffen; hier finden Prozesse statt, die mit entscheiden, wie sich unser Charakter und unser Bild der Welt entwickeln.
Ist diese Phase kurz und/oder oberflächlich, so neigt man eher dazu, sich nicht als Teil der Welt zu betrachten, sondern sieht sie als eine von sich losgelöste Spielwiese an, um die man sich nicht sorgen muss. Man bleibt dann bei seiner Entwicklung in der rationalen Phase stecken und entwickelt sich zum kalten Wissenschaftler und/oder zum Kapitalisten, also zu einem Egoisten, der die Welt nur relativ zu sich selbst wahrnehmen kann und für den die Welt dazu da ist, seine Wünsche zu erfüllen und seine Bedürfnisse zu befriedigen. Sein moralischer Kompass ist einfach gestrickt, und seine Nadel dreht sich um ihn selbst. Und auch die Beziehungswelt ist eher einseitig auf den Aspekt des Nehmens ausgerichtet. Die philosophischen Schulen, die sich aus dieser Ausprägung oder Haltung ableiten, sind das Recht des Stärkeren, das Vergeltungsprinzip des Codex Hamurabi (Auge um Auge, Zahn um Zahn), das machiavellistische Prinzip des Divide et impera (Teile und herrsche), das unbedingte Streben nach Macht und Besitz, der Absolutismus, die Ausbeutungstechnik des Großkapitals (und des Kleinkapitals), die Heuschreckenmentalität der Finanzindustrie und ein kompromissloser Hedonismus.
Wo diese Forschungsphase hingegen ausführlicher und tiefschürfender ausfällt, entwickelt sich ein Charakter mit einer komplexeren Natur. Man ist ein eigenständiger Teil der Welt und der Natur, ist aber in diese eingebettet und führt mit ihr, mit den Dingen und den Menschen eine Beziehung gegenseitigen Gebens und Nehmens; man führt ein Leben der Gemeinschaft und des Fortschritts, mit einer Ethik, die auf die Förderung der Harmonie und des gemeinschaftlichen Wohlergehens ausgerichtet ist, wofür wiederum das Wohlergehen des Individuums notwendig ist. Die Philosophien, die daraus erwachsen, sind die Gleichberechtigung, die Freiheit, die Brüderlichkeit, die Demokratie, das Miteinander, die Zusammenarbeit, die Verantwortung für die Welt und die Mitmenschen, der Humanismus, das Mitgefühl, die Karitas, die Solidarität, die Suche nach immer weiter reichender Erkenntnis der Welt, des Lebens und seiner selbst.
In dem Spektrum zwischen diesen beiden Extremen bewegen sich die Menschen dieser Welt ihm Rahmen ihrer jeweils individuellen Lebensphilosophie. Das menschliche Lebensfeld ist also eine sehr heterogene Mischung der verschiedensten Weltsichten und Lebenseinstellungen, die mal harmonieren und mal frontal aufeinander prallen, die aber allesamt miteinander interagieren und das hervorbringen, was man als Gesellschaftssystem bezeichnet, was man aber auch Gemeinschafts- oder Sozialphilosophie nennen könnte und dessen Kristallisationspunkt die Rechtsordnung mit ihren Gesetzen ist. Diese Sozialphilosophie ist das Ergebnis einer Bemühung um Verständigung, um eine minimale Richtschnur, an der jedermann sein Verhalten ausrichten und an der man auch seine Lebensphilosophie orientieren kann. Darum sind unsere ersten Gehversuche im philosophischen Gefilde nicht wirklich frei und unbelastet; wir sind dabei bereits in ein Wertesystem, in ein philosophisches Gebilde, eingebettet und werden bei unserer Forschung nach Zusammenhängen von der bereits etablierten Norm beeinflusst. Dadurch sind wir in unserer Entfaltung zwar nicht wirklich frei, aber man kann sich ja einmal überlegen, wie das Ergebnis wäre, wenn wir uns dabei in einer Kaspar-Hauser-Situation wiederfinden würden?
Es wäre nichts vorgegeben, aber da jeder Mensch in unserer Umgebung macht, was er will, wären wir frei, so zu sein, wie wir wollen. Da wir führungslos, orientierungslos und durch nichts gebremst wären, würden wir uns leichter zu extremen Haltungen in jede Richtung hin entwickeln können. Und diese Tendenz zur Beliebigkeit würde sogar noch dadurch verstärkt werden, dass wir fundamental soziale Wesen sind und darum in gewisser Weise nie wirklich völlig frei sein können, denn wir orientieren uns immer irgendwie an unseren Mitmenschen und würden uns in einer solchen Situation planlos eine beliebige Verhaltensweise, die uns ins Auge springt, zum Vorbild nehmen. Wir würden uns, mehr noch als gemeinhin üblich, am lauten Außen, statt an unserem zurückhaltenden Inneren festmachen. Wir wären freier, weil uns alle Entwicklungsmöglichkeiten offen stehen, und gleichzeitig unfreier, weil uns das nötige Urteilsvermögen und eine verlässliche Orientierungshilfe fehlen.
Die soziale Ordnung, in der wir leben, ist so gesehen aus einer sehr rudimentären Kaspar-Hauser-Situation entstanden, in der relativ wenige, noch überwiegend instinktgeprägte Urmenschen die Bezugspunkte und Vorbilder für die Folgegeneration bildeten. Mit zunehmender Zahl und Nähe der Menschen bildeten sich dann Mindestnormen heraus, an denen man sich bei der Ausbildung eines eigenen Wertesystems und einer individuellen Seinsphilosophie orientieren konnte. Durch diese „Unfreiheit“ konnte überhaupt erst eine soziale und philosophische Evolution stattfinden, die in der Folge zu unserem heutigen Sozialwesen führte, das als Orientierungshilfe nicht nur den heranwachsenden Menschen dient.
Doch diese Orientierungshilfe ist nicht wirklich neutral und wertfrei, wie es von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt aus vielleicht gewünscht wäre, um unter scheinbar idealen Bedingungen die optimale Persönlichkeitsentfaltung zu fördern, sondern enthält auch ein regelrechtes Wertesystem, eine Ethik. Diese bietet keine neutralen Möglichkeiten, sondern gibt Wertungen vor und liefert Vorstellungen, wie wir uns entwickeln sollen. Sie definiert auf der Grundlage eines gemeinschaftlichen Konsenses, was gut und was böse ist, ohne dabei dem Individuum einen eigenständigen und abweichenden und womöglich höherwertigen Wertekanon zu gestatten. Deshalb ist der Knackpunkt für das Individuum hier der Konsens. Dieser kann, ganz egal, wie weit eine Gesellschaft entwickelt ist, immer nur Mittelmaß sein, denn er ist ein Kompromiss zwischen den tiefsten Niederungen und den Gipfeln menschlicher Errungenschaften, zwischen Rückschritt und Fortschritt, zumindest solange, bis dieser Konsens auf das höchstmögliche Ideal festgelegt wird.
Angesichts dieses Mittelmaßes kommt die Frage auf, wie dabei überhaupt eine gesellschaftliche Weiterentwicklung stattfinden kann und konnte. Hier gab und gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine liegt noch im philosophischen Bereich. Wenn wir erst einmal eine Entwicklung im Rahmen der gesellschaftlichen Vorgaben und unseres Bewusstseinspotenzials gemacht haben, haben wir auch die Fähigkeit erlangt, uns von der Welt, in die wir eingebettet sind und die uns treibt und beeinflusst, zu distanzieren, innerlich zurückzutreten und sie quasi von Außen zu betrachten, vorausgesetzt, wir haben es geschafft, uns, unser inneres Selbst, unseren Wesenskern nicht im Getriebe der Welt zu verlieren und ein halbwegs originales Individuum zu bleiben. Bei dieser distanziert-analytischen und versucht-objektiven Betrachtung können wir die Werte und Vorgaben, die den gesellschaftlichen Mittelwert widerspiegeln, neu bewerten und einordnen und mit unserem Wesenskern und unserer Entwicklung bis zurück zu dem ungeformten Bewusstsein, aus dem wir erwachsen sind, abstimmen, wir können die Werte in Betracht ziehen, die über den gesellschaftlichen Median hinausragen oder sich jenseits ihres Höhepunkts befinden und uns auf diese Weise ein höheres, entwickelteres Weltbild erarbeiten und so dabei mithelfen, den Gipfelpunkt der Glockenkurve der gesellschaftlichen Bewusstseinsentwicklung weiter in die Richtung des steigenden Bewusstseins zu bewegen.
Bei diesem Prozess kann dann auch die zweite Möglichkeit eine Rolle spielen, und diese führt uns über die Ethik zur nächsten Station des Bewusstseinsrades, zur Religion. Die Entwicklung eines gesellschaftlichen Konsenses ist angesichts der großen Bandbreite und unterschiedlichen Intensität menschlicher Charaktere selbst über lange Zeiträume hinweg keine einfache Angelegenheit — zu groß ist die Vielfalt und Eigenwilligkeit und natürliche Divergenz, die unter einen Hut gebracht werden und zu eng das Korsett des gesellschaftlichen und ethischen Standards, in den das Individuum einwilligen muss. Nur rationale Argumente sind hier lediglich bei denen hilfreich und wirksam, die eine gewisse Mindestentwicklung des Geistes und des Bewusstseins durchlaufen haben. Für den Teil der Menschen, der stärker impulsgesteuert ist, ist ein anderer Faktor ausschlaggebender, der aber auch bei der eher rationalen Fraktion unterschwellig wirksam ist.
Dieser Faktor ist das, was man verallgemeinernd als das Übersinnliche bezeichnen könnte. Als Neugeborenes und vielleicht auch schon früher waren wir ein ungeformtes Bewusstsein, das möglicherweise die Empfindung hatte, in ein größeres Bewusstseinsfeld eingebettet zu sein. Mit der Geburt überlagert sich dieses Bewusstseinsfeld zunehmend mit der Wahrnehmung der „realen“ materiellen Welt, die anfänglich ebenfalls als etwas Großes, Gewaltiges und Ehrfurchtgebietendes empfunden wird. Je nach der individuellen Stärke dieser Wahrnehmungsweisen wird man zu einem lauen oder intensiven und zu einem religiösen oder materialistischen Menschen, und je nachdem wird dieses Große Bewusstsein und/oder die Materie zu unserem Gott. Natürlich ist die Materie an sich greifbarer und wird in modernerer Zeit stärker betont, so dass der materielle Gott dominiert; trotzdem sind in ihrer Wesenhaftigkeit beide Gottesbilder kaum greifbar, und nur das große Bewusstseinsfeld wird als Gottheit betrachtet und verehrt, während die materielle Gottheit zwar verehrt, aber weder bewusst erkannt noch formal anerkannt wird.
Aus dieser Empfindung von etwas Größerem hat sich die Vorstellung, das Bild des Göttlichen in all den verschiedenen Äußerlichkeiten entwickelt, und aus der Verwaltung dieses Bildes die Religion. Man könnte die Religion also so definieren, dass sie eine Instanz ist, die sich um die Verwaltung der Empfindungen kümmert, die über die Abläufe des gewöhnlichen Lebens hinausgehen, sowie um die Fragen, die beim Versuch der Erklärung und der Aufarbeitung des Lebens auftauchen. Genau genommen stellt die Philosophie die Fragen: Wer bin ich? Wie bin ich ins Dasein getreten? Gibt es einen Ursprung aller Dinge? Wie ist das Sein ins Sein getreten? Und die Religion versucht darauf Antworten zu finden, was ihr aber nicht wirklich überzeugend gelingt, weil es darauf rational wie mental keine unumstößlichen und allgemeingültigen Antworten geben kann, da hier die Domäne des sinnlich Wahrnehmbaren verlassen und die Domäne der Spekulation betreten wird.
Was die Religion tun kann, ist, diese Urwahrnehmung wieder ins Gedächtnis zu rufen und die Auseinandersetzung mit ihr und den Fragen des Seins zu fördern. Das Motto der Kunst lautet: Ich empfinde und nehme wahr. Das Motto der Wissenschaft lautet: Ich entdecke und weiß. Und die Philosophie sagt: Ich erkenne oder vermute. Die Religion hingegen bringt zum Ausdruck: Ich glaube. Und weil es nicht einfach ist, sich mit abstrakten Gefühlen und Gedankenbildern auseinanderzusetzen, hat sich die Religion personalisiert. Sie stützt sich auf einen Religionsstifter und baut dieses einfache „Ich glaube“ zu einem exklusiven „Ich glaube nur dies“ aus, ergänzt durch ein großes theologisches Gedankengebäude, in dem dieser Glaube detailliert beschrieben und vorgegeben ist. Dadurch ist der Mensch in seinem Glauben nicht mehr frei und spontan. Der Glaube ist wie ein Formular vorkonstruiert und erfordert nur noch eine formelle Zustimmung; seine Essenz ist für die Masse der Gläubigen nicht mehr relevant. Die religiöse Formelwelt enthebt sie der Notwendigkeit, dem Unbekannten, dem Geahnten, dem Glauben nachzuspüren, sich selbst in Bewegung zu setzen, sich um ein wirkliches religiöses Leben zu bemühen und das Eigentliche der Religion zu einem lebendigen Teil seines Lebens zu machen. Wie in der Politik auch, gibt der Mensch das Heft des Handelns aus der Hand und lässt sich verwalten und passiv leben.
Der Gegenstand der Religion ist eine zentrale Urgewalt, eine ursprüngliche Entität, der Quell allen Seins, ein großes, allumfassendes Bewusstsein und, in menschlich fassbare Begriffe übersetzt, eine vermenschlichte, allmächtige Wesenheit, eine Gottheit oder eine Gruppe von Göttern. Im Umgang mit diesem Urgrund des Seins haben sich langsam Gewohnheiten eingeschlichen, Sicht- und Denkweisen fixiert und Rituale etabliert. Die religiöse Praxis wurde dann verallgemeinert, in Form gebracht, de-individualisiert und institutionalisiert. Es entwickelte sich ein vereinheitlichtes Lehrgebäude, das meist an historischen oder imaginären Personen festgemacht ist. Um diese Ansammlung von Geschichte, Ritualen, Auffassungen, Vorgaben und Dogmen formte sich eine Verwaltung, quasi ein Herrscherhaus mit seinem Hofstaat und dessen Abteilungen, das für sich die Gestaltungs- und Interpretationsfreiheit in Anspruch nimmt und diese Macht durch eine hierarchische Abfolge von Vermittlern, Bewahrern, Manipulateuren, Polizisten und Animateuren ausübt und festigt. So entstehen aus einem anfänglichen, rudimentären Wahrnehmen und der interessierten Bemühung der Philosophie die hierarchischen Ebenen und Gesichter der Religion.
Für mich stellen Liebe und Mitgefühl eine allgemeine, eine universelle Religion dar. Man braucht dafür keine Tempel und keine Kirche, ja nicht einmal unbedingt einen Glauben; wenn man einfach nur versucht, ein menschliches Wesen zu sein, mit einem warmen Herzen und einem Lächeln, das genügt.
Dalai Lama