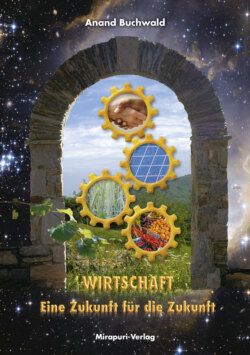Читать книгу Wirtschaft – Eine Zukunft für die Zukunft - Anand Buchwald - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die drei Schwächen der Wirtschaft
ОглавлениеUm die Wirtschaft sinnvoll zu reformieren, ist es notwendig, ihre gegenwärtigen Schwächen zu analysieren. Unsere Wirtschaft ist ein historisch gewachsenes System, bei dem sich eine Stufe aus der anderen ergeben hat und in dem die Finanzindustrie zunehmend Einfluss gewonnen hat. Die Wirtschaftswissenschaft baut auf dieser Historie auf; sie analysiert sie, erklärt sie, beobachtet die Entwicklung und leitet daraus Theorien ab. Das ist ein sich selbst rechtfertigendes System, das im Wesentlichen nur die Suppe im Teller umrührt und betrachtet, aber nicht über den Tellerrand hinaus schaut, oder gar auf die Idee kommt, eine neue, bessere Suppe zu kochen. Man könnte, um das gegenwärtige Wirtschaftssystem zu beschreiben, auch das Bild einer Hose nehmen, die dutzende Male geflickt wurde, deren Taschen löchrig sind, deren Gewebe fadenscheinig geworden ist, deren Nähte brüchig geworden und aufgeplatzt und deren Säume abgewetzt sind. Diese Hose ist historisch gewachsen, aber nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Sie setzt sich zusammen aus Traditionen, Bräuchen, Annahmen, inzestuösen Theorien, unantastbaren Dogmen und egoistischen und engstirnigen Einflusssphären. Dieses Bild der Hose steht für die Schwächen des gegenwärtigen Wirtschaftssystems und der sogenannten Wirtschaftswissenschaft.
Die erste dieser Schwächen ist das bereits bekannte System der unkontrollierten Geldschöpfung durch private Banken, das diesen auf dem Finanzsektor gottgleiche Macht verleiht. So wie Gott laut Bibel durch ein einfaches „Fiat“ (Es werde) alles erschuf, können die Banken mit ein paar Tastatureingaben nahezu unbegrenzt Geld schaffen, sogenanntes Fiatgeld, und dieses Geld gegen echtes Geld oder auch gegen Fiatgeld verleihen. Diese Fähigkeit bringt mannigfache Folgen mit sich.
Eine Folge ist die, dass die Banken unermesslich reich werden. Sie haben praktisch unbegrenzt Geld zur Verfügung, das sie sich nicht wirklich erarbeiten müssen und das deshalb auch einen entsprechenden Stellenwert besitzt. Darum kann man damit auch spielen; man kann damit wetten und spekulieren, Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise in die Höhe treiben und Staaten und Volkswirtschaften ruinieren. Und man kann damit reale Firmen aufkaufen und mit diesen weiterspielen. Kurz, diese Fähigkeit verleiht Macht und Einfluss, auch politische Macht, die dazu genutzt wird, die Regeln der Wirtschaft noch mehr zugunsten der Banken zu verändern, so dass man ungestörter weiterspielen kann.
Eine andere Folge ist die, dass die Banken immer – weitgehend unabhängig von der Wirtschaftslage – Geld zu verleihen haben, und dass die Staaten diese Möglichkeiten ziemlich hemmungslos nutzen, was dazu führt, dass deren Schulden stetig anwachsen, und zwar nicht nur durch die Kredite von nicht wirklich existierendem Fiatgeld, sondern zudem auch noch durch die überdimensionierten Zinsen und Zinseszinsen auf Geld, das eigentlich keinen Gegenwert hat. Dieser Gegenwert entsteht erst, wenn der Staat diese Kredite mit realen Steuereinnahmen bezahlt. Man kann diese Sachlage auch noch anders formulieren: Der Staat hat den Banken die Macht gegeben, Geld herzustellen und verschuldet sich immer mehr, weil er sich bei den Vertretern dieser delegierten Macht immer mehr Geld zu überhöhten Kosten leiht, das er dann mit dem Geld, das die Staatsbürger verdienen und an ihn abgeben, teilweise zurückzahlt, wobei eine vollständige Rückzahlung eigentlich kaum möglich und auch nicht vorgesehen ist, da der Staat damit von den Banken abhängig bleibt.
Das Geld, das die Banken verdienen, ist nicht wirklich verdient, nicht wirklich erarbeitet, und es verdankt seine Existenz vor allem den Krediten, die von den Banken vergeben werden. Diese Kredite von noch nicht existierendem Geld müssen von den Kreditnehmern abgezahlt werden, was zum Teil mit Hilfe von weiterem Fiatgeld geschieht, aber meist mit real erarbeitetem Geld. Das bedeutet, dass der Ertrag realer Arbeitskraft und Wirtschaftsleistung verwendet wird, um Fiatgeld zu Realgeld werden zu lassen. Das bedeutet aber auch, dass dieses Geld dem normalen Wirtschaftskreislauf entzogen wird, und in die Schatzkammern der Finanzwelt wandert.
Verschärft wird diese Problematik durch die Praxis des Zinseszins. Das bedeutet, dass man für eine bestimmte Summe Geld jedes Jahr eine gewisse Menge Zinsen bekommt. Diese Zinsen werden zu der ursprünglichen Geldmenge addiert und im nächsten Jahr ihrerseits ebenfalls verzinst. Das führt zu einem exponentiellen Wachstum der Geldsumme, so dass sie sich, abhängig von der Zinshöhe, im Laufe der Jahre vervielfachen kann. Bei der Kreditvergabe wird nun davon ausgegangen, dass das verliehene Geld im Kreditzeitraum wachsen würde, und dieses potenzielle Wachstum muss vom Kreditnehmer mitfinanziert werden, weshalb die letztlich zurückgezahlte Summe, abhängig von Zinssätzen, Raten und Laufzeit durchaus doppelt so hoch oder noch viel höher ausfallen kann. Das bedeutet, die Bank verleiht Fiatgeld, Luftgeld oder Nullgeld oder wie immer man es nennen mag, und der Kreditnehmer muss dafür einen wesentlich höheren Betrag als Realgeld erwirtschaften und zahlen.
Und in diesem Zusammenhang gibt es noch ein Phänomen, das die andere Seite betrifft, die Seite der Sparer und Besitzenden, die ja für das Geld, das sie auf der Bank liegen haben, Zinsen ausgezahlt bekommen. Diese sind zwar deutlich geringer als die Kreditzinsen, können aber immer noch zu einem deutlichen Anwachsen des Guthabens führen, vor allem wenn es viel Geld ist, das langfristig bei hohen Zinssätzen, die deutlich über der Inflationsrate liegen, angelegt werden kann. Wenn die eingezahlte Geldsumme groß genug ist, dann erreicht das Zinseszinsergebnis eines Tages einen Wert, der so hoch ist, dass man von den Zinsen leben kann, während das Guthaben stabil bleibt oder gar weiter wächst. Das bedeutet, dass man ab diesem Zeitpunkt aufhören kann zu arbeiten und man trotzdem immer reicher wird.
Haben die erzielten Zinsen die Höhe der Inflationsrate, etwa bei kleineren und kurzfristigeren Spareinlagen, so wächst zwar die Geldsumme, aber nicht der Geldwert; man gewinnt zwar durch die Geldanlage nichts, verliert aber auch nichts. Sinkt der Zins unter die Inflationsrate, was oft bei kleinen und kurzfristigen Geldanlagen und Sparguthaben der Fall ist, dann verliert das Geld, trotz leichter Zinsgewinne stetig an Wert und man wird ärmer.
Die Praxis des Zinses überhaupt und der Folgeerscheinung des Zinseszins führt also dazu, dass es eine große und stetig wachsende Geldmenge gibt, die primär nicht durch unmittelbare Arbeit entsteht, sondern sozusagen virtuell, so dass sie im Prinzip keiner realwirtschaftlichen Beschränkung mehr unterliegt und beliebig anwachsen kann. In der Bemühung, dieses virtuelle Fiatgeld anwachsen und materieller werden zu lassen, wandert das Geld von der real arbeitenden Bevölkerung zu den Institutionen, die Geld erschaffen dürfen, also in der Regel zu den Banken, und ein Teil davon wandert weiter zu den Menschen und Firmen, die bereits mehr Geld haben, als sie zum Leben benötigen.
Durch die Praxis des geldschöpfungsbedingten Fiatgeldes und vor allem des Zinseszins fließt das Geld aus der Realwirtschaft in die Finanzwirtschaft. Einiges von dem Geld, das die Mehrheit der Menschen erwirtschaftet, sammelt sich also ohne besonderen Aufwand in den Koffern einer kleinen Minderheit, was einer der Gründe für die zunehmend weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich ist. Die unterschiedlichen Zinssätze für große Vermögen und kleine Guthaben, die zu kräftigen Zugewinnen für die Reichen und zu realen Verlusten für die Ärmeren führen, sind ein weiterer Grund.
Dass Zinssätze unter der Inflationsrate zu diesen Verlusten führen, wurde ja schon erwähnt. Dass es zu dieser Inflation kommt, ist eine Folge der freien Geldschöpfung, die ja bewirkt, dass stetig neues Geld geschaffen wird, für das es keinen realen Gegenwert gibt und das noch nicht erarbeitet wurde, und eine Folge des Zinseszins, der diese Summe weiter aufbläht. Das ist etwa dann der Fall, wenn jemand über Kredit für 1 Million EUR ein Haus kauft, und dafür dann z.B. 2 Millionen EUR zurückzahlt. Beim Kauf erhöht sich die globale Geldmenge plötzlich um 1 Million EUR, die es vorher nicht gab und die der Verkäufer erhält, während der Käufer im Gegenzug ein Haus bekommt, das weiterhin 1 Million EUR wert ist, für das er aber während der Kreditlaufzeit ca. 2 Millionen EUR zahlt. Das Resultat ist dann, dass der Käufer über ein Haus verfügt, das 1 Mio. wert ist, der Verkäufer hat 1 Mio. und die Bank hat 2 Mio., die es vorher nicht gab, oder zumindest 1 Mio. an Zinserträgen. Es gibt also nach Beendigung des Kreditgeschäftes viel mehr Geld als vorher.
Das führt dazu, dass es insgesamt mehr Geld als Waren und Wirtschaftsleistung gibt. Da man somit nicht alles Geld ausgeben kann, sinkt sein durchschnittlicher Wert, und Waren und Arbeitsleistung müssen teurer werden, um diesen Überschuss an Geld auszugleichen. Dadurch ist die Praxis der Geldschöpfung direkt am weiteren Auseinanderklaffen der Armutsschere beteiligt. Hinzu kommt, dass der Geldwertverlust die Menschen umso härter trifft, je weniger Geld sie haben, zum einen weil sie über keine Polster verfügen, mit denen sie diesen Verlust auffangen könnten, zum anderen, weil die Anpassung an die Inflation, also höhere Löhne, „zum Wohle der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ nur sehr langsam und meist nicht in ausreichendem Maße geschieht, so dass großen Teilen der arbeitenden Bevölkerung effektiv immer weniger Geld zur Verfügung steht. Die Reichen werden also immer reicher und die Nicht-Reichen und Armen immer ärmer und die Geschwindigkeit dieses Prozesses hat sich im Laufe unserer Geschichte immer stärker beschleunigt, und ist gerade dabei in den Galopp überzugehen.
Die zweite Schwäche unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems liegt im Dogma des permanenten Wirtschaftswachstums begründet und arbeitet Hand in Hand mit der dritten Schwäche, dem Kapitalismus. Eine Wirtschaft wird dann als gesund betrachtet, wenn sie wächst. Und auf diesem Grundsatz basiert auch die Ausgestaltung des Wirtschaftslebens. Hier muss alles stetig wachsen. Wenn jemand eine Firma gründet, und diese stetig wächst, gilt sie als erfolgreich und gesund; wenn sie in Größe und Gewinn stagniert, gilt das als eine bedenkliche Entwicklung. Wachstum wird dadurch erzeugt, dass man neue Kunden gewinnt oder diese dazu bringt, vermehrt die angebotenen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Das führt aber dazu, dass eventuell anderen Firmen mit ähnlichem Geschäftsfeld die Kunden wegbleiben oder ihre Umsätze zurückgehen. Sie machen dann entweder Pleite oder werden von den erfolgreicheren Firmen aufgekauft, die dadurch weiter wachsen. Die Folge davon ist ein Rückgang der Firmenvielfalt und eine Konzentration des Geschäftes auf immer weniger und größere Firmen, also eine Monopolisierung, die kurz vor Erreichen des Monopols durch kartellrechtliche Bestimmungen ein wenig ausgebremst wird, so dass eine Oligopol-Struktur entsteht. Durch faktische Absprachen oder unausgesprochene Agreements findet in diesem Entwicklungsstadium kaum noch ein Preiskampf um die Gunst des Verbrauchers statt, sondern eine gemeinsame Bemühung, die Preise zum Zwecke der Gewinnmaximierung möglichst unauffällig nach oben zu treiben und die durch Synergie gewonnenen Vorteile nicht an den Kunden weiterzugeben, was einer faktischen Monopolisierung entspricht. Damit sind dann aber auch schon die Grenzen des Wachstums erreicht.
Um dann weiter wachsen zu können, muss man sich neue Märkte erschließen. Dies geschieht im Wesentlichen auf drei verschiedene Weisen. Eine davon besteht darin, in den Bereich der Finanzjongleure einzusteigen und mit Aktien, Optionen und Spekulationen den Gewinn weiter zu vergrößern. Bei einer anderen Möglichkeit, tut man sich neue Geschäftsfelder auf, man bietet also mehr Produkte an und kauft noch mehr Firmen auf. Und drittens expandiert man in andere, vielleicht noch unterversorgte Länder, wodurch die Monopolisierung zunehmend globaler wird.
Hier stoßen wir dann aber bald an andere Grenzen des Wachstums. So gibt es etwa in der dritten und vierten Welt noch unglaublich viele Menschen, die weder Autos noch Fernsehgeräte noch viele andere Sachen besitzen. Das ist noch ein immens großer, potenzieller Markt. Aber zum einen haben diese Menschen nicht das Geld für diese Luxusprodukte, nicht zuletzt, weil sie wegen des Expansionsdrangs der großen Firmen und aus Gründen der Gewinnmaximierung schlecht bezahlt und behandelt, also ausgebeutet werden, zum anderen gibt es schlichtweg nicht genügend Rohstoffe, damit alle Menschen auch nur auf dem derzeitigen Niveau der ersten Welt leben könnten.
Warum das so ist, und warum eine Politik stetigen Wachstums auf der physischen Ebene auf Dauer nicht funktionieren kann, sollte man eigentlich schon in der Schule gelernt haben. Es gibt im Wesentlichen zwei Wachstumsarten: lineares und exponentielles Wachstum. Lineares Wachstum ist dann gegeben, wenn in gleichmäßigen Zeitabschnitten ein Zuwachs erzielt wird, der in jedem Zeitabschnitt von seinem absoluten Betrag her gleich groß ist. Exponentielles Wachstum hingegen bedeutet, dass der Zuwachs sich nicht auf eine feste Größe bezieht, sondern relativ, also prozentual, auf die zuletzt erzielte Größe. Das bedeutet, dass der Zuwachs in jedem neuen Zeitabschnitt größer ausfällt, als im vorhergehenden und immer schneller zunimmt.
Allerdings funktioniert Wachstum nur für eine gewisse Zeit, denn die Möglichkeiten und Ressourcen sind endlich und darum irgendwann erschöpft. Und dieses Irgendwann tritt bei exponentiellem Wachstum wesentlich schneller ein als bei Stagnation oder linearem Wachstum. Um exponentielles Wachstum und seine Gefahren zu illustrieren, gibt es zwei schöne Beispiele.
Ein indischer Raja, der sehr von seinen Fähigkeiten im Schachspiel überzeugt war, gestattete seinem Spielpartner einen Wunsch, wenn dieser gewinnen würde. Der Raja verlor und musste dann feststellen, dass er sich auch in den Auswirkungen des Wunsches, den er leichtfertig gewährte, verschätzt hatte. Der Wunsch des Mitspielers bestand nämlich darin, Reis zu bekommen: für das erste Feld des Schachbrettes 1 Korn, für das zweite Feld doppelt so viele, also 2 Körner, für das dritte vier Körner, für das vierte acht Körner... Als die Mathematiker des Rajas die Reismenge berechnet hatten, musste der Raja feststellen, dass es soviel Reis weder in seinem Land, noch in den umliegenden Ländern zusammen gab. Dieses Beispiel zeigt eindringlich, was exponentielles Wachstum mengenmäßig bedeutet.
Das zweite Beispiel fügt dem noch den Faktor Zeit hinzu. Man nehme dazu ein Reagenzglas, fülle es mit Nährflüssigkeit und gebe ein rotes Bakterium hinein, das dann auf den Boden sinkt. Dieses Bakterium braucht eine Stunde, um sich zu teilen, so dass man nach einer Stunde zwei Bakterien im Reagenzglas hat. Nach einer weiteren Stunde schwimmen vier Bakterien im Glas, dann acht usw. Nun sind Bakterien ziemlich klein, und es dauert ziemlich lange, bis das untere Viertel des Reagenzglases gefüllt ist, und man denkt sich, dass das noch dauern kann, bis die restlichen drei Viertel auch rot sind. Aber das kommt daher, dass wir gewohnt sind, linear zu denken, aber nicht exponentiell. In diesem Beispiel ist das Glas nach einer weiteren Stunde halbvoll mit den roten Bakterien und nach noch einer Stunde ganz voll. Danach haben die Bakterien nichts mehr zu fressen und würden für die nächste Stunde ein ganzes weiteres Reagenzglas voll Nährlösung benötigen, damit sie eine einzige Stunde weiterleben und sich vermehren können.
Im deutschen Stabilitätsgesetz ist festgelegt, dass die Wirtschaft dann stabil ist, wenn sie jedes Jahr um einen gewissen, stabilen Prozentsatz wächst, wenn sie also exponentiell wächst. Die Wirtschaft benötigt zu ihrem Wachstum Ressourcen, und es stehen nur die Ressourcen zur Verfügung, welche die Erde bietet – und diese sind begrenzt. Wenn das Reagenzglas im Beispiel sinnbildlich für die Erde und ihre Möglichkeiten steht, dann sind viele ihrer Ressourcen schon zur Hälfte ausgebeutet oder stehen angesichts des gegenwärtigen Wachstums kurz davor. Wir sind also bildlich gesprochen etwa in der letzten Stunde angekommen und müssen uns jetzt überlegen, wie es mit der Wirtschaft weitergehen soll, denn wenn wir einfach so weiterzumachen, sind die restlichen Ressourcen in kürzester Zeit aufgebraucht, und das führt schlichtweg in eine Katastrophe, in Verelendung und in einen ganz realen Krieg um die verbleibenden Ressourcen – und dieser Krieg hat bereits begonnen.
Darum muss man sich die Frage stellen, ob permanentes Wirtschaftswachstum wirklich ein fundiertes und unverzichtbares wirtschaftswissenschaftliches Grundgesetz ist? Das ist wohl kaum der Fall; es ist ein kurzsichtiges Dogma, das eine Zeitlang vielleicht sogar eine sinnvolle Rolle gespielt hat, aber es ist, wie wir gesehen haben, aus geradezu primitiven Überlegungen heraus nicht zukunftsträchtig. Eine zukunftsfähige Wirtschaftsform orientiert sich an den verfügbaren Ressourcen, welche die Gesamtheit unseres Planeten und des Lebens darauf ausmachen und schließt die vorhersehbare Zukunft mit ein. Unsere gegenwärtige Wirtschaftsform orientiert sich aber fast ausschließlich am Prinzip der lokal und temporal begrenzten Gewinnmaximierung und -potenzierung und nur soweit an wirtschaftlicher Stabilität, dass diese Gewinnmaximierung und die dafür nötigen Wachstumsprozesse nicht gefährdet werden.
Das Mittel, dieses Wirtschaftswachstum zu gewährleisten, die Gewinne zu maximieren und den Besitz in möglichst wenigen Händen zu konzentrieren ist die dritte Schwäche der Wirtschaft, der Kapitalismus. Dieser ist wahrscheinlich die Ursache für die Einführung des Dogmas des zunehmenden Wirtschaftswachstums und lässt sich selbst von diesem Dogma noch mehr anfeuern. Zusammen bilden diese beiden eine Endlosschleife, die nichts außerhalb von sich wahrnimmt und sich wie ein Schwarzes Loch zu einem alles verschlingenden Moloch ausweitet – bis alles zusammenbricht, weil es keine Ressourcen mehr zum Wachsen gibt und sich aller Besitz in den Händen der Vertreter des Schwarzen Loches befindet.
Kapitalismus bedeutet das Streben nach Gewinn, das Ansammeln von Besitz und auch die Ausübung von Macht, die durch den Besitz möglich ist. Er ist eine Philosophie und Lebensweise, in der Geld und Besitz zentrale Faktoren und eigenständige Werte sind, weshalb sich dann auch große oder fast alle Bereiche des Lebens und Seins um deren Schaffung und Akkumulation drehen.
Der Kapitalismus ist wie eine Religion mit eigenem Wertekanon und Ge- und Verboten. Diese könnten etwa so lauten: „Der Mammon sei dein Gott. Du sollst ihm dienen und ihn lieben aus ganzem Herzen. Er sei die Richtschnur deines Fühlens, Denkens und Handelns und die Grundlage deiner Ethik, deiner Gesetze und deiner Gesellschaft. Dein Streben soll es sein, Geld und Besitz anzuhäufen und ihm darzubringen, auf dass er huldvoll auf dich hinabsehen möge. Dafür ist jedes Mittel (Raub, Lüge, Erpressung, Mord, Verführung...) erlaubt und erwünscht, denn es gibt keinen höheren Wert und kein größeres Ziel.“ Entsprechend dieser Religion und dieses Kanons leben die meisten reichen Menschen und Firmen, und selbst viele der Ärmsten huldigen diesem Gott.
Für die Wirtschaft (als Mittel der Güterverwaltung und -verteilung) und das Leben der Menschen bedeutet das, dass nicht die Bedürfnisse der Menschen, der Gesellschaft und der ganzen Welt im Vordergrund stehen, sondern einzig und allein die Gewinnmaximierung; es geht nicht um Gemeinschaft und Zusammenstehen und -wachsen, sondern um eiskalten und extremen Egoismus. Dafür ist jedes Mittel recht: Diese sind im Wesentlichen Ausbeutung, Täuschung und Manipulation.
Ausbeutung bedeutet zum einen die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Hier geht es nicht darum, die vorhandenen Rohstoffe, wie etwa Erdöl, Antimon, Indium, Seltene Erden und andere optimal zu nutzen, damit sie uns möglichst lange zur Verfügung stehen, sondern einen möglichst großen Gewinn zu erzielen. Und auch regenerierbare oder stetige Ressourcen werden zugrunde gerichtet, weil etwa der Einsatz von Kunstdüngern und Maschinen günstiger ist als der Einsatz von Menschen, was nicht nur zur Folge hat, dass immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten, um immer mehr zu produzieren und dass die Preise für landwirtschaftliche Produkte im Vergleich zu früheren Zeiten stark gefallen sind, sondern dass der Boden immer stärker erodiert, seinen Humusgehalt und seine Wasserhaltefähigkeit verringert (was übrigens ein wesentlicher Faktor in der schlechten globalen CO2-Bilanz ist) und damit zunehmend unfruchtbarer wird.
Ausbeutung bedeutet zum anderen aber auch, dass die Produktion von vielen Gütern dahin verlagert wird, wo man am wenigsten dafür zahlen muss und wo man die Löhne am besten drücken kann, sei es, weil die wirtschaftliche Lage des jeweiligen Landes so schlecht ist, weil die Gesetzeslage dort ein solches Vorgehen zulässt oder weil die Behörden großzügig wegsehen. Häufig werden dabei Notlagen derart schamlos ausgenutzt, dass man schon von moderner Sklaverei spricht.
Und Ausbeutung bedeutet auch, auf der einen Seite die Rohstoffpreise zu drücken und auf der anderen Seite überhöhte Preise für Güter und Dienstleistungen zu verlangen und/oder schlechte Güter zu liefern, deren Lebenszeit womöglich noch durch absichtliche Sollbruchstellen niedrig gehalten wird, womit wir gleichzeitig auch schon beim Punkt der Täuschung und der Manipulation als Arbeitsmodus des Kapitalismus angekommen wären.
Der Kapitalismus ist angetreten mit dem Anspruch, die Aufgabe der Wirtschaft, also die gerechte Güterverteilung, zu optimieren, und zwar über Angebot und Nachfrage und über den Wettbewerb. In der Theorie sieht das ja ganz nett aus: Jemand bietet eine Sache an, und wenn Bedarf an ihr besteht, verkauft sie sich gut, und die Produktion kann erhöht werden, um die Ansprüche des Marktes zu befriedigen. Wenn man aber nicht schnell genug produzieren kann, steht das vorhandene Angebot einer erhöhten Nachfrage gegenüber, und man kann dann mehr für das Produkt verlangen, was die Nachfrage wieder sinken lässt. Auf der anderen Seite bedeutet eine erhöhte Produktion auch, dass man eventuell günstiger produzieren und man Arbeitsvorgänge standardisieren kann. So kann man Produkte billiger und gleichzeitig in größerem Umfang anbieten. Damit steigt aber auch die Nachfrage, weil sich jetzt mehr Menschen dieses Produkt leisten können. Und der Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern sollte dafür sorgen, dass die Preise auch tatsächlich sinken und sich an der Realität orientieren. Diesen Mechanismus konnte man sehr gut bei der Einführung von Fernsehgeräten und Computern beobachten. Man nennt das die Selbstregulierung des Marktes. Diese soll dazu führen, dass Dinge, die benötigt werden, auch produziert werden und ohne staatliche Steuerung und Bürokratie ihren Weg zu den Verbrauchern finden, sodass letztlich jedem Menschen die Dinge, die er benötigt, in ausreichendem Maße und zu realen Preisen zur Verfügung stehen und Anbieter und Abnehmer glücklich sind.
Soweit die Theorie. Die Praxis freilich sieht nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung so aus, denn das System hat etliche eingebaute Mängel, deren wichtigste die Gier, das Prinzip des Gegeneinanders und das Fehlen einer ethischen Grundlage und eines globalen Gemeinwohl-Konzeptes sind. Das führt dann dazu, dass die wichtigste Bestrebung des Kapitalismus nicht darin besteht, allen Menschen ein würdiges und zumindest befriedigendes materielles Leben zu ermöglichen, wie es das Ideal des Kapitalismus euphemistisch vorgibt, sondern Gewinn zu machen und ohne jegliche Begrenzung Geld und Besitz und damit auch Macht anzusammeln. Es ist also keine Wirtschaftsform für die Menschen, sondern gegen sie. Das ist das zentrale Thema des Kapitalismus – alles andere ist Augenwischerei.
Als Folge davon hat sich statt einer Nachhaltigkeitswirtschaft eine Konsummentalität etabliert. Statt also die vorhandenen Rohstoffe sinnvoll einzusetzen und ihren Verbrauch zu minimieren, wird die Rohstoffgewinnung forciert, und dafür werden statt realen Löhnen dann Hungerlöhne gezahlt. Zudem orientieren sich die Produktionstechniken an einem sehr engen und unmittelbaren Wirtschaftlichkeitsgedanken und nicht an der Nachhaltigkeit und der Gesundheit von Mensch und Natur. Deshalb gibt es mehr Umweltkatastrophen als dem Durchschnittsmenschen bewusst sind (Quecksilberkontamination bei der Goldgewinnung, Erdölteppiche, Grundwasservergiftung beim Fracking, Bodenerosion durch rücksichtslose Landwirtschaft, Bienensterben, Rückgang der Artenvielfalt…). Zusätzlich werden die Arbeiter schlecht bezahlt, teilweise wie Sklaven gehalten, durch Chemieeinsatz jedweder Art vergiftet – und auch Kinderarbeit ist kein Tabu. Darüber hinaus sind viele Produkte von Anfang an so konzipiert, dass sie keine lange Lebensdauer haben, zumindest keine, die deutlich über die Garantiezeit hinausgeht, sei es durch minderwertige Materialien, Verarbeitung, Ausstattung oder durch gezielt eingebaute Sollbruchstellen. Und um all dies durchführen zu können, wird bestochen, gelogen und getäuscht. Das ist die Produktionsseite.
Und die Konsumseite sieht auch nicht besser aus. Auch hier wird nach Kräften manipuliert, gelogen und getäuscht. Es werden künstlich Wünsche und Verlangen geweckt, die vorher nicht in dieser Form und Intensität existierten, und es wird mit Emotionen wie Angst, Neid, Gier, Geiz, Ruhmsucht und Ähnlichem gespielt und Konkurrenzdenken und Gegeneinander geweckt, um den Konsum anzuheizen. Zudem lassen sich die Konsumenten brav manipulieren, denn Bewusstseinsentfaltung und selbstständiges Denken werden weder von der Wirtschaft, noch von der Politik und auch nicht von einer normativen Gesellschaft gewünscht und gefördert; eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Ohne diese Manipulationen und mit einer entsprechenden Bewusstseinsentfaltung und einer Haltung, die das Miteinander fördert, könnten wir global wie individuell ein Leben führen, das unsere Lebensgrundlagen schützt und bei dem wir alles hätten, was wir benötigen – aber wir müssten einen anderen Lebensstil entwickeln, denn so weiterzuleben wie bisher, wird nicht mehr lange funktionieren. Noch haben wir die Möglichkeiten, dies freiwillig zu machen; wenn wir aber zu lange warten, dann wird uns dieser Wandel schmerzvoll aufgezwungen.
Die großen Fragen lauten also: Wie gehen wir mit dieser Situation um? Was machen wir? Wie sieht der Ausweg aus?
Der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden.
John Maynard Keynes