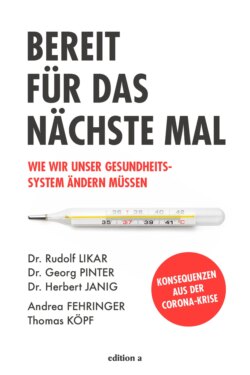Читать книгу Bereit für das nächste Mal - Andrea Fehringer - Страница 6
TAG X: IM ZEICHEN DER ANGST
ОглавлениеWir atmen Zeitgeschichte. Alles, was passiert, alles, was jetzt geschieht, wird später in den Geschichtsbüchern stehen. Wir werden lesen, dass der Tod leise kam. Niemand hatte geahnt, was da auf uns zukommt. Ein Erreger mit der sperrigen Bezeichnung SARS-CoV-2, der noch nie zuvor beim Menschen nachgewiesen wurde. Es dauerte ein paar Wochen, bis Männer in Schutzanzügen die Särge wegkarrten und alle wussten: Dieser Tod trägt keine schwarze Kutte, er hält auch keine Sichel in der Hand. Dieser Tod ist unsichtbar. Eine gedankenlose Geste – die Hand fährt unbedacht zum Mund, der Finger flink zum Auge –, schon ist man infiziert. Das Virus war plötzlich da, auf dem Fischmarkt von Wuhan. Von Fledermäusen herbeigeflattert, hat es sich ausgebreitet und wütet rund um den Erdball.
Bei manchen Menschen zeigen sich leichte oder gar keine Symptome, bei anderen greift es die Lunge an. Die Zeitgeschichte, diese toxische Luft, die wir atmen, bringt Furcht, Isolation, Zukunftsangst, Leid. Aber auch Zuversicht und Zusammenhalt in einer Ära, die keiner für möglich gehalten hätte. Leere Straßen wie Trugbilder, Menschen mit Masken, die Essen und Wasser holen, singende Leute auf Balkonen, Szenen wie aus einem apokalyptischen Film von Roland Emmerich. 2020, das Jahr eins von Corona. Tag X. Outbreak. Politische Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen. Die Dystopie der Gegenwart. Shutdown. Abstand halten. Hände waschen. Quarantäne. Daheimbleiben, unbedingt. Die Arbeitslosigkeit steigt explosionsartig. Spitäler im Ausnahmezustand. Neue Helden. Kassiererinnen im Supermarkt, Pfleger, Polizisten, Busfahrer, Müllmänner, Zivildiener. Junge Leute, die Waren in die Regale schlichten. Ärzte am Rand des Machbaren, bereit für das, was jede Sekunde neu hereinkommen kann. Nächster Einsatz in der Intensivstation, Nachtschichten. Dann Abflachen der Kurve. Lockerung der Vorschriften. Familie treffen. Freunde sehen. Aufatmen. Öffnen der Geschäfte. Öffnen der Lokale. Öffnen der Schulen. Neustart der Wirtschaft. Auferstehung.
Notfälle sind unser Tagesgeschäft. Leben retten. Wir wissen, wo das Gesundheitssystem greift, woran es krankt und was konkret fehlt. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, braucht es einen guten Plan. Ein medizin-strategisches Dossier. Genau das legen wir mit diesem Buch vor. Das Chaos im Jetzt braucht Ruhe und Weitblick. Besonnenheit.
Als Ärzte können wir sagen: Corona schreckt uns nicht. Auch keine Grippe, kein Infarkt, keine Embolie, kein Krebs, kein Herzstillstand. Das sind keine Wörter, die im Krankenhaus Schnappatmung auslösen dürfen, es sind Diagnosen. Uns ist der Tod nicht fremd, im Gegenteil, wir sehen ihn sehr oft. Er gehört für uns zum Leben. Wir dürfen einen Überblick geben. Eine Momentaufnahme, was an der Front tatsächlich los ist und was sich hinter den Kulissen abspielt.
Jetzt zum Beispiel ist Krisensitzung im Klinikum Klagenfurt. Damen, Herren und Ärzte in weißen Kitteln rund um einen ins Oval langgezogenen Tisch. Ernste Mienen. Rudolf Likar dabei als Intensivkoordinator für das Land Kärnten. Er ist übrigens der mit der runden roten Brille, grüß Gott. Wir diskutieren Fälle, virologische Details, die Zahl der freien Stations- und Intensivbetten, Einsatzpläne. Am Ende reden wir über Ausgangsbeschränkungen an sich, die Lockerungen, wie alles weitergeht. Das große Ganze. Sehr drastische Maßnahmen aufgrund eines Virus. Die einen sagen, nur so kann man Zehntausende Leben retten. Die anderen kontern, schön und gut, aber was hilft das, wenn später die kollabierte Wirtschaft Hunderttausende Leute finanziell umbringt.
Die Datenlage Mitte März war, dass wir in Kärnten gerade acht positive stationäre Patienten und eine Intensivpatientin hatten. Die Zahl der österreichweit Erkrankten ist längst fünfstellig, die Zahl der Toten zum Glück nur dreistellig, das Thema allgegenwärtig.
Corona ist für die Medien der heilige Gral. Die Bundeslade der Berichterstattung. Von früh bis spät werden wir mit Informationen, Bildern, Meinungen, Zahlen von Infizierten, an und mit Corona Verstorbenen und sonstigen Aussichten, Einsichten und Absonderlichkeiten beschallt und bestrahlt, dass manche schon froh sind, wenn irgendwo eine Rosamunde Pilcher im Fernsehen gezeigt wird und sich das Schmalz der Liebe über den Schandfleck der Endzeit schmiert.
Es geht um klares Wahrnehmen, Fakten und Relationen.
Wir haben rund 1.500 Influenza-Tote pro Jahr. Eintausendfünfhundert Menschen, die jedes Jahr in Österreich an der herkömmlichen Grippe sterben. Gibt es da Berichte, die wie die Offenbarung des Johannes klingen? Weltweit sterben 290.000 Menschen jährlich an eben dieser Grippe und bis zu 500 Millionen erkranken daran. Die Ansteckungsrate ist niedriger als bei Corona, stimmt. Trotzdem schreibt niemand: »Influenza-Pandemie: Mit dem Schnupfen kam der Tod«. Verbarrikadiert euch, schützt euch! Es kann jeden treffen.
Erstaunlicherweise sind aber nur 15 Prozent des gesamten Gesundheitspersonals in Österreich gegen Influenza geimpft.
Sprich, 85 von 100 Profis im heimischen Gesundheitswesen pfeifen auf die Immunisierung. Weil’s wurscht ist, oder warum? Die Grippe kriegen nur die anderen? Bequemlichkeit? Angst vor der Nadel? Haben Sie schon einmal gehört, dass Menschen panisch werden, wenn sie das Wort Grippe hören? Für die meisten ist es eine schlimmere Verkühlung, die für manche, ja, leider, letal ausgeht. Das Los der Alten und Schwachen. Schicksal.
Unterdessen wird das Zyklopenauge der Gesellschaft krampfhaft auf den Brennpunkt Corona gerichtet. Mitte April verzeichnete die Johns Hopkins Universität 2.076.015 COVID-19-Infizierte. 138.008 Tote. Und 522.881 Menschen, die schon wieder komplett geheilt sind. Das ist der natürliche Verlauf. Ansteckung, Ausbruch, Krankheitsverlauf, Heilung. (Aktuelle Zahlen finden Sie im Internet: de.statista.com)
Das Erstaunlichste aber ist ein Umstand, der gefährlicher ist als jede Tröpfcheninfektion: Bis jetzt, bis zu dieser Pandemie, gab es keinen österreichweiten Katastrophenplan.
Bis heute gibt es ihn nicht.
Keinen Plan für den Ernstfall.
Dabei war es absehbar. Unter Epidemiologen und Ärzten wurde immer wieder darüber diskutiert, dass es höchste Zeit für die nächste Pandemie wäre. 1918 und 1920 die Spanische Grippe in zwei Wellen mit insgesamt etwa 50 Millionen Todesopfern, vor allem jüngere Menschen. 1957/1958 Ausbruch der Asiatischen Grippe mit ein bis zwei Millionen Toten. 1968/1969 Hongkong Grippe mit einer Million Toten, 1977/1978 Russische Grippe mit 700.000 Toten. Dann 2001/2002 das erste Auftreten von SARS-CoV als erste Pandemie des 21. Jahrhunderts mit etwa 8.000 Fällen und knapp unter 800 Toten. 2009 die Schweinegrippe mit 18.000 Toten. Und seit 1980 HIV mit 35 Millionen Toten weltweit.
Pandemien sind keine biblische Strafe, wo es wie in den zehn Plagen Blut und Frösche vom Himmel regnet. Sie treten in regelmäßigen Abständen auf.
Trotzdem gab es keinen Plan.
Zu lange war der Föderalismus wichtiger als eine bundesweite Leitlinie, die man im Bedarfsfall aus der Schublade nimmt, aufschlägt und einfach alle Anweisungen Punkt für Punkt umsetzt.
Jeder Ausnahmezustand braucht eine Checkliste. Dabei reden wir nicht von einer detailgetreuen Vorstellung, wie man sich im Idealfall verhält, sollte ein Raumschiff im Wörthersee landen. Es geht auch nicht um eine landesweite Übung für eine allfällige Zombie-Apokalypse. Eine Pandemie kann jederzeit auftreten. Sie wird auch in Zukunft wieder auftreten. Hollywood-Regisseur Steven Soderbergh hat das im Jahr 2011 im Film Contagion anschaulich und mit Starbesetzung gezeigt. Ein neues Virus breitet sich aus. Gwyneth Paltrow tot, Kate Winslet tot, Matt Damon und Jude Law haben’s am Ende gerade noch geschafft. Der Thriller wirkt heute wie eine Doku.
Die Welt im Würgegriff einer tödlichen Seuche. So ist das aktuelle Bild gezeichnet. Ob es stimmt, werden die nahe Zukunft und vor allem die wissenschaftlichen Studien zeigen. Ob die drastischen Maßnahmen richtig waren, rechtzeitig kamen oder überzogen sind, ebenso. Zu viele Theorien, zu viele Experten, zu viele Berichte, Memes und Fake News sowieso.
Die Probleme im österreichischen Gesundheitswesen sind uns Ärzten vorher schon aufgefallen. Die kennen wir gut; wir haben heuer ein Buch zu dem Thema geschrieben: Im kranken Haus. Klar ist: Die Maßnahmen bei Corona haben zu langsam gegriffen. Es waren keine Teams da, um Abstriche zu nehmen. Es dauerte fast eine Woche, bis diese Teams für die Abnahme der Tests in-stalliert waren. Jetzt werden Epidemieärzte, sogenannte COVID-19-Ärzte, eingesetzt, die zu Patienten kommen, weil es dafür eine Spezialausrüstung braucht, die niedergelassenen Ärzten nicht im notwendigen Ausmaß zur Verfügung steht. Zukünftig wird es also ausgerüstete Ordinationen und entsprechend ausgebildete Epidemieärzte geben, die im Notfall sofort verfügbar sind. Diese notwendigen Maßnahmen dürfen nicht in langen Diskussionen steckenbleiben oder der leider immanent vorhandenen Innovationsfeindlichkeit, auch innerhalb der Ärzteschaft, zum Opfer fallen.
Niedergelassene Ärzte mussten ihre Arbeit mit Patienten auf das Allernötigste minimieren und ihre Beratung, das Ausstellen von Rezepten und Krankenscheinen per Telefon abwickeln. Allerdings müssen die praktischen Ärzte ihre Ordinationen wie kleine Unternehmen führen, sonst können sie zusperren. Sie brauchen jede Menge Patienten, viele abrechenbare Dienstleistungen, um ihr Ein-Personen-Unternehmen finanziell über Wasser zu halten. Wegen der Corona-Krise bleiben die Patienten nunmehr aber lieber daheim und das im großen Stil, weil sie sich vor Ansteckung fürchten.
Dazu kommt, dass die praktischen Ärzte am Land – Schlüsselpersonen der Gesundheitsversorgung – von den Verwaltungsbehörden keine Mitteilungen erhalten, welche Einwohner ihrer Gemeinde oder in den Nachbargemeinden an COVID-19 erkrankt sind.
Wilhelm Kerber, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte Kärntens, richtete eine schriftliche Bitte an den Bundeskanzler: »Ein Vorenthalten dieser wichtigen Informationen führt dazu, dass sich ÄrztInnen, deren MitarbeiterInnen und die PatientInnen einer massiven Infektionsgefahr aussetzen. Vielfach hat es bereits dazu geführt, dass Ordinationen wegen Quarantänemaßnahmen schließen mussten.«
Aus Gründen des Datenschutzes dürfen die Ärzte also nicht informiert werden, wer in ihrem Grätzel positiv getestet worden ist. Unterdessen geht die Flut der Breaking News weiter. Eine Negativmeldung jagt die nächste. Corona-Baby tot. Und, und, und. Erschöpfte Krankenpflegerinnen mit geröteten Gesichtern, vom stundenlangen Tragen spezieller Schutzmasken. Und immer Italien als Schreckgespenst im Hintergrund. Das zerstörte Dolce vita am Ende der Epidemie. Die Bilder vom Abtransport der Särge, die von Militärfahrzeugen untertags, nicht in der Nacht – untertags, wo es alle sehen – durch ein Dorf gefahren werden. Meldungen, dass sich Menschen nicht mehr von ihren geliebten Angehörigen verabschieden konnten. Leichenberge. Das multimediale Armageddon.
Die Lombardei als beunruhigendes Exempel. Es wird nicht verglichen mit Toten der anderen Regionen, sondern immer die Lombardei, die nur 676 Intensivbetten auf 10 bis 15 Millionen Einwohner hat. Im Unterschied zu 2.500 Intensivbetten in Österreich auf 8 Millionen Einwohner. Da in Italien die entsprechenden Vorkehrungen nicht getroffen wurden, hinsichtlich Isolierung und dergleichen, ist das Ganze eskaliert. Die Situation ist außer Kontrolle geraten, weil niemand rechtzeitig für den Ernstfall vorgesorgt hat. Und es ist erschreckend, dass hier immer nur die Zahlen von sechshundert, siebenhundert, tausend Toten pro Tag genannt wurden. Man hat nicht gesagt, wie viele zuvor pro Tag gestorben sind. Es wurde die Zahl auch nicht auf 8 Millionen heruntergebrochen – im direkten Vergleich zu Österreich. Die Politiker und der Boulevard nannten Absolutzahlen; das wirkt wie eine Angstmache. Bisweilen hat die Presse ergänzt, dass Corona-Patienten auch wieder genesen. Was für ein Wunder.
Wir können und dürfen den Schrecken, der in Italien passiert ist, nicht mit Österreich vergleichen. Unsere Spitäler haben höhere Standards, was Hygiene und Notfalleinsätze betrifft. Wir sind schlicht und ergreifend besser aufgestellt.
Grob gesagt, gibt es in Italien und auch in Frankreich laut OECD-Bericht 16 Intensivbetten auf 100.000 Einwohner. In Österreich sind es 29 Intensivbetten auf 100.000 Menschen. Das sind andere Voraussetzungen.
Zahlen waren über Wochen der Gradmesser für die Fieberkurve der menschlichen Existenz.
Die Sterblichkeitsstatistik war aber leider falsch.
Es ist ein großer Unterschied, ob man an COVID-19 oder mit COVID-19 stirbt. Nach Rücksprache mit Italien erfahren wir Krisenmediziner: Wenn ein Patient Corona-positiv ist und an einer anderen Ursache stirbt, wird er trotzdem als Corona-Toter gezählt. Allerdings kann der Mensch aus Millionen anderen Gründen sterben. Nach diesen Berechnungen aber ist die Mortalitätsrate verwaschen.
Es fragt sich natürlich, warum der Corona-Tote so viel wert ist. Medial? Medizinisch? Statistisch? Ethisch? Warum sein Ableben mehr bedauert wird als das eines zehnjährigen Buben, der an Leukämie stirbt. Oder einer Neunzigjährigen, die einfach nicht mehr aufwacht. Gibt es ein neues Ranking der schrecklichsten Arten, dieses Leben zu verlassen? Einen neuen Angstgegner, der am Ende dasteht und das Fallbeil runtersausen lässt?
Konkrete Beispiele aus dem Berufsalltag können wir gern geben. Im Klinikum Klagenfurt haben wir den Notfallplan auf den chirurgischen Abteilungen eingeführt. Das heißt, es wurden nur noch Not- und Tumoroperationen durchgeführt. Alle anderen Eingriffe mussten warten, bis sich die Situation normalisiert. Für ganz Kärnten wurde ein Intensivkonzept erarbeitet. Likar hat man den etwas paramilitärisch klingenden Titel »Intensivkoordinator für Kärnten« verliehen. Auch zu normalen Zeiten geht es bei uns nicht unbedingt so gemütlich zu wie in einer Bücherei am späten Nachmittag. Intensive Koordination braucht es täglich, sonst gibt es bei den EKGs, die neben den Betten ihre gezackten Muster zeichnen, mehr Nulllinien.
Es wäre vor allem notwendig, einen Intensivkoordinator in jedem Bundesland einzuführen. Diese neun Krisenmanager könnten sich dann untereinander koordinieren, auch hinsichtlich des intensivmedizinischen Therapieschemas, was aufgrund von Initiativen einzelner auch erfolgte.
Für die Intensivbehandlung in den Zeiten von Corona sieht unser lokaler Plan so aus: Wir hatten in der ersten Stufe fünf Betten für COVID-Patienten reserviert. In der nächsten Stufe waren 17 Betten in der Intensivstation frei, dann nochmal 18 zusätzlich, also insgesamt 35. Es war und ist alles unter Kontrolle. In Wien war die Situation freilich angespannter. Mehr Menschen, mehr Patienten.
Und sofort wird lokalpolitisch überreagiert. Hektisch riefen Entscheidungsträger ein Lazarett herbei. Im Krieg gegen das Virus brauche es Feldbetten. Also werden Liegen – schnell, schnell – in einer Tennishalle aufgestellt. Kurze Frage: Warum denkt niemand daran, dass wir Häuser haben, wo seinerzeit Flüchtlinge untergebracht wurden? Diese Gebäude stehen leer und ließen sich viel besser für COVID-19-Patienten verwenden, die aufgrund ihrer sozialen Lage nicht zu Hause bleiben können. Wer dagegen von kriegsähnlichen Situationen spricht, als wären biologische Waffen auf uns abgeschossen worden, löst automatisch Unsicherheit aus. Bei dem einen Mulm im Magen, bei anderen eine Panikattacke. Weltkrieg 3. Das Ende naht. Die Todesengel fliegen herab. Dort vorne lodert das Fegefeuer.
Dazu kommt, dass jeder Arzt, der positiv getestet wurde, in den Medien vorgeführt wird wie ein Opferlamm. Und dann auch noch die Prominenz und der Hochadel. Prinz Charles hat es getroffen, mein Gott, überlebt das die Queen?
Wir Mediziner sind vielleicht keine Marketing-Genies, aber eines tun wir nicht: Wir wollen keine Krankheit hochstilisieren und damit noch mehr Unsicherheit in der Bevölkerung erzeugen, als ohnehin schon da ist. Die Politiker singen derweil ihr Hohelied auf Ärzteschaft und Pflegepersonal. Das geht leicht von der Zunge.
Es ist ehrlich gesagt auch ethisch bedenklich, wenn man mit einem Fingerschnippen auf alle anderen Nöte in der Welt vergisst. Nicht nur die Flüchtlingswelle von Syrien in die Türkei und nach Griechenland. Niemand spricht mehr über die Hungersnöte, niemand spricht mehr über die Kriegstoten. Es wird nur noch über die Corona-Toten gesprochen. Warum?
Aus medizinischer Sicht dürfen wir sagen: Die Regierung leistet sehr gute Arbeit, keine Frage. Das Problem der Regierung, die diese drastischen Maßnahmen beschlossen hat, sind aber auch die Sekundärfolgen, die als kalkulierbares Risiko hingenommen werden müssen. Die Begleiterscheinungen, dass Hunderttausende Menschen vor dem Nichts stehen, dass Gewalt in den Familien zunimmt, dass möglicherweise Scheidungsraten steigen werden, dass es zu mehr Depressionen kommen könnte, zu Burnout, zu Einkommenskatastrophen. Der sogenannte Kollateralschaden ist hoch.
Es braucht ein Deeskalations-Szenario. Bislang drehten alle schön fest an der Eskalationsschraube, tote Menschen, Wirtschaft am Sand, aber Bilder der Besserung sehen wir selten. Alle mögen durchhalten, als wäre das ein Marathon. Das Aufatmen ist gekommen, freilich, die Lockerungen auch. Aber das Virus wird sich nicht flugs in Luft auflösen, wenn die Politspitze freundlich nickend verkündet, dass sich die Lage gebessert hat, danke an alle Österreicherinnen und Österreicher. Das Virus wird nicht eingeschüchtert abziehen. So ein Erreger regt sich grundsätzlich nicht auf. Er verbreitet sich emotionslos, kalt.
Die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin, kurz ÖGARI, hat ein Ethikpapier herausgegeben. Das muss man sehr vorsichtig erklären. Derzeit erwarten sich alle Patienten, die Corona-positiv sind, dass sie besonders gut behandelt werden. VIP-Status aufgrund aktueller Not. Als Arzt darf man aber nicht zwischen vorher Schwerkranken und akut Schwer-Corona-Kranken unterscheiden.
Das führt zu einer heiklen Frage und einem moralischen Dilemma. Ist der Patient schwer krank und Corona-positiv, müsste der gleiche Ansatz wie bei normalen Schwerkranken gelten: Hat der Patient kein Therapieziel und ist auch keine Prognose in Aussicht, sprich keine Verbesserung der Lebensqualität, sollte der Arzt keine Intensivmaßnahme durchführen. Das bedeutet, man lässt den Kranken sterben.
Niemand hat gesagt, dass Mediziner es leicht haben. Auf einer Intensivstation treffen wir Entscheidungen über Leben und Tod. COVID-19-kranke Menschen werden übrigens, nachdem sie gestorben sind, nicht obduziert, sondern gleich eingegraben oder verbrannt.
Mitte März hatten wir im Klinikum Klagenfurt zwei Patienten auf der Intensivstation liegen. Alle Vorkehrungen wurden getroffen, auch hinsichtlich Operationen und Schockraumpatienten. Nebenbei erfuhren wir, dass eine Intensivpflegerin in einem Krankenhaus Corona-positiv war. Wenn so etwas passiert, muss man sofort reagieren. Es beginnt mit einem Konzept für das Intensivpersonal im Dienst und der Intensivpflege. Quarantäne, Befragungen, wo die Leute in letzter Zeit waren, wen sie getroffen haben. Diese Interviews sind wichtig, um den Schneeballeffekt der Ansteckung aufzuhalten. Man muss lückenlos herausfinden, wer mit der Frau Kontakt hatte. Das ist natürlich eine Herausforderung. Übrigens auch so ein Wort, das sehr gern verwendet wird. Es gibt keine Probleme mehr, nur mehr Herausforderungen. Klingt positiver, heißt das gleiche. Die Krankenpflegerin ist wieder negativ, sie hatte keine Symptome und musste zwei Wochen daheimbleiben.
Quarantäne. Die Besserwisser kontrollieren gern, ob man das Wort richtigerweise mit K ausspricht, also Karantäne. Eigenbrötler bevorzugen als Synonym das alte Wort Kontumaz. Macht die Situation auch nicht heimeliger. Und die Lage nicht lustiger. Familien hocken teilweise auf engstem Raum, die Mutter gestresst, der Vater auf Kurzarbeit und das Kind im Internet. Die Zeit zerdehnt sich bis zur Unerträglichkeit. Menschen gehen raus, müssen raus, weil sie in der Isolation durchdrehen.
Der Mensch kann auch an Verzweiflung sterben.
Wir meinen, es ist wichtig, dass man die alten Menschen schützt und das Konzept mit der Ausgangsbeschränkung nur solange verfolgt, bis sich eine Besserung abzeichnet. Grund für die Abschottung ist die rasante Verbreitung des Virus, das wissen wir. Für eine Epidemie ist die alles entscheidende Größe der Replikationsfaktor R0.
Dieses R0 zeigt, wie viele Menschen eine infizierte Person von sich aus ansteckt, den Faktor der Weitergabe. Das Teuflische an der Sache ist, dass der Verlauf nicht linear, also langsam und nachvollziehbar von einem zum nächsten verläuft, sondern exponentiell, unkontrolliert. Bei anfänglichen, in China angenommenen Werten von R4 heißt das: Ein Kranker, vier Kranke, sechzehn, vierundsechzig, zweihundertsechsundfünfzig, eintausendvierundzwanzig, … Die Kurve schießt nach oben, die Zahl der Kranken und auch der Toten schnellt hoch. In Österreich hat sich der Wert im März alle zwei Tage verdoppelt, sprich R2. Ist der Faktor R kleiner als 1, klingt eine Epidemie wieder ab.
Eine andere Strategie, wie sie beispielsweise Großbritannien am Anfang angelegt hat, ist, die Verbreitung bewusst in Kauf zu nehmen, um die sogenannte Herdenimmunität früher zu erreichen und das reguläre Leben wieder aufzunehmen. Die Strategie der Sorglosigkeit hat einen Nachteil: Sie beschleunigt das Infektionsgeschehen, statt es zu verlangsamen, und erhöht damit das Risiko, dass viele schwere Fälle auf einmal die Intensivstationen bevölkern. In Grippezeiten heikel. Der Shutdown ist nichts anderes als eine Verzögerungstaktik der Ansteckung. Um das System nicht zu überfordern oder zum Einsturz zu bringen.
Nachdem die Exponentialkurve der Ansteckung abgeflacht war, wurden die Restriktionen gelockert, nicht zuletzt, um das soziale Gefüge und das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten, das wirtschaftliche Überleben sowieso. Mitte April wollte sich die Regierung nicht mit konkreten Zahlen festlegen, ab wann die Situation deeskaliert. Der Osterhase brachte Schutzmasken und langsam ein Aufatmen.
Erste Studien der Uni Wien ergaben, dass ein wesentlicher Überträger des Coronavirus das Gesundheitspersonal selbst ist. Sie sind sogenannte Superspreader. Was logisch ist. Sie haben direkten Kontakt zu den Kranken.
Das Problem bei der COVID-Primärversorgung ist, dass keine Strukturen vorhanden waren. Es wurden Turnusärzte für das System rekrutiert und Ärzte mit Jus practicandi aus allen Abteilungen verpflichtet. Lungenärzte sahen sich nach ersten Anlaufschwierigkeiten in der Primärverantwortung bei der COVID-Versorgung. Wir haben an all diesen Punkten entsprechend gesteuert. Es braucht schnelle Reaktionen in Spitälern. Es ist, als operierten wir am offenen Herzen, bei jeder Maßnahme, die wir setzen. Natürlich, auch Ärzte sind nicht frei von Egoismus und Existenzangst. Es ist erschreckend, wie einige Abteilungen sich dezent zurückziehen und sich eine Hysterie breitmacht. Anfangs bemerkten wir ein generelles Unbehagen bei fast allen Medizinern, mit denen wir arbeiten. Einen Pesthauch, der das Krankenhaus umweht.
Das Gefühl ist aber künstlich erzeugt und geschürt wie ein Feuer im Kamin. Es zieht kein Todesvirus wie Ebola über Österreich hinweg und hinterlässt eine Autobahn an Leichen. Aber solange es keine Therapie und Impfung gibt, bleibt die Gefahr des Coronavirus bestehen. Am Beispiel Klagenfurt können wir sagen: Es waren im April über 700 stationäre Betten und rund 90 Intensivbetten frei, und es ist glücklicherweise zu keiner Unterversorgung gekommen. Bis Mitte April hatten wir in Kärnten zugleich maximal 13 COVID-positive Intensivpatienten und 21 stationäre Patienten. Das spiegelt auch wider, dass wir genug Krankenhausbetten haben, um im Krisenfall rasch handeln und entsprechend notwendige Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können. Andererseits haben wir keine eigene Klinik oder zumindest eine Station für Infektionserkrankungen. Wie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es eine eigene Tuberkulosestation gegeben hat. Dieses Konzept wurde als überholt betrachtet. Wir denken, es ist wieder an der Zeit, über solche Spezialkliniken laut nachzudenken. Hierin sollte das System in weiser Voraussicht investieren. Die nächste Pandemie kommt bestimmt.
Die Erregung an der Endzeit führt unserer Meinung nach nicht zu einer sozialen Stärkung, was gerne gepredigt wird, sondern vielmehr zu einer sozialen Verarmung der Gesellschaft. Social distancing im ganz großen Stil. Immer noch werden durch unterschiedlichen Föderalismus Maßnahmen falsch getroffen, wie in Tirol, wo die Politik langsam reagiert hat. Erst hat man wohl wegen des Tourismus gewartet und dann die Verschärfungen vorgebetet, Ausgangssperre, liebe Tirolerinnen und Tiroler.
Bei uns im Spital sind im März zwei Menschen gestorben, die COVID-positiv waren. Wir hätten schreien können: Wieder zwei Corona-Tote! In Wahrheit hatte der eine Patient, er war Mitte fünfzig, eine Lungenfibrose, also eine schwere Krankheit. Der Mann wollte nicht intubiert, sprich beatmet werden, weil er wusste, dass es nichts mehr bringen würde. Corona hat diesen Patienten nicht gekillt. Jeder Keim hätte genügt, um seine Lebensflamme auszulöschen.
Die zweite sogenannte Corona-Tote war eine 91-jährige Dame. Sie hatte einen gütigen Blick und war zufrieden mit ihrem langen Leben. Sie lächelte die Krankenschwestern immer an. Zum behandelnden Arzt sagte sie: »Danke, Herr Doktor. Sie müssen sich nicht so anstrengen.« An einem Mittwoch um halb sieben hörte ihr Herz einfach auf zu schlagen.
Bei den intensivmedizinisch behandelten COVID-19-Patienten ist nach aktueller Datenlage mit einer Sterblichkeit von dreißig bis siebzig Prozent zu rechnen. Man stirbt auch an Corona. Das ist kein außergewöhnlich hoher Wert bei älteren Leuten mit schwerem Akutem Atemnotsyndrom; wir nennen das ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome. Überlebende leiden an den üblichen Folgen einer langen Intensivbehandlung.
Bitte verstehen Sie uns nicht falsch. Es ist tragisch, wenn Menschen an COVID-19 sterben. Man kann sich vom Patienten nicht mehr verabschieden. Es zeigen sich häusliche Tragödien, und es kommt beim Tod zum abrupten Bruch der Beziehung. Der geliebte Mensch ist einfach weg, aus dem Leben gerissen, für immer fort. Wir Ärzte gehen da in eine andere Richtung, wenn wir fordern: Wir müssen den Tod wieder ins Leben zurückbringen. Er gehört dazu. Hier pfuscht uns das Virus hinein und macht die Rechnung kaputt. Der Mensch wird in einen Sack gesteckt. Es gibt keine Verabschiedung mehr, keine Besuche. Keinen Übergang in etwas anderes, vielleicht Höheres, das durch die Verabschiedung eingeleitet wird.
Wir haben das selbst erlebt. Unser Zentralbetriebsrat ist gestorben. Das Begräbnis fand mit nur fünf Personen statt. Es wären viel mehr Leute gekommen, aber es war verboten. Wir konnten nicht adieu sagen. Nur im Stillen. In sicherer Distanz und Abgeschiedenheit. Was hätten wir tun sollen, eine WhatsApp-Gruppe gründen? Wir sagen: Der Tod wird durch das Virus abstrahiert.
Auch auf unserer Intensivstation konnte sich ein Angehöriger eines COVID-Patienten nicht mehr vom Sterbenden verabschieden. Der Sohn wurde dadurch traumatisiert, was wir in Einzelgesprächen bearbeiten konnten. Wir haben auf diesen Fall reagiert und mit unserem Hygieniker ausgemacht, dass sich Menschen zum Verabschieden in den Hochsicherheitsbereich einschleusen dürfen. Um sehr wohl Abschied zu nehmen.
Die Frage ist: Wie weit und wie lange kann eine Gesellschaft ihre individuellen Bedürfnisse den Zielen der Politik, der Allgemeinheit unterordnen? Und wo sind die Grenzen, wenn die individuellen Bedürfnisse nicht nur kurzzeitig ausgesetzt sind, sondern die Psyche langfristig malträtiert wird? Wie bei Leuten, die an einem posttraumatischen Stresssyndrom leiden, nachdem sie dem Krieg entkommen sind. Wie viele Leute haben denn jetzt schon eine Wut im Bauch, die da drinnen brodelt und bloß ein Ventil sucht, über das sie hinauskommt? Der Druck im Schnellkochtopf erhöht sich. Selbst wenn die Einschränkungen gelockert sind und das Leben da draußen wieder aufblüht.
Es geht unterdessen in der Gesellschaft nicht mehr um das reine Verbot. Sondern um Privilegien. Wenn ich etwas nicht darf, warum darf das der andere? Warum wurde das Reiten verboten? Wenn alle anderen Ausgangsbeschränkung haben, warum soll man überhaupt ausreiten? Die Leute schauen sich gegenseitig auf die Finger. Wer fährt U-Bahn, wer Bus? Warum? Wer trägt keine Maske? Wer greift im Supermarkt das Brot ohne Handschuhe an? Wem geht’s besser, wem geht’s schlechter? Wer darf wann aufsperren, wer darf wo Urlaub machen? Masken beim Frühstück im Hotel? Gibt es noch Buffets? Oder Leute, die im Fitnesscenter trainieren und dann ins Dampfbad oder in die Sauna gehen? Gibt es private Clubs? Wer genießt Vorzüge, die nicht sein dürfen, und warum? Wer darf aus den Fördertöpfen naschen, wem sind sie verwehrt? Die Gesellschaft verliert das Gleichheitsgebot. Und die Toleranzgrenze.
Für Ärzte wird es in Zukunft eine andere Art der Klassifizierung von Notfallpatienten geben, wenn sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Man nennt dieses System der Schnelleinteilung Triage. Bislang war entscheidend, ob der Patient eine offene Wunde hatte oder nicht. Die Triage war demnach blutig/unblutig. In Zukunft wird die Triage thematisch ausgeweitet werden müssen: infektiös/nicht infektiös und erst dann blutig/ unblutig.
Die allgemeine Verunsicherung führt außerdem dazu, dass in der Nacht weniger Akut-OPs durchgeführt werden. Hier stellt sich eine Grundsatzfrage: Haben wir bislang zu viel operiert? Bestimmt das Angebot die Nachfrage? Eigentlich müsste die Zahl der Akut-OPs gleichgeblieben sein. Es gibt aber deutlich weniger Eingriffe. Oder gehen Menschen jetzt nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus, und es kommt zu Langzeitfolgen?
Botox und Schönheits-OPs müssen halt warten.
Auf der anderen Seite kommt es zur Unterversorgung, was die Schmerztherapie betrifft. Wir Ärzte haben gehört, dass Menschen jetzt lieber starke Schmerzen aushalten, bevor sie aus dem Haus und ins Krankenhaus gehen. Weil sie Angst haben, sich mit dem Coronavirus anzustecken.
Zunehmend bedrohlich ist ein anderer Umstand: Pharmafirmen können manche Präparate nicht mehr liefern. Zum Beispiel gibt es beim Blutdrucksenker Trandate einen Totalausfall.
Der Vertreter von Aspen Pharma Ireland schreibt in einer Mail: »Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Produktion von Labetalol-Hydrochlorid bei einem Fremdhersteller in Italien eingestellt werden musste, was zu einem Lieferausfall im gesamten europäischen Markt führt, respektive führen wird. Der Produktionsaufbau mit entsprechender Wiederbelieferung ist leider erst ab Januar 2021 zu erwarten.«
Jetzt lässt sich das verschmerzen, das Spital kann zu anderen Präparaten greifen, aber – weitergedacht: Was passiert, wenn andere Arzneien nicht mehr vorhanden sind?
Aktuell verhält es sich so mit dem Schlaf- und Beruhigungsmittel Sedalor. Bis auf Weiteres nicht lieferbar. Es gibt am Markt aber kein anderes Präparat mit dem Wirkstoff Lormetazepam.
Paracetamol, ein schmerzlindernder und fiebersenkender Arzneistoff, in Indien produziert, dürfte bald nicht mehr erhältlich sein, weil die Produktion nicht gesichert ist und es kein Werk in Europa gibt.
Ebenfalls in Indien, in Hyderabat, werden die meisten Antibiotika für den Weltmarkt hergestellt. Angenommen, das Coronavirus greift dort um sich und legt die Produktionsstätten lahm. Das erzeugt in ein paar Monaten Engpässe bei allen Antibiotika weltweit. Und dann gibt es parallel zum Ausfall der Heilmittel neue multiresistente Keime, die sich rund um den Globus verteilen. Keime, gegen die sich das Coronavirus wie ein Aprilscherz ausnimmt.
Aus diesen Gründen müssen wir vorsorgen. Wir brauchen einen Masterplan. Um für die Zukunft gewappnet zu sein.
Hier ist er.