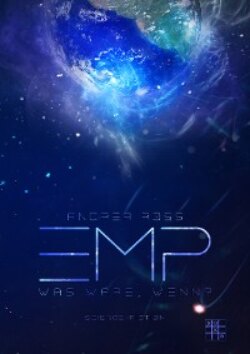Читать книгу EMP - Andrea Ross - Страница 7
ОглавлениеKapitel 1
Das »WENN« ist eingetroffen
Liebes Tagebuch …
Moment, eigentlich kann ich diese schmalzige Anrede überhaupt nicht leiden! Sie ist reichlich antiquiert und erinnert mich schwer an die spießig-muffeligen 1960er, als so etwas noch als modern galt! Wer redet heutzutage schon mit einem Buch und ist dabei auch noch höflich?
Wahrscheinlich bin ich auf die Idee mit dieser angestaubten Einleitung auch nur deshalb gekommen, weil ich heute den ersten Text, der über ein paar Kurznotizen hinausgeht, mit der Hand schreiben muss. Seit meiner Schulzeit habe ich das nicht mehr getan. Doch was bleibt mir jetzt anderes übrig, wenn ich wie üblich meine Gedanken sortieren will, indem ich sie niederschreibe? Mir fällt wieder mal auf, wie unordentlich und krakelig meine Schrift über das Papier kriecht. Vermutlich, weil mir die Übung fehlt.
Mein nagelneues Notebook steht total funktionsunfähig auf dem Schreibtisch und ich muss mich ziemlich beeilen, weil unter anderem anscheinend auch die Stromversorgung der Stadt zusammengebrochen ist. Sobald es dunkel wird, ist es wohl für heute vorbei mit meinen Aufzeichnungen.
Was ist hier eigentlich passiert? Wenn ich das bloß wüsste! Kein Mensch ist genau darüber im Bilde, was vor sich geht. Aus diesem Grund kann sich auch niemand vorstellen, wie lange die drastischen Veränderungen andauern werden, die seit heute Morgen das öffentliche Leben lahm legen und alle Menschen, denen ich begegnet bin, gleichermaßen beunruhigen.
Aber ich sollte mit meinem Bericht von vorne beginnen. Sonst kann ich später gar nicht mehr nachvollziehen, welch wirres Durcheinander heute in meinem Kopf herrscht. Alles schön der Reihe nach!
Ich habe leider das dumme Gefühl, dass die ohne Vorwarnung über uns hereingebrochenen Zustände nicht einfach morgen früh spurlos vorüber sein werden, alles wie selbstverständlich zur Normalität zurückkehren kann. Deswegen werde ich jetzt über die Beobachtungen des heutigen Tages einfach kurz und sachlich das Datum schreiben, schließlich bin ich Beamtin von Beruf. Alles muss seine logische Ordnung haben, sonst fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut. Also, nun denn:
Freitag, 14. Februar 2020, Valentinstag
Ich wachte auf, weil die tief stehende Sonne verstohlen durch die Jalousien des Schlafzimmers blinzelte und meine Nase hartnäckig mit ihren Strahlen kitzelte. Wohlig wollte ich mich strecken wie eine Katze, mich umdrehen und einfach weiterschlafen, so wie ich es samstags traditionell immer handhabe. Doch dann fiel mir siedend heiß ein, dass heute gar nicht Samstag, sondern erst Freitag ist!
Der Schreck über diese Erkenntnis muss mir eine wahre Riesenportion Adrenalin durch den Körper gejagt haben, panisch sprang ich aus meinem Bett. Weshalb, zum Teufel, hat eigentlich mein im Handy eingebauter Wecker nicht geklingelt? Sonst holt mich das Ding jeden Morgen zuverlässig aus den Federn. Und zwar noch weit vor dem Morgengrauen.
Aber heute nicht! Ich stellte schnell frustriert fest, dass mein Handy tot war. Mausetot, komplett entladen. Dachte ich wenigstens zunächst. Bis ich das Ladekabel holte und feststellen musste, dass das Gerät auch damit nicht wiedererweckt werden konnte. Verflixt noch mal, ich musste auf jeden Fall verschlafen haben, und zu allem Überfluss schien noch das schicke I-Phone seinen Geist aufzugeben! Ich hasste den Tag schon in diesem Moment.
Ziemlich genervt und noch ganz schwindelig tappte ich ins Wohnzimmer, um die aktuelle Uhrzeit herauszufinden. Danach würde ich im Amt anrufen und mir den Spott der Kollegen zuziehen müssen, die sich dann tagelang köstlich darüber amüsieren würden, dass ausgerechnet ich, die Vorzeigebeamtin, mich des Zuspätkommens schuldig machte. Peinlich!
Aber es kam ganz anders, der lästige Anruf wurde mir erspart. Die Anzeige meines DVD-Rekorders blieb dunkel, keine blassblaue Leuchtanzeige gab wie sonst die Uhrzeit an. Auch das Festnetz-Telefon war tot.
Ich überlegte. Versuchte, eine Erklärung zu finden. Hatten wir vielleicht über Nacht einen totalen Stromausfall gehabt, war die Sicherung draußen und die Telefonleitung gestört? Diese in letzter Zeit wegen des Klimawandels häufiger auftretenden Wintergewitter sind nicht zu unterschätzen. Genau, das musste der Grund sein! Hoffte ich wenigstens.
Zielstrebig setzte ich meine Wanderung durch die kühle Wohnung in Richtung des Sicherungskastens fort, der ganz vorne im Flur neben der Haustüre angebracht ist. ›Heureka!‹, dachte ich erleichtert, als ich die Abdeckung geöffnet hatte und die Schalter sah. Tatsächlich zeigten sie allesamt nach unten, einschließlich des größeren Hauptschalters.
Dass etwas so ganz und gar nicht stimmen konnte, merkte ich erst, als sich die Schalter nicht mehr in die aufrechte Position drücken ließen, nicht einmal mit roher Gewalt; sie rochen außerdem dezent nach verschmortem Plastik. Von einem derart zerstörerischen Überspannungsschaden hatte ich bislang noch nie gehört.
Erst jetzt fiel mir auf, dass dies nicht das Einzige war, was sich an jenem Morgen beunruhigend anders anfühlte. Es war ruhig. Viel zu ruhig, totenstill geradezu! Bis auf ein verhaltenes Murmeln aus dem Treppenhaus, das wohl von tratschenden Nachbarinnen herrührte, hörte ich nämlich überhaupt nichts. Und das wohlgemerkt, obwohl meine Wohnung in der Nähe eines Krankenhauses an einer stark befahrenen vierspurigen Straße liegt.
Verflixt, mir tut jetzt schon die rechte Hand weh! Aber ich muss trotzdem weiterschreiben, die Zeit drängt. Auch wenn ich die exakte Uhrzeit nicht kenne – die Sonne steht jedenfalls sehr tief. Es wird bestimmt bald dunkel werden. Schon wirft meine Hand lange Schatten über das Papier.
Also weiter.
Als nächstes zog ich mich hastig an, um wenigstens nicht mehr zu frieren; der Temperatur nach konnte ich annehmen, dass sogar die Zentral-Heizungsanlage ausgefallen war. Gleich danach musste ich einsehen, dass heute logischerweise auch die Kaffeemaschine streikte. Ohne Strom nix los. Und ohne Kaffee würde heute auch mit mir erst einmal nicht viel los sein, überlegte ich grimmig.
Nirgends gab es in meinem modernen Haushalt eine mechanische Uhr, deshalb nahm ich mir fluchend vor, als erstes die Nachbarin zur Rechten heimzusuchen. Falls mir das Glück hold wäre, funktionierte dort die Elektrizität. Oder Martha konnte mir wenigstens schonungslos sagen, um wie viele Stunden ich mich auf der Arbeit verspäten würde.
Als ich auf den Klingeltaster drückte, durfte ich mich bereits von Hoffnung Nr. 1 verabschieden. Kein Ton kündigte mein Kommen an, die Klingel funktionierte nicht. Seufzend krümmte ich einen Zeigefinger, um in guter alter Manier höflich anzuklopfen.
Mich hätte fast der Schlag getroffen, als Martha Behringer unvermittelt die Türe aufriss, noch bevor ich zum Klopfen gekommen war. »Oh, hallo … also, ich wollte grade … wissen Sie es auch schon?«, fragte diese entgeistert.
Mein Puls raste immer noch, deshalb fragte ich nur verdattert:
»Was genau meinen Sie? Das mit dem Stromausfall?«
Martha, die in ihren wattierten Morgenrock gewickelt türrahmenfüllend vor mir stand, ist schon lange arbeitslos. Wir Nachbarn nennen sie hinter vorgehaltener Hand gerne die »Hartzer-Martha« – in Anspielung auf die Art ihres Einkommens, welches allmonatlich vom Amt kommt. Woraus Martha sich nichts macht, denn sie hat sich ihr ereignisloses Leben ohne Familie, tägliche Arbeit oder sonstige lästige Verpflichtungen offenbar zufriedenstellend eingerichtet.
Vermutlich hatte sie vom Stromausfall erfahren, weil der Fernseher ihr die allmorgendlichen Daily Soaps versagte. Jetzt drehte sie die Augen heraus und schob das Kinn nach vorne, was sie traditionsgemäß tut, bevor sie höchst wichtigen Tratsch in der Weltgeschichte verbreitet. Welcher selbstverständlich so streng geheim ist, dass die Hausgemeinschaft spätestens nach einer Stunde zur Gänze von den unsäglichen Neuigkeiten weiß. Manchmal habe ich schon insgeheim vermutet, sie würde einfach Sachverhalte aus ihren seichten Fernsehsendungen entnehmen, um sich wichtigmachen zu können.
Aber ich schweife schon wieder ab! Also: Martha erzählte mir brühwarm, dass weder Steckdosen, noch die Heizung, noch akkubetriebene Geräte funktionieren würden. Dass sie gerade nach unten hatte gehen wollen, um nachzusehen, was mit den Autos nicht stimme – ob mir gar nicht aufgefallen sei, dass heute kein Mensch motorisiert auf den Straßen unterwegs sei?
Vor fünf Minuten erst habe sie mit dem »Ecki« gesprochen, der in der Wohnung unter mir wohne. Der habe erzählt, dass noch alles ganz normal funktionierte, als er früh um 5 Uhr aus dem Nachtdienst nach Hause gefahren war. Es seien bloß jede Menge »komische Lichter« am Himmel gewesen.
Na ja, der Ecki! Ich musste schmunzeln. Ecki alias Bruno Eckert ist nämlich ein recht unbedarfter Zeitgenosse, der unbeirrbar an UFOs und Außerirdische glaubt. Komische Lichter, na klar! Ecki interpretiert oft und gern banale Vorgänge, damit sie perfekt auf seine abgefahrenen Theorien passen. Aber andererseits war auch mir aufgefallen, dass die allgegenwärtigen Straßengeräusche total fehlten.
»Na gut? Gehen wir nachsehen!«, schlug ich vor und begleitete meine nicht ganz salonfähige Nachbarin nach unten.
Mensch, ich sehe fast nichts mehr! Soll ich lieber morgen weiterschreiben? Aber was ist, wenn das morgen so weitergeht und ich mit den Aufzeichnungen gar nicht mehr nachkomme? Ich gehe mal Kerzen suchen, irgendwo müssten noch welche herumliegen. Seit der Sache mit Mark, die vor zwei Monaten so kläglich den Bach hinunter ging, habe ich keine Kerze mehr angezündet. Sentimentale Romantik ist so völlig fehl am Platze, wenn man alleine lebt und dadurch nur unliebsam an eine vergangene Partnerschaft erinnert wird. Besonders an Tagen wie dem Valentinstag. Und gerade heute bin ich gezwungen, mich wider Willen doch mit Kerzen zu befassen, hurra!
*
So, da bin ich wieder! Am Tischplattenrand meines Schreibtisches entlang stehen nun lauter kleine Teelichter im Kreis drapiert, die mich hoffentlich befähigen werden, bei diesem flackernden, unsteten Licht weiterzuschreiben. Diese Dinger brennen angeblich für vier Stunden, das sollte mir ausreichen.
Wie viele dieser mickrigen Flämmchen man doch benötigt, um eine einzige Glühbirne zu ersetzen! Ich habe mir gerade drei Pullover und ein dickes Paar Socken zusätzlich angezogen, denn langsam kriecht die Februar-Kälte unangenehm deutlich in meine kleine Mansardenwohnung. Wenigstens werden sich dadurch die Lebensmittel im funktionsunfähigen Kühlschrank ein bisschen länger halten. Hoffentlich! Die Gefrierfächer habe ich schon ausräumen müssen. Nur – wie zum Teufel kriegt man eine Pizza gebacken, so ganz ohne Mikrowelle und Backofen? Ich werde das aufgetaute Zeug morgen alles wegwerfen müssen. Schade drum.
Aber zurück zum heutigen Vormittag. Ich stieg also neben der Behringer die Treppe hinunter, wobei meine dicke Begleiterin unablässig mit ihrer schrillen Fistelstimme auf mich einredete. Sie erwog wohl allen Ernstes, Eckis wilden Spekulationen Glauben zu schenken, wonach die schon lange unerkannt auf der Erde anwesenden Außerirdischen heute nun die Erdenbewohner elektrotechnisch handlungsunfähig gemacht hätten, um den Planeten endgültig an sich zu reißen.
Ich hörte nur mit einem Ohr zu, weil ich mir längst eigene, erheblich nüchternere Gedanken zu den seltsamen Ereignissen machte. Wenn das Ganze lediglich ein Energieproblem wäre – warum betrifft es dann auch den Akku meines Notebooks? Oder den des Handys? Warum funktioniert selbst die Ölheizung nicht?
Als wir auf der Straße ankamen, wo sich bereits Dutzende von Leuten tummelten und angeregt diskutierten, gesellte sich meinem Fragenkatalog ein weiterer Eintrag hinzu. Wieso, um alles in der Welt, fuhr kein einziges Auto die Straße entlang?
Einige Fahrzeuge standen mitten auf der Fahrbahn herum, als wären sie in ihrer letzten Bewegung eingefroren. Andere waren feinsäuberlich am Straßenrand geparkt worden, während ihre Besitzer ratlos vor der Motorhaube standen und sich keinen Reim darauf machen konnten, wieso die gottverdammte Schrottmühle plötzlich nicht mehr anspringt.
Es gab ja auch wirklich keinen vernünftigen Grund für die kollektive Funktionsuntüchtigkeit – die Außentemperatur musste um die 3 Grad plus betragen, eine kältebedingte Ursache schied somit aus.
Nach mehreren Anläufen traf ich endlich auf einen älteren Herrn, der mir dank einer ebenso alten Schweizer Taschenuhr, welche einwandfrei funktionierte, die genaue Uhrzeit verraten konnte. 10.38 Uhr! Verflixt noch mal, das war wirklich spät!
Mein schlechtes Gewissen befahl mir, auf der Stelle zur Behörde zu fahren. Auch wenn mir mittlerweile klar war, dass ich ganz bestimmt nicht die Einzige wäre, die heute zu spät einträfe. Besonders die vielen Kollegen von auswärts dürften erhebliche Schwierigkeiten gehabt haben, pünktlich bis nach Bayreuth zum Arbeitsplatz zu gelangen, überlegte ich mir.
Oder war das Problem rein auf das Stadtgebiet begrenzt? Ich würde es sicher herausfinden, sobald ich mir dort im Amt ein Bild gemacht und mit Kollegen gesprochen hätte. Das war der Plan, den ich umzusetzen gedachte.
Tief in Gedanken versunken erreichte ich den Parkplatz meiner Wohnanlage, wo mein »schöner Autowagen«, wie ich den uralten Opel Corsa liebevoll nenne, wie eh und je in Parkbucht Nr. 7 stand und auf mich wartete.
Dieses Auto und ich, wir beide haben schon so einiges mitgemacht. Deshalb hätte es mich auch kaum gewundert, wenn dieses treue Fahrzeug allen Umständen zum Trotz angesprungen wäre. Probieren musste ich es einfach, auch wenn mein Nachbar lächelnd den Kopf schüttelte und mit verschränkten Armen neben dem Fahrzeug auf das mutmaßlich enttäuschende Ergebnis meiner Bemühungen wartete.
Der Corsa gab erwartungsgemäß keinen einzigen Ton von sich, als hätte ich den Zündschlüssel überhaupt nicht umgedreht. Die gesamte Elektrik schien kaputt zu sein, denn auch die batteriebetriebenen Geräte ließen sich nicht aktivieren. Weder das Licht, noch das Radio. Ich streichelte meinem vierrädrigen Begleiter bedauernd über das Lenkrad und gab auf. Zum Glück hatte ich noch ein altes Fahrrad im Keller stehen; dieses musste heute nach längerer Zeit mal wieder zum Einsatz kommen.
Nachdem ich die platten Reifen des Drahtesels aufgepumpt und den Sattel vom Staub befreit hatte, fiel mir ein, dass ich Fahrradfahren im Winter eigentlich hasse wie die Pest. Die Hände werden trotz dicker Handschuhe immer eiskalt, und der Fahrtwind schneidet einem unangenehm ins Gesicht, während man unter seinen dicken Pullovern wegen der ungewohnten Anstrengung schwitzt. Aber heute Vormittag blieb mir nach Lage der Dinge keine andere Wahl.
Ich glaube, ich unterbreche meine Doku an dieser Stelle erst einmal. Ich bekomme nämlich langsam Hunger.
*
Himmel, ist das öde! Weil auch die Straßenbeleuchtung nicht funktioniert, ist die ganze Stadt dunkel wie ein Bären-A…! Ich musste mir eine dicke Stumpen-Kerze anzünden, um überhaupt zu Kühlschrank und Toilette zu finden. Das Ganze hier ist eine kranke Mischung aus Zeltlager-Romantik, Polarcamp und Endzeit-Szenario. Mittlerweile werden mir wegen der ungemütlichen Kälte in dieser Wohnung auch noch die Finger klamm; ich schreibe besser weiter, bevor überhaupt nichts mehr geht. Wie gerne würde ich jetzt träge mit einer Tüte Chips auf der Couch liegen und die Spätnachrichten gucken!
Weiter im Text! Ich fuhr also mit dem Fahrrad hinüber zum Rathaus. Das sind bloß so um die drei Kilometer, aber mir untrainierten Wesen setzte schon diese Strecke ganz schön zu. An jeder noch so kleinen Steigung trat ich keuchend in die Pedale, während das Fahrrad quietschte, knarzte und klapperte. Das werde ich unbedingt mit Kettenfett und Öl behandeln müssen, falls mein Auto weiterhin streikt.
Normalerweise ist unser mickriger Bediensteten-Parkplatz derart mit Fahrzeugen vollgestopft, dass sich einige der spät eintreffenden Kollegen verbotswidrig irgendwo an den Rand quetschen müssen. Heute jedoch radelte ich an einer restlos leergefegten Asphalt-Wüste vorbei.
Daraus schloss ich, dass das Ereignis – welches auch immer – wohl in der Zeit zwischen 5 Uhr und 7 Uhr stattgefunden haben musste. Um 5 Uhr hatten laut Ecki nämlich die Autos noch ganz normal funktioniert, und schon um 7 Uhr wären hier an einem gewöhnlichen Werktag bereits die ersten Kollegen eingetroffen; was jedoch angesichts des komplett verwaisten Parkplatzes zweifellos nicht der Fall gewesen war.
Fahrräder waren hingegen in ungewohnter Anzahl vor der Glas-Eingangstür des Rathauses abgestellt. Die zugehörigen Kollegen entdeckte ich nur einen Augenblick später, denn sie saßen allesamt diskutierend und gestikulierend in der Lobby vor dem Bürgerinformations-Schalter.
Offensichtlich war niemand zur normalen Verrichtung des Dienstes nach oben in sein Zimmer gegangen, und wozu auch? Ohne Computerdaten und Telefon konnte man dem Bürger schließlich eher schlecht weiterhelfen. Wobei auch der Bürger heute ganz bestimmt andere Probleme haben mochte, als ausgerechnet einen Antrag beim Amt stellen zu wollen.
Ich wurde mit so großem Hallo begrüßt, als hätten mich die anwesenden Mitarbeiter der Stadtverwaltung nicht erst gestern gesehen. Man freute sich offensichtlich über jeden Kollegen, der es überhaupt bis zum Rathaus schaffte.
»Bisschen spät, hä?«, neckte mich Alexandra, meine langjährige Kollegin, mit der ich auch außerdienstlich befreundet bin. »Aber keine Angst, das merkt keiner – die Stempeluhr funktioniert natürlich auch nicht!«, grinste sie verschmitzt.
Üblicherweise sitzen hier unten in der Lobby einzelne Bürger, die auf ihre antragstellenden Angehörigen warten. Mütter mit sperrigen Kinderwagen, oder am monatlichen Auszahl-Tag diejenigen Bezieher von Hartz IV oder Grundsicherung, welche über kein Bankkonto verfügen und die Stütze in bar abholen.
Heute jedoch waren alle Polsterstühle besetzt, und der überzählige Rest der Belegschaft hatte sich im Schneidersitz auf dem Fußboden niedergelassen. Schon wieder fühlte ich mich optisch unwillkürlich an eine Art Winter-Biwak erinnert, weil alle Kollegen so dick eingepackt waren. Fast schien es, als müsse gleich jemand seine Gitarre hervorholen, um die üblichen öden Zeltlager-Songs zu klimpern.
Ich setzte mich neben Alexandra nieder, ließ meinen Blick über die Anwesenden schweifen und fragte: »Sag mal, kommt mir das nur so vor, oder ist hier kaum einer von den Chefs anwesend?«
Alex nickte bestätigend und meinte: »Na ja, das kommt davon, dass die viel mehr verdienen als wir Fußvolk. Die wohnen nicht in der Innenstadt, sondern haben alle außerhalb gebaut. Wo sie jetzt schön festsitzen, weil ihre dicken Autos genauso wenig funktionieren wie unsere alten Rostlauben!«
Wir mussten beide herzhaft lachen. Wenn ich mir den einen oder anderen fetten Herrn im Anzug vorstellte, wie er ratlos seine Glatze kratzend vor dem nagelneuen 7er BMW stand, konnte ich die Sache vorübergehend tatsächlich sogar mit Humor betrachten. Aber ich wurde trotzdem gleich wieder ernst; schließlich war ich unter anderem hierher geradelt, um endlich zu erfahren, was diesen Ausnahmezustand verursacht haben könnte.
Mit etwas erhobener Stimme fragte ich die um mich herum sitzenden Kollegen, ob man denn schon herausgefunden oder wenigstens eine brauchbare Theorie habe, wieso in dieser Stadt seit den frühen Morgenstunden alles zum Erliegen gekommen sei. Die einen schüttelten den Kopf, die anderen nickten eifrig, bevor sie sich wieder ihren jeweiligen Gesprächspartnern widmeten.
»Wie jetzt?«, fragte ich wegen dieser widersprüchlichen Auskünfte Alexandra. Die holte tief Luft und erzählte, dass seit Stunden die abenteuerlichsten Spekulationen durchdacht und widerlegt worden seien. Von Terroranschlag bis Angriff aus dem Weltall sei alles erörtert und auch wieder verworfen worden, bis nur noch eine einzige logische Erklärung übrig geblieben sei: diejenige, dass sich ein EMP ereignet haben könnte, was im Übrigen die Abkürzung für »Electromagnetic Pulse« sei.
»Ich weiß ziemlich genau, was das ist!«, unterbrach ich ungeduldig ihre Ausführungen. »Schließlich habe ich auch regelmäßig die Nachrichten verfolgt. Seit Monaten befürchten die Experten schon Stromausfälle wegen der stark erhöhten SonnenfleckenAktivität, so wie damals im März 1989 in Quebec, als es unter anderem einen Mega-Blackout gab. Aber haben die Wissenschaftler nicht gesagt, das Schlimmste sei vorüber, die Intensität der Sonnenstürme nehme bereits wieder ab?«
Alexandra nickte nachdenklich. »Stimmt! Aber dann haben sie sich eben getäuscht, denke ich mal. Das Beste kommt halt oft erst zum Schluss, nicht wahr? Und dieses Mal hat es nicht Quebec erwischt, sondern Oberfranken!«
Zu meiner Linken saß Peter, den ich schon seit einer kleinen Ewigkeit kannte. Der quirlige Beamte hatte dereinst im selben Jahr bei der Stadtverwaltung seinen Dienst angetreten wie ich.
»Was du sagst, das könnte schon richtig sein!«, warf er in Alexandras Richtung ein. »Bloß wissen wir nicht, ob das Phänomen wirklich örtlich begrenzt ist! Und die Misere ist heute mit Sicherheit weitaus schlimmer als damals in Quebec, wo außer diesem größeren Stromausfall und ein paar sonstigen Störungen nichts Schlimmes passiert ist.
Denk doch mal nach! 1989 war noch nicht jedes Auto und nicht jedes Elektrogerät mit empfindlichen Computer-Chips ausgerüstet, da konnte gar nicht so viel kaputt gehen wie heutzutage! Oder was glaubt ihr, weshalb aktuell so gut wie gar nichts mehr funktioniert? Alles durchgeschmort, das sage ich euch schon jetzt!«
Diese frustrierende Annahme war tatsächlich berechtigt. Wir analysierten hier nüchtern katastrophale naturwissenschaftliche Vorgänge und waren uns zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht darüber im Klaren, dass wir im Grunde von einem möglichen Ende der Zivilisation sprachen, so wie wir sie bis zu diesem Tag kannten. Erst später, als ich längst wieder alleine in meiner ausgekühlten Wohnung saß, wurde mir das in Ansätzen bewusst. Aber zurück zu unserem außergewöhnlichen Lobby-Sit-In.
Alexandra ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, behielt ihren kühlen Kopf. »Ist ja alles gut und schön, Leute! Aber bislang sind das alles nicht mehr und nicht weniger als blanke Vermutungen, richtig?«
Peter nickte. »Richtig! Doch bald wissen wir mehr. Unser Hausmeister ist nämlich gerade auf dem Weg zur Garage eines Freundes, wo er seinen geliebten 1968er Mustang eingestellt hat. Falls der problemlos anspringen sollte, dürfte sofort alles glasklar sein!«
»Weil da drin wegen des frühen Baujahrs noch kein einziger Chip eingebaut ist, oder?«, dachte ich laut nach.
»Ganz genau!«, bestätigte Peter und warf nervös einen Blick aus der Eingangs-Glastür, ob dort nicht vielleicht schon eine chromglänzende Stoßstange zu sehen wäre.
Wer immer diesen Text eines Tages eventuell lesen mag – wissen Sie was? Ich unterbreche jetzt doch und gehe erst einmal ins Bett. Mir ist kalt, meine Füße fühlen sich wie erstarrte Eisklumpen an. Die rechte Hand samt zugehörigem Gelenk schmerzt ziemlich, außerdem erkenne ich die Buchstaben nur noch verschwommen; es sieht für meine überanstrengten Augen aus, als würden sie sich wie eine Ameisenkolonne über das Papier bewegen. Gute Nacht, bis morgen!
Falls es ein »morgen« überhaupt noch geben wird. In der absoluten Dunkelheit beschleichen einen die abstrusesten Ängste, das dürfen Sie mir ruhig glauben.
Schönen Valentinstag, Gabi!
*
Ich bin heute schon wieder erst aufgewacht, als es draußen längst hell geworden war. Im Grunde macht das nichts aus, weil man ja sowieso nicht früher nach draußen gehen könnte. Wenn man die Hand vor Augen nicht sieht, ist es viel zu gefährlich, auch nur einen Fuß vor die Wohnungstür zu setzen. Dennoch besitze ich eingeschliffene Gewohnheiten und ein fast übermächtiges Pflichtgefühl, welches mir wider alle Logik ein schlechtes Gewissen impliziert.
Obwohl ich unter normalen Umständen also schon seit bestimmt zwei Stunden ordentlich im Amt an meinem Arbeitsplatz sitzen müsste, befinde ich mich zu Hause bei 5 Grad plus am Schreibtisch, um wenigstens den gestrigen Tag fertig zu dokumentieren. Mit einer Decke um die Schultern und fingerlosen Handschuhen, die meinen klammen Händen wenigstens ein wenig Wärme spenden sollen.
Die eisige Raumtemperatur desillusionierte mich gleich nach dem Aufwachen gründlich, hatte ich mir doch vor dem Einschlafen noch ganz fest gewünscht, dass heute alles wieder seinen normalen Gang gehen solle. Doch das wird womöglich nie mehr der Fall sein.
Nach wie vor gibt es weder Strom noch Heizung, in allen Straßen herrscht gespenstische Stille. Wir wurden von einem Augenblick zum anderen zurück in die Steinzeit katapultiert, und noch immer weiß niemand in meiner Umgebung sicher zu sagen, wie dieses katastrophale Ereignis überhaupt seinen Lauf nehmen konnte. Innerhalb weniger Sekunden war die gewohnte Ordnung aus den Fugen geraten.
Als gestern der Hausmeister mit seinem 1968er Mustang tatsächlich nach einer Weile des angespannten Wartens vor dem Rathaus angeröhrt kam, sahen wir unsere vor allem durch Peter favorisierte Theorie bestätigt. Die Anzeichen, dass sich mit ziemlicher Sicherheit ein »EMP« ereignet haben musste, waren vollzählig und unübersehbar vorhanden.
Das, was Ecki als »komische Lichter« bezeichnet hatte, war wohl die typische Leuchterscheinung gewesen, die beim Auftreffen geladener Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre entsteht. Dort werden Luftmoleküle zum Leuchten gebracht, so dass sich irisierende Schleier aus farbigem Licht über den Nachthimmel bewegen.
Normalerweise irrlichtern diese Phänomene hauptsächlich in den Polarregionen über den Horizont, doch in den frühen Morgenstunden des 14. Februar 2020 waren sie auch über unserer nordbayerischen Stadt Bayreuth deutlich zu sehen gewesen.
Ecki hatte also vollkommen richtig beobachtet, jedoch mithilfe seiner kruden Gedankenwelt viel zu abenteuerliche Schlüsse aus seiner Sichtung gezogen.
Klar – alle, die wir uns hier die Köpfe heiß redeten, waren von Beruf Verwaltungsangestellte oder Beamte, nicht etwa eine Horde hochintelligenter Physik-Genies. Trotzdem fühlten wir uns hinreichend davon überzeugt, die richtigen Schlüsse gezogen zu haben.
Hausmeister Klaus öffnete die Motorhaube des Mustangs für uns, um stolz zu demonstrieren, inwiefern sich sein schnittiger Oldtimer von unseren modernen, jedoch leider neuerdings fahruntüchtigen Autos unterscheidet.
Okay, die elektronischen Bauteile waren definitiv das Problem! Nur wussten wir aufgrund dieser Erkenntnis immer noch nicht, ob der Schaden räumlich begrenzt ist, und auch am heutigen Tag werden wir dieses Rätsel wohl nicht lösen können. Wie sollten wir das auch anstellen, woher die Informationen beziehen? Wenn einem weder Internet, noch Fernsehen, noch Radio zur Verfügung stehen, dann erfährt man nur das, was sich direkt vor der eigenen Nase ereignet.
Peter warf noch einen neuen Aspekt in die Diskussionsrunde, über den wir bisher noch gar nicht nachgedacht hatten. Ein zerstörerischer EMP kann nämlich nicht nur durch natürliche Sonnenstürme ausgelöst werden, sondern beispielsweise auch durch eine von Menschen zu Kriegszwecken gefertigte EMP-Bombe. Die Technologie hierzu existiert heute bereits, und wenn solche Waffen den falschen Gruppierungen in die Hände fallen, dann scheint nahezu alles denkbar.
»Das Kernprinzip von solchen Bomben besteht darin, durch eine Explosion ein elektromagnetisches Feld blitzartig zu komprimieren. Dabei verwandelt sich eine Menge mechanischer Explosionsenergie in elektromagnetische Energie, die von der Bombe dann als elektromagnetischer Impuls freigesetzt wird«, meinte Peter mit vielsagendem Blick.
»Ist doch jetzt völlig egal, wir sollten uns lieber darum kümmern, wie wir ohne all die technischen Hilfsmittel überleben können! Wenn ein EMP die Ursache ist – ob nun durch die Sonne oder Terroristen ausgelöst – können wir schließlich nicht damit rechnen, dass sich die entstandenen Schäden in absehbarer Zeit beheben lassen.
Wo bekommen wir bitteschön Nahrungsmittel her, wenn die Supermärkte nicht öffnen? Wir haben Februar, da entfällt das Beerensammeln!«, bemerkte Alexandra mit reichlich Sarkasmus in der Stimme.
Zustimmendes Gemurmel wurde laut, denn spätestens in zwei Wochen würde nahezu niemand mehr etwas Genießbares im Kühlschrank liegen haben. Wenige Wochen später wären auch bei strenger Rationierung alle haltbaren Vorräte aufgegessen, nicht jeder besitzt heutzutage eine Speisekammer mit Dosen und Einmachgläsern im Überfluss. Auch ich nicht, meine winzige Küche lässt kaum Lagerhaltung zu. Bis auf ein paar Packungen Spaghetti, einige Gläser selbstgemachter Marmelade von Oma und eine Batterie billiger Dosensuppen ist da nichts Essbares aufzufinden.
Manch einer hatte sich mit diesem höchst beängstigenden Gedanken an eine drohende Hungersnot offensichtlich bereits auseinandergesetzt, andere Kollegen guckten nach Alexandras Einwurf reichlich erschrocken und ängstlich aus der Wäsche.
Wir mussten den Versuch einer Problemlösung auf den nächsten Tag verlegen, denn die beginnende Abenddämmerung erinnerte uns unbarmherzig daran, dass es schon bald stockdunkel sein würde und wir dann womöglich nicht mehr in der Lage wären, zurück in unsere ungemütlichen Wohnungen zu finden. So, das war der Rest meiner Dokumentation von gestern! Was würde ich in dieser Kälte nicht alles für eine schöne Tasse heißen Kaffee geben! Jetzt radle ich wieder hinüber zum Rathaus, um zusammen mit meinen Kollegen brauchbare Strategien für die nahe Zukunft auszubaldowern.
Strategien für den Worst Case, für das nackte Überleben.
*
Samstag, 15. Februar 2020
Als ich heute gegen Mittag keuchend vor dem Rathaus eintraf, kamen mir bereits einige Kollegen auf dem Gehweg entgegen.
»Pass auf, ist glatt heute!«, warnte mich fürsorglich ein Kollege aus dem Steueramt.
»Habe ich bereits gemerkt!«, grummelte ich düster. Schließlich tat mir alles weh, weil ich wegen des Glatteises zweimal gestürzt war. Zum Glück waren die Stürze glimpflich verlaufen, außer blauen Flecken würde ich nichts zurückbehalten. Streufahrzeuge waren natürlich ebenso außer Betrieb wie alles andere, daran hatte ich beim Losfahren gar nicht gedacht.
»Stell dein Fahrrad ab, wir laufen gleich los. Schließ dich bitte einer der Gruppen an!«, rief mir Peter zu, der sich anscheinend selbst zu einer Art Anführer ernannt hatte. Ich war wegen der Fertigstellung meiner Dokumentation des gestrigen Tages wohl wieder recht spät dran und hatte einiges verpasst.
Aus einer der fünf Grüppchen löste sich Alexandra, bewegte sich auf dem glatten Gehweg vorsichtig auf mich zu. »Komm, du kannst mit uns gehen! Wir sind die Lebensmittel-Task Force!«
»Die was?«, fragte ich erstaunt. Klar konnte ich mir denken, welchen Auftrag Alexandras Gruppe erhalten hatte. Aber musste immer sofort alles unbedingt einen militärischen Anstrich erhalten, sobald sich Katastrophen ereigneten?
Alex klärte mich auf. Man habe vorhin einhellig beschlossen, dass Herumsitzen und Diskutieren jetzt nicht mehr weiterhelfe. Die Zeit des Handelns sei gekommen. Nur in der Gemeinschaft hätte man eine reelle Chance, Einzelkämpfer würden in dieser veränderten Welt schon bald an ihre Grenzen stoßen.
Man müsse aber unverzüglich damit beginnen, sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen, sonst hätte man schnell das Nachsehen. Schließlich seien sehr viele Leute mit demselben Problem konfrontiert, was unter Garantie nach dem ersten Schreck erbitterte Kämpfe um die wenigen, noch zur Verfügung stehenden Ressourcen bedeute.
Deswegen seien vorhin fünf Gruppen gebildet worden, welche allesamt mit unterschiedlichen Aufträgen versorgt seien.
Ich persönlich mochte eigentlich nicht glauben, dass kultivierte Menschen sich wirklich auf der Stelle alle zu rücksichtslosen und gewalttätigen Egoisten zurückentwickeln könnten, sah jedoch ein, dass man sich um die vordringlichen Bedürfnisse kümmern musste. Beamte planen halt gerne, das gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit.
So schloss ich mich freiwillig dieser Gruppe 1, der so genannten »Lebensmittel-Task Force« an. Schon um für mich selbst herauszufinden, wie ich – beziehungsweise wir – die dringend benötigten Lebensmittel für die nächsten Tage auftreiben können. Gruppe 2 würde als »Mobilitäts-Task Force« nachsehen, ob es außer dem 1968er Mustang von Hausmeister Klaus in der Stadt noch andere Fahrzeuge gibt, die anspringen. Ein Kollege wusste beispielsweise von einem Oldtimer-Club und ein paar weitläufig Bekannten, die sehr alte Fahrzeuge besitzen. Aber sind die auch fahrbereit? Und was ist mit Traktoren oder Fahrzeugen von Polizei oder Bundeswehr?
Außerdem würde man Benzin, Öl und Diesel benötigen, um die wenigen fahrbaren Untersätze überhaupt benutzen zu können. Wenn die Pumpen in den Tankstellen auch nicht funktionieren, womit sicher zu rechnen ist, dann muss man wohl früher oder später Treibstoff aus den gefüllten Tanks von nicht mehr fahrbereiten Autos ablassen und sich ein Lager anlegen. Dumm nur, dass die meisten Fahrzeuge seit einigen Jahren mit Elektromotoren ausgerüstet sind.
Hausmeister Klaus gedachte mit der dritten Gruppe, der »Informations-Task Force«, so weit wie möglich aus der Stadt hinaus zu fahren und nachzusehen, ob der EMP örtlich eng begrenzt ist. Vielleicht hätte ja Kulmbach Strom, Nürnberg oder Hof? In diesem Fall könnten wir uns alle dorthin begeben und abwarten, bis auch in Bayreuth langsam wieder die Normalität einkehren würde. Notfalls zu Fuß.
Auf ihrer Reise sollen nebenbei möglichst viele Leute befragt werden, ob sie über weitreichendere Informationen verfügen als wir. Womöglich existieren gute Ideen, wie man mit der Krise umgehen kann, auf die wir bisher noch nicht gekommen sind.
Wenn schon das World Wide Web zumindest temporär nicht mehr existiert, dann muss eine andere Art von Informations-Netzwerk aufgebaut werden. Ein persönliches, von Mensch zu Mensch. Die vierte Gruppe rund um Peter würde sich vorrangig um folgende Fragen kümmern: Könnten wir irgendwo zusammen kampieren, damit nicht jeder zurück in seine kalte Wohnung muss? Wie gelingt es, eine Wärmequelle zu schaffen und adäquate Möglichkeiten für die Körperhygiene zu finden, ohne sich mit eiskaltem Wasser waschen zu müssen?
Was ist mit Medikamenten, die wir früher oder später sicher benötigen werden? Welche mechanischen Geräte funktionieren noch, so dass wir wenigstens ein paar Hilfsmittel für das tägliche Leben verwenden können? Peter bezeichnet diese Task Force mit den Begriffen »Gebrauchsgegenstände und Hygiene«.
Spätestens dann, wenn unsere Gemeinschaft eines Tages gut funktionieren wird und über Hilfsmittel und Lebensmittel verfügt, die andere nicht besitzen, wird es gefährlich. Da sind wir uns ausnahmsweise alle einig!
Es wird todsicher eigennützige Leute geben, die uns diese lebensnotwendigen Schätze wieder entreißen wollen, auch unter Gewaltanwendung. Also müssen wir uns mithilfe der Task Force 5 (Verteidigung) unbedingt um den eigenen Schutz kümmern, sei es durch einfache Waffen, sei es durch Verstecke oder Zäune. Mal sehen, was die zuständige Gruppierung sich hierzu ausdenken wird. Ich nahm mir schon mal vor, über Steinschleuderbau nachzudenken und fühlte mich in die Kindheit zurückversetzt. Im Grunde proben die Kinder dieser Welt spielerisch den Ernstfall, indem sie Verstecke anlegen, Kirschen in Nachbars Garten klauen und sich Pfeil und Bogen selber basteln. Wir Erwachsenen müssen all das erst wieder mühsam lernen. Nur mit dem Unterschied, dass unsere Geschicklichkeit letzten Endes wohl über Gedeih und Verderb entscheiden wird. Kein schöner Gedanke.
Irgendwie ist es schon albern: Eine Horde von degenerierten Rathaus-Bediensteten zieht aus, um das Überleben zu lernen, anstatt dem berüchtigten Beamten-Dreikampf zu frönen oder Beamten-Mikado zu spielen, ha ha.
Plötzlich ist nicht mehr der Dienstgrad entscheidend, um herauszufinden, wer der Boss ist; im Augenblick füllt diese Rolle Peter aus, einfach weil er die größte Klappe besitzt und auf ein breit gefächertes Allgemeinwissen zurückgreifen kann.
Hausmeister Klaus ist immens wichtig, weil er die Schlüssel zum Rathaus besitzt und das einzige fahrbereite Auto sein eigen nennt. Außerdem lagert in seinem dienstlichen Fundus jegliches Werkzeug, das man sich nur vorstellen kann. Vieles davon funktioniert auch ohne Strom, kann uns somit noch sehr nützlich werden.
Wenn ich dran denke, dass Letzterer früher immer heimlich ausgelacht wurde, weil er stundenlang mit einem Laub-Föhn unterwegs war und der Herbstwind seine Bemühungen binnen Sekunden wieder zunichte machte … So einige Kollegen vertrieben sich früher gerne die dienstliche Langeweile mit diesem Anblick. Eine gewisse Situationskomik ist unbestreitbar vorhanden, auch wenn die Lage in Wirklichkeit sehr ernst ist.
So! Jetzt brauche ich schon wieder Teelichter, um weiterschreiben zu können. Lange werden sie nicht mehr reichen, dann ist es vorbei mit meinen nächtlichen Aktivitäten.
*
Wir zählen 8 Personen in unserer neu gegründeten LebensmittelTask Force. Neben Alexandra und mir gingen heute Morgen zwei Kollegen aus dem Versicherungsamt sowie vier aus dem Sozialamt auf die Suche nach etwas Essbarem. Anfangs bewegten wir uns sehr vorsichtig über die glatten Gehsteige, wenig später kam die Sonne hervor und taute den eisigen Überzug auf, so dass wir weitaus schneller vorankamen.
Auf dem Weg in die Innenstadt schmiedeten wir einen groben Plan, wie wir der Reihe nach vorgehen würden. Zunächst zählte jeder den Geldbetrag in bar, welchen er bei sich trug. Falls irgendwo wider Erwarten ein Geschäft geöffnet wäre, wollten wir als erste Maßnahme ganz normal haltbare Lebensmittel einkaufen gehen, vorrangig selbstverständlich Konserven.
Schon nach wenigen Metern wurde es unübersehbar, dass sich seit gestern bereits so einiges verändert haben musste. Neben den überall nutzlos herumstehenden Autos waren erste Spuren der Verwüstung sichtbar.
Was ich eigentlich nicht für möglich gehalten hatte, war wohl längst zur bitteren Realität geworden. Es musste da draußen schon heute am zweiten Tag der Krise Menschen geben, die sich um Gesetz und Ordnung keine Gedanken mehr machten und für sich selbst zusammenrafften, was immer sie zwischen die Finger bekommen konnten.
Der erste Supermarkt einer kleinen regionalen Kette kam in Sicht. Selbstverständlich war mangels Beleuchtung hinter den mit Werbung plakatierten Schaufensterscheiben nichts als Dunkelheit zu erkennen. Dennoch zwang uns ein törichtes Fünkchen Hoffnung, bis zur Glas-Eingangstür zu gehen und nachzusehen, ob sie nicht doch zu öffnen ginge.
Natürlich war das nicht der Fall. Wir liefen um das Gebäude herum bis zur rückwärtigen Metalltür des Warenlagers, weil wir hofften, dort vielleicht Personal anzutreffen, welches uns unkonventionell ein paar Lebensmittel hätte verkaufen können.
Offensichtlich waren wir aber zu spät gekommen, jemand musste dem Anschein nach bereits hier gewesen sein. Die schnell verderblichen Lebensmittel aus den Eistruhen und Kühlregalen waren in und neben den Müllcontainern entsorgt worden.
»Nehmen wir uns doch einfach von hier etwas mit!«, schlug Alexandra spontan vor und begutachtete schon einmal die traurige Ansammlung von Joghurtbechern und aufgetauten Gemüsebeuteln, die neben den Müllcontainern aufgetürmt lagen.
Die anderen schüttelten entsetzt den Kopf. »Spinnst du? Was ist, wenn wir von diesem verdorbenen Gammel-Essen eine Lebensmittelvergiftung kriegen? Das Zeug riecht bereits streng, weil die Sonne voll draufscheint. Meinst du wirklich, die hätten etwas entsorgt, das noch essbar und damit verkäuflich gewesen wäre?«, fragte Selina und rümpfte angeekelt die Nase.
»Ach was, wir müssen einfach ein wenig wühlen und stöbern, es kann ja nicht alles gleichzeitig schlecht geworden sein! Schließlich haben wir Mitte Februar, da geht es nicht so schnell mit dem Schimmel und der Fäulnis«, konterte ich genervt. Alexandra und ich hätten nämlich überhaupt kein Problem damit gehabt, den Müllberg Stück für Stück zu untersuchen, um Brauchbares zu extrahieren.
Selina verschränkte trotzig die Arme. »Peter hat aber gesagt, wir müssen als Team arbeiten! Die Mehrheit von uns ist eindeutig dagegen, dass wir uns mit diesem dreckigen Müll aufhalten. Wir haben vorhin einstimmig beschlossen, zuerst nach geöffneten Märkten zu sehen, in denen man noch ganz normal gegen Bezahlung einkaufen kann. Schon vergessen?«
Das konnte ja heiter werden! Ich suchte Alexandras Blick und sah, dass sie die Augen nach oben verdrehte. Wir fragten uns wohl beide, ob ein gemeinsames Überleben mit solchermaßen anspruchsvollen und empfindlichen Mitstreitern überhaupt gelingen kann, oder ob die Mission zum Scheitern verurteilt ist. Zähneknirschend trotteten wir hinter unserer sogenannten Task Force her, die sich schon wieder in Bewegung gesetzt hatte.
Ich muss es kurz machen, denn mein Handgelenk schmerzt. Wenn ich zu lange schreibe, gibt das wahrscheinlich eine schöne Sehnenscheiden-Entzündung.
Warum soll ich auch ausführlich beschreiben, dass sich bei allen Supermärkten dasselbe frustrierende Bild bot?
Halt nein, um bei der Wahrheit zu bleiben: es waren zwei davon bereits aufgebrochen und restlos ausgeplündert worden. Aber das machte die Situation für uns auch nicht besser. Wir zählten uns nach wie vor zu den anständigen Menschen, die ihren Charakter und ihre Erziehung nicht bei der ersten Gelegenheit über Bord zu werfen gedachten. Unsere Reichweite war zudem begrenzt, wir konnten zu Fuß unmöglich alle Einkaufsmärkte der Stadt abklappern. Dafür wäre sogar eine Stadt wie Bayreuth zu weitläufig angelegt gewesen.
Zwei Dinge stellten wir außerdem an diesem Samstag fest: erstens formieren sich momentan Kräfte der Polizei und des Militärs, um eine gewisse öffentliche Ordnung zu gewährleisten. Sie tun sich nur ein wenig schwer damit, weil ja auch sie bei der Bewältigung ihrer Aufgabe auf technische Hilfsmittel und Fahrzeuge weitestgehend verzichten müssen.
Ein Soldat, den wir in der Innenstadt antrafen, sprach gar von einer geplanten Ausgangssperre und der baldigen Verhängung des Kriegsrechts. Man konnte ihm jedoch recht deutlich ansehen, dass er selber nicht wusste, wie dies de facto zu bewerkstelligen wäre. Zweitens hatte man im Hauptgebäude der Stadtverwaltung mittlerweile die städtische Großraum-Tiefgarage für die Allgemeinheit geöffnet, in welcher sich seit den 1970er Jahren auch ein großer Katastrophen-Luftschutzbunker befindet. Dort werden jetzt Decken und Lebensmittel für Bedürftige ausgegeben, so lange der Vorrat reicht. Auch könnte man dort Unterschlupf finden, falls man obdachlos ist.
Gut zu wissen, denn man kann derzeit schwer abschätzen, wie schlimm es noch kommen wird und ob die Krise zeitlich begrenzt ist. Wir haben auf unserem Weg so einige Polizisten und Soldaten befragt, keiner wusste uns das zu sagen; aber alle wirkten sie besorgt.
Wir kehrten heute Nachmittag also mit leeren Händen zu unserer Außenstelle des Rathauses zurück, bestiegen frustriert unsere Fahrräder und radelten zurück nach Hause. Jeder für sich alleine. Ich habe aufgrund der jüngsten Erfahrungen echte Angst vor der Zukunft bekommen.
*
Sonntag, 16. Februar 2020
Für den heutigen Tag haben wir abgemacht, dass sich die fünf Task Force-Gruppen an unserer Rathaus-Außenstelle treffen, um die jeweiligen Erkenntnisse vom gestrigen Einsatz auszutauschen und passende Schlüsse daraus zu ziehen. Schließlich ist der Sonntag aufgrund der schwierigen Umstände nicht länger als Arbeitstag tabu.
Unser Bericht für die Gruppe 1 wird wohl eher peinlich ausfallen, weil diese bislang so überhaupt nichts Sinnvolles in puncto Lebensmittelbeschaffung erreichen konnte. Mir steigt gleich wieder der Adrenalinspiegel, wenn ich an das zimperliche Verhalten meiner Kollegen von gestern denke. Na, die werden auch noch umdenken müssen!
Mich interessiert ganz besonders, was Klaus und seine Mitfahrer außerhalb der Stadt in Erfahrung bringen konnten. Außerdem werde ich vorher einen kleinen Umweg radeln und bei den Müllcontainern des Supermarktes stoppen, neben welchem gestern die aussortierten Lebensmittel deponiert waren. Ich habe nämlich meinen Küchenschrank durchsucht und hierbei festgestellt, dass meine Vorräte schon jetzt bedenklich zur Neige gehen.
Himmel noch mal, ein paar Kilo weniger auf den Hüften würden mir zwar bestimmt gut stehen! Aber Hungerattacken möchte ich trotzdem nicht erleiden müssen!
*
Heute sind deutlich weniger Kollegen hier am Rathaus eingetroffen, als an den vergangenen beiden Tagen. Ich denke, manche haben einfach noch nicht kapiert, dass unser bisheriges Leben dahin ist, wir uns vollkommen neu orientieren müssen. Diese allzu sorglosen Charaktere halten sogar eisern an ihrem arbeitsfreien Sonntag fest! Beamte sind eben naturgemäß oft starrsinnig und unflexibel.
Es wäre aber genauso denkbar, dass die ersten Mitstreiter erhebliche Zweifel an der Funktionsfähigkeit unserer AmtsGenossenschaft bekommen haben. So wie ich gestern auch.
Aber ich will von vorne beginnen! Ich radelte heute Morgen also als erstes hinunter zu dem kleinen Supermarkt, um ein paar der aussortierten Lebensmittel für mich zu ergattern. Schon von weitem sahen meine entsetzten Augen, dass der komplette Lebensmittel-Berg neben dem Müllcontainer bis auf das letzte Stück bereits abgetragen war.
Aktuell wühlten so vier bis sechs Personen hektisch im Container, um auch aus diesem noch alles herauszuholen, was brauchbar erschien. Es handelte sich dabei aber nicht etwa um zerlumpte Obdachlose, sondern um ganz normale, eher gut gekleidete Bürger.
Verflixt, da scheinen die ersten nach nicht einmal einer Woche schon Hunger zu leiden, was meine eigene Essensbeschaffung ab sofort extrem verkomplizieren wird; das ist mir bei diesem Anblick schmerzlich klar geworden. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich hasse es, wenn sich die abgedroschenen Phrasen meiner Mutter bewahrheiten!
Reichlich demotiviert und deprimiert traf ich anschließend bei meinen Leidensgenossen ein. Die diskutierten gerade darüber, weshalb eigentlich neuerdings ein solch penetranter Gestank über der Stadt liegt. Die Mülltonnen werden doch schließlich auch im Normalbetrieb nur alle 14 Tage geleert, ein Totalausfall der Müllabfuhr kann somit wohl kaum alleine der Grund für diese Geruchsbelästigung sein. Nicht im Februar.
Meiner miesen Stimmung gemäß warf ich einfach in äußerst sarkastischem Tonfall ein einziges Wort laut vernehmlich in die Runde: »Scheiße!«
Peter entglitt nachsichtig ein schwaches Lächeln. »Klar ist das eine ziemliche Scheiße! Aber trotzdem, wo kommt bitteschön dieser beißende Gestank her?«, versuchte er die Diskussion sachlich fortzusetzen und blickte fragend in die Runde.
Ich beharrte: »Sag ich doch gerade! Es ist Scheiße, die ihr hier riecht, jedenfalls hauptsächlich. Alles, was im Abwasserkanal halt so landet. Oder habt ihr etwa geglaubt, die Pumpen der Kläranlage würden nach dem Tag X noch funktionieren? Das riesige Klärbecken ist von hier aus … hm … nur so ungefähr zwei Kilometer weit entfernt!«
Damit war die Ursache hinreichend geklärt; gleichzeitig stand fest, dass wir mit dem Gestank weiterhin leben müssen und dass er sich vermutlich noch beträchtlich verstärken wird, sobald sich die Lufttemperatur im Frühjahr erhöht und zusätzlich der Inhalt der vollgestopften Bio-Mülltonnen kompostiert und unter ständiger Freisetzung von übelriechenden Gasen vor sich hin fault.
»Okay, dann wollen wir mal die Ergebnisse von gestern bekannt geben«, ging Peter nahtlos zur Tagesordnung über. Gleich zu Anfang musste ich für Gruppe 1 davon berichten, wie schwierig es in Zukunft wahrscheinlich werden wird, sich Lebensmittel zu besorgen. Dass es uns beim besten Willen nicht gelungen ist, entsprechende Möglichkeiten zu finden. Jedenfalls nicht, ohne Straftaten zu begehen.
»Genau das habe ich befürchtet!«, nickte Peter. »Da werden wir uns etwas anderes einfallen lassen müssen, wir diskutieren später noch drüber. Aber erst einmal wollen wir hören, was die anderen Gruppen erreichen konnten.«
Gruppe 2 war es gelungen, die Besitzer von drei weiteren Fahrzeugen zu finden, welche keinerlei Elektronik-Bauteile aufweisen und somit nach dem EMP noch fahrbereit sind. Man hatte sich darauf geeinigt, Gespräche über den sinnvollen Einsatz dieser alten Autos zu führen. Sie sollen künftig beispielsweise dann zum Einsatz kommen, wenn größere Gegenstände transportiert werden müssen oder längere Strecken zurückzulegen sind; Krankentransporte wären ebenso möglich wie gelegentliche Besorgungsfahrten auf dem Land.
Hausmeister Klaus hat überdies das Gespräch zweier Soldaten mitangehört, die sich eifrig darüber austauschten, dass die Bundeswehr zumindest über einzelne puristisch gebaute Jeeps verfügt, die einwandfrei funktionieren. Außerdem gedenkt man offensichtlich ausrangierte Museums-Panzer aus dem zweiten Weltkrieg zu reaktivieren, um die Straßen damit frei zu räumen. Schließlich blockieren überall noch die mitten in der Fahrt liegen gebliebenen Autos, Busse und Lastwagen die Zufahrtswege.
»Das ist doch schon mal besser als gar nichts!«, brummte Peter und bat Gruppe 3 um ihren Bericht. Klaus holte tief Luft und erzählte, wie er mit seinem Mustang auf verschiedenen Strecken versucht hatte, ohne Blechschaden aus der Stadt zu kommen, zunächst aber ohne Erfolg.
Viel zu viele aufgegebene Fahrzeuge stehen auf den Straßen herum und verhindern ein Durchkommen. Schweren Herzens musste Klaus deshalb seinen liebevoll restaurierten Mustang über unebene Feldwege holpern lassen, ansonsten hätte er die Mission von vorneherein abbrechen müssen.
Sie kamen nach einigen Umwegen und Irrfahrten durch den Wald bis nach Kulmbach und erfuhren in unserer Nachbarstadt im Grunde nicht mehr, als wir ohnehin schon wussten: Man geht auch dort von einem EMP aus, hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll und ob nur ein begrenztes Gebiet von den Auswirkungen betroffen ist. Kulmbach hat es jedenfalls auch erwischt.
»Na schön, dann müssen wir wohl geduldig abwarten, ob Informationen von weiter draußen irgendwann bis hierher durchdringen!«, resignierte Peter.
»Aber wenigstens habe ich gute Neuigkeiten für euch! Mit der Gruppe 4 habe ich ein paar nützliche Gegenstände aufgetrieben. Ihr müsstet euch nur schnell mit dem Gedanken anfreunden, dass wir künftig aus praktischen Gründen in einer Art Camp leben sollten, wo Privatsphäre nicht mehr allzu groß geschrieben wird!« Peter erklärte uns, dass Klaus morgen mit seinem Mustang eine ganze Menge an Ausrüstungsgegenständen abholen könne. Seine Schwester führe nämlich in Erlangen ein kleines Geschäft für Besucher von Mittelaltermärkten, die sich dort an der historischen Lebensweise orientieren, in einfachen Gewändern herumlaufen und ein paar vorsintflutliche Tage ohne technische Hilfsmittel verbringen wollen. Sie habe einfach alles im Angebot, was man für ein Überleben ohne Strom benötige. Weil ihr Ladengeschäft in Erlangen jedoch sehr klein sei, lagere sie zu unserem Glück vieles hier in Bayreuth in einer geräumigen Garage, welche einem gemeinsamen Freund gehöre.
»Nun ja, und dort bin ich vorhin zu Fuß mit der Gruppe 4 gewesen. Wir haben das Schloss aufgebrochen und neugierig nachgesehen, was das Lager an Brauchbarem enthält. Ich bin vollkommen sicher, dass meine Schwester hiermit einverstanden wäre, wenn sie davon wüsste. Bis nach Erlangen zu fahren, um sie vorher zu fragen, hätte sie uns sowieso nicht zugemutet. Neuerdings ist das eine halbe Weltreise!
Was soll ich euch sagen? Früher habe ich jeden belächelt, der freiwillig dieses archaisch anmutende Zeug benutzte; oft erzählte meine Schwester begeistert witzige Anekdoten. Zum Beispiel, wie sie sich während der Mittelalter-Camps im Wald selber Donnerbalken bauten und sich den Hintern mit Blättern säuberten. Ich hielt das für eine amüsante Vorstellung, wie sie da alle aufgereiht sitzen und ihr Geschäftchen erledigen.
Aber jetzt? Wir sind selber nicht mehr weit von solchen Handlungsweisen entfernt, nicht wahr?«, schmunzelte Peter.
Klaus meldete sich zu Wort. »Und was genau wäre da morgen abzuholen? Brauche ich den Hänger?«
»Kann nicht schaden!«, nickte Peter. »Wir holen uns einen riesigen Kochkessel samt dreibeiniger Aufhänge-Vorrichtung, Feuerkörbe, einen Badezuber nebst großen Holzeimern, zerlegbare Zelte und ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel wärmende Schaffelle.«
»Zelte und Badezuber? Wozu brauchen wir das denn, wir haben doch alle Wohnungen mit Badewannen? Und selbst wenn wir uns dazu entschließen sollten, hier in einer Gemeinschaft zu leben – ein festes Dach über dem Kopf, Teeküchen und ein bisschen Komfort hätten wir dann auf jeden Fall!«, warf die Vorzimmerdame des Steueramts verwundert ein. »Da müssen wir doch nicht leben wie unzivilisierte Wilde!«
Peter seufzte; er schätzt es nämlich überhaupt nicht, wenn jemand sich beharrlich weigert, selbst nachzudenken und das Offensichtliche zu erkennen. Er fügte sich ins Unvermeidliche und erklärte dieser und anderen verwöhnten Damen, dass sich die Situation schon bald erheblich zuspitzen werde, wenn der Kampf ums Überleben erst voll in Gang kommt.
Er kündigte an, dass seiner Ansicht nach die Straßen bereits in Kürze nicht mehr sicher betreten werden können. Dass die Anarchie Einzug halten wird, auch im sonst eher beschaulichen Bayreuth.
Einzelpersonen, die nicht über passende Ausrüstung verfügen, würden dann die ersten sein, welche in dieser rabiateren Gesellschaft über Bord gehen; daher müsse man vorausschauend planen. Selbstverständlich werde man versuchen, zunächst in festen Gebäuden Quartier zu beziehen. Falls es in der Stadt aber zu gefährlich werde, dann sei es schlauer, sich mitsamt den Zelten in die Wälder zu verfügen. Fast wie Robin Hood!«, fügte er augenzwinkernd hinzu.
Die Sekretärin sah betreten auf ihre lackierten Fingernägel und schwieg, mühsam die Tränen zurückhaltend. Ich glaube, am heutigen Sonntag haben manche erst begriffen, wie sehr dieser EMP ihr gewohnt behäbiges Leben umgekrempelt hat.
Auch ich stehe vor einem neuen Problem. Die letzten sechs meiner Teelichter sind fast komplett heruntergebrannt, schon flackern die winzigen Flämmchen im verzweifelten Versuch, nicht im restlichen Wachs zu ersticken. Ich werde morgen früh weiterschreiben müssen, wenn ich meine Augen nicht ruinieren will. Meine beiden dicken Stumpen-Kerzen benötige ich leider für andere Zwecke, zum Beispiel, wenn ich nachts aufstehen muss. Ich hatte nie Angst vor der Dunkelheit, auch als Kind nicht.
Aber verglichen mit heute erscheint mir der Gedanke an die Nächte vor dem EMP fast unwirklich, weil die Stadt auch nachts voller Licht und Leben gewesen war. Jetzt herrscht tiefste Finsternis, und mit ihr kommen lähmende Ängste hoch, die ich bisher nicht gekannt habe. Deshalb brauche ich die Gewissheit, Kerzen zur Hand zu haben, falls ich mich gar zu sehr ängstige.
Es ist schon merkwürdig, wie schnell der Mensch sich auf neue Gegebenheiten einstellen kann, wenn er dazu gezwungen ist. Mir kommt mein früheres bequemes Leben jetzt schon wie ein fadenscheinig gewordener Traum vor, wie ein romantisch verklärtes Fatum Morgana.
Hat sich dieser schicksalsträchtige EMP tatsächlich erst vor wenigen Tagen ereignet? Wir alle haben satt und dekadent in einer höchst fragilen, trügerischen Sicherheit gelebt, und haargenau das wird vielen von uns jetzt zum Verhängnis.
*
Bevor ich nachher wieder zum Rathaus hinüberradle, schreibe ich schnell noch kurz die restlichen Ergebnisse des gestrigen Tages auf. Es reicht, wenn ich dort erst nach der Rückkehr von Peter und Klaus eintreffe; vielleicht kann ich dann ein bisschen dabei helfen, die sperrigen mittelalterlichen Gebrauchsgegenstände aus dem Auto zu wuchten und im Foyer des Rathauses einzulagern. Wer hätte jemals daran gedacht, dass sich die Eingangshalle dieser Behörde eines Tages zur Kommandozentrale einer aus Kollegen wild zusammengewürfelten Überlebensgemeinschaft mausern wird?
Wir können wahrscheinlich sowieso von Glück reden, dass sich die hochdotierten Chefs eher beim Rathaus I in der Innenstadt blicken lassen, um sich ordentlich wichtig zu machen, anstatt hier in der Außenstelle aufzuschlagen. Deshalb kommt uns wenigstens niemand in die Quere, der etwas dagegen haben könnte, dass wir hier campieren oder behördenuntypische Dinge lagern wollen. Ich hoffe, dass dies weiterhin so bleiben wird.
Zum Frühstück gab es heute eine kleine Dose Champignons, geschnitten, III. Wahl. So steht es auf dem Etikett. Nie hätte ich diese Dinger normalerweise pur gegessen, doch vorhin habe ich sie in Windeseile gierig verputzt, einfach aus der Dose heraus.
Was gäbe ich jetzt für eine Tasse Kaffee und ein schönes Vollkorn-Brötchen mit Marmelade! Ich glaube, ich wiederhole mich; es ist einfach zum Auswachsen, nichts läuft mehr wie gewohnt!
Aber zurück zum gestrigen Tag. Im Laufe des Nachmittags fanden sich insgesamt vier hilfebedürftige Bürger ein, welche dumme Fragen stellten und ausgerechnet von uns eine Lösung ihrer vielfältigen Probleme erwarteten. Nun, denen konnten wir leider nicht weiterhelfen! Wir rieten ihnen allen, doch lieber beim Rathaus I vorbeizuschauen, wo ja auch die Notunterkunft nebst Verpflegung in der Tiefgarage zur Verfügung stehe. Wir sind schließlich selbst mit der Situation völlig überfordert, genau wie alle anderen Bürger dieser Stadt.
Ach ja, der Bericht der Task Force Nr. 5 steht noch aus! Diese Gruppe hatte den Auftrag, sich um die Sicherheitsfragen unserer Gemeinschaft zu kümmern. Da jedoch niemand außer Hausmeister Klaus über Schusswaffen oder auch nur einen Waffenschein verfügte, trieben sie lediglich zwei Gaspistolen zur Selbstverteidigung, einen Baseballschläger und drei Döschen Pfefferspray auf. Beamte sind in der Regel nun mal keine gewaltbereiten »Rambos«, sondern mehr oder weniger pazifistische Schreibtischtäter.
Peter versprach aufgrund dieser eher mageren Ausbeute, im Lager seiner Schwester zusätzlich nach Langbögen und Pfeilen zu sehen. Besser als gar nichts, auch wenn das uns Menschen des 21. Jahrhunderts schon reichlich albern anmutet.
Ich schwinge mich jetzt mal auf mein Fahrrad und sehe zu, was heute so geht.
*
Montag, 17. Februar 2020
Gleich zu Beginn möchte ich stolz anmerken, dass Peter mich vorhin ganz offiziell mit dem Niederschreiben unserer Geschichte betraut hat. Ich zeigte ihm diese Aufzeichnungen und er hat begeistert in der Runde daraus vorgelesen. Er verkündete im Anschluss daran, dass wir ab sofort eine frischgebackene ChronikSchreiberin unter uns hätten: meine Wenigkeit.
Das bedeutet, dass ich jetzt eine Art dienstlichen Auftrag zum Schreiben wahrnehme und sich deswegen künftig die Anderen darum kümmern werden, dass ich immer genügend Kerzen zur Verfügung habe, um auch nachts schreiben zu können. Hurra! Eine Sorge weniger.
Eine halbe Stunde später tauchte Klaus mit den Sachen aus dem Mittelalter-Lager auf. Die meisten Gegenstände sind aus Holz oder Gusseisen gearbeitet und wirken, als könnten sie selbst Jahrtausende mühelos überstehen. Als ich die ebenfalls mitgebrachten Schwerter sah, musste ich herzhaft lachen.
»WAS denn?«, grinste Peter schelmisch. »Das sind zwar bloß Schaukampf-Waffen, sie sind also kein bisschen scharf. Aber ein wenig Angst einflößen könnten sie eventuellen Angreifern durchaus, findet ihr nicht? Selbst wenn die Dinger recht stumpfe Klingen haben – über den Schädel gezogen bekommen möchte ich solch einen schmucken Zweihänder nicht unbedingt, ihr etwa?«
»Nö, nicht wirklich!«, bestätigte Alexandra und prüfte das Gewicht eines der Schwerter, indem sie es mit ausgestreckten Armen wie eine Kriegerprinzessin vor ihren Körper hielt. »Puh, ganz schön heftig! Wohin sollen wir die Sachen denn bringen? Gleich hierher in die Lobby?«
Peter überlegte angestrengt. »Nein, ich glaube, das wäre zu gefährlich! Wegen der riesigen Glasfront hier vorne, die es Einbrechern viel zu leicht macht. Was nützen einem die besten Waffen, wenn sie gleich jemand entwendet?
Ich bin davon überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die ersten Mitbürger Straftaten begehen, um sich oder ihren Familien das Überleben auf Kosten anderer Menschen zu sichern. Dann müssen wir mit allem rechnen.«
Noch während er sprach, kam Peter offenbar die zündende Idee. Er winkte Klaus zu sich und fragte, ob er über die Schlüssel zum Tresorraum verfüge. Dies ist ein großes Zimmer mit vergitterten Fenstern im Erdgeschoss, welches in Vor-EMP-Zeiten für Sozialhilfe-Auszahlungen in bar gedient hatte.
»Für den Raum ja, aber natürlich nicht für den Tresor! Den verwalten die Kollegen aus der Stadtkasse.« Klaus kramte den richtigen Schlüssel für das Sicherheitsschloss hervor und sperrte auf, deutete eine kleine Verbeugung an. »Bitte einzutreten!«
Ich staunte. Normalerweise kannte man Hausmeister Klaus im Dienst als bärbeißigen, meist schlecht gelaunten Haudegen, der einen grundsätzlich erst einmal anfrotzelte, sobald man auch nur eine Glühbirne ausgetauscht haben wollte. Seit Beginn der Krise jedoch lief er zur Höchstform auf, zeigte schwarzen Humor und packte bereitwillig an, wo immer man ihn gebrauchen konnte.
Vielleicht sind manche Menschen einfach nicht für ein eintöniges, ereignisloses Leben hinter dem Laub-Föhn zu gebrauchen. Erst unter Belastung zeigen sie ihren wahren Wert, ihre Begabung und Zähigkeit.
Wir schafften unser ungefragt ausgeliehenes Mittelalter-Equipment in den Tresorraum und sperrten diesen sorgfältig wieder ab. Alle hoffen wir inständig, die Sachen niemals benutzen zu müssen, sie in naher Zukunft scherzend zurück in die Garage von Peters Schwester verfrachten zu dürfen. Über unsere paar Tage in der Steinzeit später den Enkelkindern witzige Anekdoten erzählen zu können, wie wir uns damals voller Zukunftsangst vorsorglich auf Schlimmeres eingestellt hatten.
Doch die verzweifelte Hoffnung, dass es sich nur um eine kurzzeitige Unterbrechung des gewohnten Lebens handeln könnte, um ein bloßes Intermezzo mit überschaubaren Schäden, schwindet mit jeder vergehenden Stunde. Wir alle fühlen das, die zunehmende Resignation ist meinen Kollegen mühelos anzusehen. Manchen mehr, anderen weniger.
»So! Habt ihr auch solchen Kohldampf? Dann sollten wir uns jetzt lieber einmal um etwas zum Essen kümmern! Folgt mir!« Peter steuerte mit dynamischem Schritt die Treppe an, welche in die fünf oberen Stockwerke des Rathauses II führte. Klaus, der alleinige Hüter des Generalschlüssels, beeilte sich, um rasch zu ihm aufzuschließen.
Wir anderen folgten. Ich keuchte neben Alexandra die Treppe hoch, welche die ungewohnte Anstrengung ebenfalls sichtlich mitnahm. Normalerweise benutzten fast alle Bediensteten den altersschwachen Aufzug, falls es mehr als ein Stockwerk zu überwinden galt oder Aktenstapel zu schleppen waren.
»Ich glaube, ich kann mir denken, was er vorhat!«, sinnierte Alex außer Atem. »Er will bestimmt nachschauen, was in den Teeküchen noch so an brauchbaren Lebensmitteln lagert! Klaus kann ja alles aufsperren, und dann werden wir schon sehen, ob sich das Treppensteigen gelohnt hat.«
Wir erreichten den fünften Stock, in welchem in normalen Zeiten städtische Steuerangelegenheiten bearbeitet werden. Zu unserem Erstaunen strebte Peter aber nicht die Teeküche an, sondern das vorderste Zimmer in der langen Reihe von Türen. Klaus fragte nicht lang und schloss auf.
»Wie euch bekannt ist, sind die Zimmer alle durch nicht versperrte Zwischentüren verbunden. So können wir schnell und systematisch in sämtlichen Räumen nach Lebensmitteln suchen. Am besten, wir teilen uns in zwei Gruppen: die einen überprüfen die rechte Seite des Flurs, die anderen die linke.
Vergesst bitte nicht, sorgfältig in alle Schreibtischschubladen zu sehen, auch in den Einbauschränken könntet ihr fündig werden. Nicht jeder Kollege hat dort drinnen ausschließlich Akten verstaut«, grinste Peter vielsagend.
»Und schaut auch nach anderen brauchbaren Sachen, zum Beispiel nach Wasser in Flaschen, Kerzen, Streichhölzern oder mechanischen Feuerzeugen!«
Selina, die Sekretärin des Steueramts, stand mit verschränkten Armen und gerunzelter Stirn etwas abseits im Flur. Ihr war überdeutlich anzusehen, dass sie voller Verachtung für Peters Anregung steckte. Das ungefähr 1,60 m große Persönchen mit den dunklen, sorgfältig gestylten Locken wirkte in diesem Augenblick ein wenig wie ein furioser Giftzwerg.
»Nein, das werden wir ganz bestimmt nicht tun!« Sie versuchte nach Kräften, ihre hohe, piepsige Stimme etwas resoluter klingen zu lassen, ihr Nachdruck zu verleihen. »Ich gehe nicht an fremde Schreibtische, das wäre Diebstahl und ein Eingriff in die Privatsphäre des jeweiligen Zimmerinhabers!
Habt ihr denn schon jeden Anstand, eure gesamte Erziehung verloren? Wir sind doch keine Wilden!« Selinas dunkle Augen verschossen wütend Blitze in Peters Richtung.
Peter seufzte genervt, wandte sich dann Selina zu. »So! Jetzt hör mir mal genau zu! Ich habe Verständnis für deine Einwände, die für gewöhnlich auch ihre Berechtigung hätten. Egal, was du von mir denken magst: auch ich begehe im Normalfall keine Diebstähle. Aber das heute ist etwas komplett anderes, hier geht es ums Überleben, nebenbei auch um das deine. Dies hier sind außerdem in erster Linie Diensträume, keine Privatwohnungen! Wo sind sie denn abgeblieben, die geschätzten Herren und Damen Mitarbeiter, welche sonst in diesen Zimmern arbeiten? Wir sind gerade mal 18 Personen aus dem gesamten Rathaus II, die sich regelmäßig einfinden, wenn auch nicht zu den regulären Dienstzeiten. Die meisten der restlichen Kollegen haben sich alle seit dem EMP-Ereignis nicht mehr blicken lassen, als wären sie hier überhaupt nicht mehr beschäftigt.
Wären sie bei uns, dann würden wir die Lebensmittel, die wir hoffentlich finden werden, selbstverständlich auch mit ihnen teilen. Jedoch – angesichts dieses totalen Desinteresses für den Dienst sind sie selber schuld, wenn hinterher die geliebten Gummibärchen aus der Schublade verschwunden sind!«
Mit diesen sarkastischen Worten ließ er Selina einfach stehen und schickte sich an, das erste der insgesamt zwölf Zimmer dieses Stockwerks zu durchsuchen. »Wir treffen uns nachher mitsamt der Ausbeute in der Teeküche!« Selina blieb auf demselben Fleck wie angewurzelt stehen und schmollte trotzig.
Vielleicht sollte ich mich etwas kürzer fassen. Mir schmerzt schon wieder der halbe Arm wegen all der vielen Schreiberei von Hand. Sooft ich früher meinen Computer verwünscht habe, weil mir das ständige Starren auf den Bildschirm und die Beantwortung der vielen täglichen E-Mails gründlich missfielen, so sehr hätte ich mir inzwischen ein funktionstüchtiges Gerät sehnlich herbeigewünscht.
Schriebe ich jedoch meinem Arm zuliebe nicht alles so detailliert und langatmig nieder, dann würde später niemand mehr unsere Gedanken und Gefühle in dieser schwierigen Zeit nachvollziehen können.
Ich werde besser eine kurze Pause einlegen, um mich ein bisschen zu schonen.
*
Der Rest meines Berichtes von diesem frostigen Montag ist schnell erzählt. Wir fanden bei der Durchsuchung sämtlicher Diensträume und Teeküchen Unmengen an Süßigkeiten, einige Getränkekästen und mehrere Packungen H-Milch. Dazu Knäckebrot, ein bisschen Obst, Kaugummi und Müsliriegel.
In geräumigen Roll-Gitterboxen, die normalerweise für den Transport größerer Aktenmengen bereitstanden, transportierten wir diese Schätze während mehrerer Anläufe hinunter in den Tresorraum, der mittlerweile eher einem Warenlager glich. Die Anstrengung von jeweils sechs Männern war notwendig, die schweren Boxen über die Steintreppe nach unten zu bugsieren.
Eine dieser Gitterboxen enthielt aber keine Lebensmittel, sondern andere nützliche Gegenstände. Ich hatte bei meinem Rundgang durch die Zimmer schnell begeistert festgestellt, dass einige Kollegen sich die Amtsstunden offenbar mit ein wenig Romantik, einem Mindestmaß an Ambiente versüßt hatten; neben ganz profanen Teelichtern fanden sich viele mit Aroma, dazu Windlichter mit Stumpen-Kerzen darin. Mein nächtliches Schreiben war damit erst einmal gesichert.
Amüsiert registrierte ich, dass sich Hausmeister Klaus in einem nach seinem Glauben unbeobachteten Moment verstohlen ein Pornoheft unter die Jacke steckte. Ich kannte den Macho-Kollegen im zweiten Stock, aus dessen Einbauschrank es stammte, und wunderte mich daher über gar nichts. Wozu bezahlte Dienststunden doch für manche Leute so dienen – echt faszinierend! Zeige mir deinen Schreibtisch, und ich sage dir, wer du bist.
Da gibt es zum Beispiel eine erklärte Tierschützerin, die das ganze Zimmer mit putzigen Hundefotos dekoriert hat und Gummiknochen in der Schublade hortet, gleich neben ihrem Stempelkissen. Oder einen Reggae-Fan, dessen Zimmer vor Bob Marley-Andenken und Postkarten aus Jamaika nur so strotzt, um ein paar Beispiele zu nennen.
Mein eigener Schreibtisch nimmt sich da eher langweilig aus. Das einzig exotische, das er beherbergt, sind verschiedene Kaffeemischungen aus aller Welt, die ich mir bis einschließlich letzten Donnerstag mit meiner auf dem Fensterbrett geparkten Maschine je nach Lust und Laune zubereitete. Eine mir stets willkommene Abwechslung war das, zwischen der Erstellung von Bescheiden und Sprechstunden für den Bürger. Ein tolerierter Luxus, den ich mir täglich mehrmals gönnte.
Ach, wie gerne hätte ich mir heute eine kräftige HochlandMischung aus Südamerika aufgebrüht, diejenige mit der sagenhaften »Crema« obendrauf!
Wie auch immer, unser Fischzug war recht erfolgreich gewesen. Morgen werden wir wieder zusammenkommen, einige der Lebensmittel gemeinsam vertilgen und ernsthaft darüber sprechen, ob wir uns, gegebenenfalls mitsamt Ehepartnern und Kindern, wirklich auf Zeit in einer Art Rathaus-Camp zusammen schließen wollen, bis die Zeiten wieder besser werden. Da wird sich am morgigen Tag wohl die Spreu vom Weizen trennen. Nicht jeder ist geeignet, im Kollektiv zu leben.
Bin ich es überhaupt? Auf jeden Fall wäre ich bereit, etwas Neues auszuprobieren, mich auf das Abenteuer einzulassen.
*
Dienstag, 18. Februar 2020
Ich bin wütend. Stinksauer sogar! Der heutige Tag brachte nicht viel Gutes mit sich. Daher kann ich echt froh sein, dass er sich langsam, aber stetig dem Ende zuneigt.
Heute ist mir nämlich erst so richtig bewusst geworden, wie selbstsüchtig, dumm und oberflächlich der Mensch eigentlich ist, während er sich größenwahnsinnig für die Krone der Schöpfung hält. Sollte der EMP weltweit zugeschlagen haben, dann wird man ja sicherlich bald sehen, wie es um das souveräne Leben dieses arroganten Primaten in Zukunft bestellt sein wird.
Am besten wird sein, ich erzähle von vorne und der Reihe nach. Heute Vormittag wollte ich wie üblich mit dem Fahrrad zum Rathaus II hinüberfahren. Leider fiel mir in letzter Minute ein, dass ich Peter versprochen hatte, eines meiner Bücher mitzubringen. In diesem dicken Buch geht es um Sinn oder Unsinn von Überlebenstrainings, es enthält Tipps und Tricks zum Überleben in der freien Natur zu jeder Jahreszeit, und das nahezu ohne Ausrüstungsgegenstände. Jenes Buch hatte mir mein Ex-Freund Mark zum vorletzten Geburtstag geschenkt, weil er in einem Anflug von Optimismus glaubte, ich würde so eine Aktion an einem Wochenende mit ihm durchziehen wollen. Da war er allerdings auf dem Holzweg gewesen, wie bei so vielen Punkten in unsere Beziehung. Peter meinte gestern, wir könnten uns aus diesem Band sicher einiges an nützlichen Informationen herausziehen.
Genervt ließ ich mein bereits aus dem Keller hochgeschlepptes Fahrrad kurz neben der Haustüre stehen und stürmte die Treppe hoch; ich würde nicht lange brauchen, denn das Buch lag ja auf der kleinen Kommode neben der Wohnungstüre fix und fertig zum Mitnehmen bereit.
Ich hatte zu lange gebraucht! Als ich die Treppe wieder hinunter hastete, hörte ich das charakteristische Klappern der Schutzbleche meines Fahrrades, was unzweifelhaft bedeutete, dass jemand es bewegen musste. Und tatsächlich: ich erhaschte einen allerletzten Blick auf meinen treuen Drahtesel, der soeben mit einem Mann als Fahrer eilig auf die Straße und aus meinem Blickfeld gesteuert wurde.
Wie lange hatte ich das Fahrrad aus den Augen gelassen, zwei Minuten vielleicht? Einfach geklaut, mitten aus einer belebten Wohnsiedlung! Wütend und entmutigt setzte ich mich erst einmal auf das kleine Treppchen vor der Eingangstüre meines Wohnblocks, um mich selber zu bemitleiden. Jetzt war ich also auch noch zur Fußgängerin wider Willen geworden. Kein Strom, keine Heizung, kein Essen, kein fahrbarer Untersatz. Ich würde zum Rathaus hinüberlaufen müssen und entsprechend lange für die Strecke brauchen. Mist, elender!
Als ich gerade aufstehen wollte, um mich unter gedachten Verwünschungen des rücksichtslosen Diebes in mein Schicksal zu ergeben und mich auf den Weg zu machen, kam mein Nachbar Ecki atemlos die Treppe heruntergehastet.
»Gabi, schnell! Du musst mitkommen, mit der Martha stimmt was nicht!« Er packte mich an der Hand und zerrte mich ins Haus, direkt in »Hartzer-Marthas« Wohnung. Schon beim Eintreten fiel mir der leicht süßliche, ekelhafte Geruch auf. Mir schwante Schlimmes.
»Da hinten liegt sie, ich trau mich gar nicht hinzugehen!«, jammerte Ecki und knibbelte nervös an seinen Fingern herum.
»Ich weiß ja nicht, was mir ihr los ist! Da wollte ich lieber keinen Fehler machen, mit erster Hilfe und ähnlichem Zeug habe ich nichts am Hut!«
Ich verdrehte die Augen. War ja wieder klar, dass solch eine undankbare Aufgabe jetzt ausgerechnet an mir hängen blieb! Martha rührte sich kein bisschen, und ich bahnte mir meinen Weg durch die in ihrer Wohnung durchaus übliche Unordnung, bis ich schließlich vor der fettleibigen, bläulich-blassen Frau stand, die einen üblen Geruch verströmte.
Ich überwand mühsam meinen Ekel und berührte Martha an jener Stelle, an welcher die Halsschlagader eigentlich spürbar pochen sollte. Die Haut fühlte sich wächsern und kühl an. Außerdem sah ich, dass Martha wohl beim Fallen mit dem Hinterkopf gegen die Tischkante geknallt sein musste, denn das Haar war mit Blut verklebt. Nichts, kein Lebenszeichen!
Tapfer kämpfte ich gegen die aufsteigende Übelkeit an. Ich bat den hibbeligen Ecki, nach einem kleinen Spiegel oder etwas anderem mit glänzender Oberfläche zu sehen und mir den Gegenstand zu bringen. In Filmen hatte ich oft gesehen, dass man mithilfe von Taschenspiegeln herausfinden konnte, ob bei Opfern von Unfällen oder Verbrechen vielleicht noch eine schwache Atmung vorhanden wäre.
Ecki nahte nach einer gefühlten Ewigkeit tatsächlich mit einem kleinen, verdreckten Spiegel, den ich zunächst angeekelt mit einem Zipfel von Marthas Tischtuch notdürftig säubern musste. Danach hielt ich ihn möglichst dicht vor Mund und Nase der Frau, um herauszufinden, ob er wegen Atemluft beschlagen würde. Doch nach wenigen Sekunden wurde mir klar, dass dies nicht der Fall war. »Sie ist tot!«, bestätigte ich Ecki.
Der geriet völlig aus dem Häuschen. »Aber wieso? Hat sie jemand umgebracht? Wir müssen sofort die Polizei holen und den Krankenwagen, jemand muss sie abtransportieren! Ich kann doch nicht mit einer Leiche im selben Haus wohnen!« Ecki hyperventilierte, wirkte total panisch. In seinem unkoordinierten
Bewegungsdrang sah er ein bisschen aus wie eine moderne Version des Rumpelstilzchens.
In diesem Moment verlor ich vollends die Kontrolle über meine Magenfunktionen, ein wohlbekannter Geschmack stieg mir von der Speiseröhre in den Mund. Hektisch hüpfte ich über Marthas Unordnung, um mich im Badezimmer schleunigst zu übergeben.
»Komm, ich muss jetzt ganz schnell hier raus!« Dieses Mal packte ich Ecki an der Hand, zerrte ihn aus der Wohnung und die Treppe hinunter, bis wir draußen auf dem Parkplatz standen. Ich musste mich erst einmal hinsetzen, denn meine Knie zitterten, der Kreislauf begann zu streiken. Ecki hingegen lief mit gerunzelter Stirn im Kreis herum und ich fragte mich ernsthaft, ob sich sein Gehirn nun womöglich endgültig in den gnädigen Wahnsinn verabschiedet hatte.
Langsam und vorsichtig stellte ich mich wieder auf meine wackeligen Beine, packte den rasenden Ecki resolut an beiden Oberarmen, um ihn auszubremsen.
»Jetzt beruhigst du dich erst einmal und hörst mir zu! Also: du kannst deine abgefahrenen Mord-Theorien, Strahlenangriffe von Außerirdischen oder sonstigen Ideen gleich wieder wegpacken!
So wie es aussieht, ist Martha einfach unglücklich hingefallen, hat sich hierbei an der Ecke des Couchtisches ein Loch im Kopf zugezogen. Bestimmt war sie schwach, ihr Kreislauf könnte plötzlich zusammengebrochen sein. Kennst sie doch, die hatte bestimmt nicht viele Lebensmittel im Haushalt auf Vorrat, und seit Freitag gibt es schließlich nichts mehr zu kaufen. Sehr organisiert oder einfallsreich war sie noch nie, unsere Frau Nachbarin.
Na ja, sie hat viel Blut verloren, lag da bewusstlos in ihrer Wohnung. Vermutlich ist sie gar nicht wieder aufgewacht und vielleicht an Austrocknung gestorben, was weiß ich, bin ja auch keine Medizinerin! Aber wir können weder Polizei noch Krankenwagen holen. Hast du etwa schon wieder vergessen, dass kein System mehr funktioniert?«
Ecki sah durch mich hindurch, als wären meine Worte bei ihm gar nicht bis ins Bewusstsein vorgedrungen. Wahrscheinlich stand er unter Schock, war durchgedreht, oder sogar beides auf einmal. Verdammt, was sollte ich jetzt bloß machen? Das Fahrrad war geklaut, ich fühlte mich schwach auf den Beinen, wir hatten eine Leiche im Haus liegen und Nachbar Eckerts Verstand hatte sich in eine abstruse Parallelwelt verflüchtigt. Ein bisschen viel für einen einzelnen Vormittag, auch wenn man hart im Nehmen ist! Ein lautes metallisches Schleifgeräusch, untermalt von Poltern und dem ohrenbetäubenden Röhren eines Motors, riss mich aus meinen düsteren Überlegungen. Ich ließ Ecki an Ort und Stelle stehen, schleppte meinen ausgelaugten Körper über den Parkplatz der Wohnanlage zur Straße, welche das städtische Klinikum mit einer breiten Ringstraße verband. Was war jetzt wieder Neues im Gange?
Der Anblick, welcher sich mir bot, hätte locker aus einem Endzeit-Movie stammen können. Ein vorsintflutlicher Panzer schepperte röhrend im strahlenden Sonnenschein langsam die Fahrbahn entlang und schob hierbei alles zu Blechknäueln zusammen, was ihm im Wege stand. Am Fahrbahnrad türmten sich deformierte Autos, nur die Einfahrten wurden frei gehalten. Auch wenn die Szenerie unwirklich und beängstigend anmutete: wir wurde schlagartig klar, dass diese Aktion des Militärs auch ihre Vorteile haben konnte! Klaus wird mit seinem Mustang nun viel problemloser überall durchfahren können, und das ist sehr gut. Vielleicht kann er dann auch Marthas Leiche abtransportieren, oder die Polizei wird es tun, oder … ich eilte zurück zu Ecki, um ihm die freudige Nachricht zu überbringen. Doch der verrückte Ecki war spurlos verschwunden, auch in seiner Wohnung konnte ich ihn nicht auftreiben.
Als ich sinnierend vor seiner verschlossenen Wohnungstüre stand, fiel mir siedend heiß eine grobe Ungereimtheit auf. Wieso war eigentlich Marthas Wohnungstür offen gestanden, warum hatte Ecki überhaupt Zugang zur Wohnung gehabt und die Frau da drin auffinden können? Vom Treppenhaus aus hätte man sie in all der Unordnung auch gar nicht entdeckt!
Ich konnte mich nicht erinnern, dass Ecki jemals irgendetwas mit Martha zu tun gehabt hatte, denn die beiden pflegten stets bloß mit abschätzigen, teilweise vermutlich frei erfundenen Geschichten über einander herzuziehen. Die ASO-Tante und der UFO-Freak. Es mutet höchst unwahrscheinlich an, dass Ecki seine soziale Ader entdeckt und sich für Marthas Wohlbefinden interessiert haben könnte. Und jemand, der bewusstlos ist, öffnet schließlich keine Wohnungstüren.
Mich beschlich ein schrecklicher Verdacht! Konnte es nicht ebenso gut möglich sein, dass der hungrige Ecki von Martha Lebensmittel abstauben wollte, die beiden darüber in Streit gerieten und Handgreiflichkeiten zu Marthas Sturz führten? Sie musste ihn selbst in die Wohnung gelassen haben, da bestand für mich kein Zweifel.
Ecki hatte mir vor Monaten einmal erzählt, er sei aufgrund von »Missverständnissen« schon zweimal wegen schwerer Körperverletzung angezeigt worden. Ich hatte damals still in mich hineingelacht und mir bildhaft vorgestellt, dass er wahrscheinlich seine Opfer für Außerirdische gehalten haben mochte und die Faustschläge für notwendig hielt, um die Welt vor einer Invasion zu retten. Bei Ecki wusste man außerdem nie, welche Geschichten ins Reich der Fantasie gehörten.
Aber jetzt, nach Marthas mysteriösem Tod, sah ich Eckis Verhalten in einem etwas anderen Licht. Zumal er sich sang und klanglos in einem unbeobachteten Moment einfach abgesetzt hatte.
Ich beschloss, endlich zum Rathaus hinüber zu wandern. Vielleicht konnte ich mit Peter oder Alexandra über die Sache sprechen. Auch um sicherzugehen, dass ich aufgrund meines überreizten Gefühlslebens keine Fehlschlüsse aus dem Erlebten zog. Seit die Welt aus den Fugen geraten war, konnte mir die permanente Überforderung ziemlich zusetzten und seltsame Denk-Effekte auslösen.