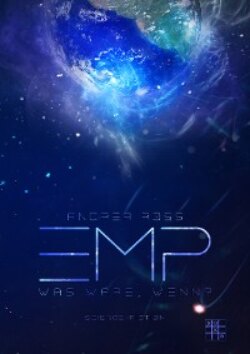Читать книгу EMP - Andrea Ross - Страница 8
ОглавлениеEine Entscheidung hatte mir der wahnsinnige Ecki jedoch bereits dankenswerterweise abgenommen: ich würde nun auf jeden Fall am Rathaus-Camp teilnehmen. Die Aussicht, mit einer Leiche und einem mutmaßlich verrückten Mörder im Haus zu leben, erschien mir wenig attraktiv.
Nach einer kleinen Pause geht es weiter! Ich packe jetzt meine Sachen für morgen zusammen; meinen Schlafsack, den Inhalt meiner Hausapotheke, ein paar Klamotten und sonstige persönlichen Gegenstände. Wenn es erst noch dunkler in der Wohnung wird, ist das Auffinden der Sachen sicher nicht mehr so einfach. Außerdem werde ich die Eingangstür verbarrikadieren. Wegen Ecki, dem ich vorsichtshalber nicht mehr über den Weg traue. Falls er es wirklich getan hat, könnte er mich als Zeugin ebenfalls beseitigen wollen. Man weiß nie, was in einem kranken Gehirn wie dem seinen so vorgeht, nicht wahr?
*
Als ich nach meinem anstrengenden Fußmarsch beim Rathaus ankam, fiel mir sofort auf, dass es dort viel zu ruhig war. Kein Mensch saß in der Lobby, die Glastür hatte man versperrt. War ich zu spät eingetroffen, hatte sich die Versammlung bereits aufgelöst? Schon bahnte sich wieder bitteres Selbstmitleid seinen Weg durch mein arg strapaziertes Gehirn. Was für ein mieser Tag!
»Gabi? Komm, hier sind wir!«, hörte ich Alexandras Stimme. Sie kam über den mit Raureif überzogenen Rasen gelaufen, was seltsame Raschel-Geräusche verursachte. Sie nickte mir zu und signalisierte, ich solle ihr bitte folgen.
Wir bogen soeben um die Hausecke, als mir Brandgeruch in die Nase stieg. »Ist eisig kalt heute! Da haben wir uns gedacht, ein Feuer könnte bestimmt nicht schaden!«, erklärte Alexandra lächelnd. »Wo hast du denn heute dein Fahrrad gelassen?«
»Ist eine lange Geschichte!«, knurrte ich. »Die erzähle ich dir nachher, wenn ich mich ein bisschen ausgeruht und beruhigt habe.«
Meine Kollegin Alexandra zeichnet es von jeher aus, dass sie jede Menge Taktgefühl besitzt, immer die richtige Dosis von Distanz und Nähe findet. Sie spürt, wann man lieber nicht reden möchte, oder wann man für Scherze, Anregungen oder Zuspruch empfänglich ist. Niemals drängt sie sich auf, und niemals nervt sie einen im falschen Moment. Deswegen mag ich sie auch so gut leiden, suche oft ihre Nähe.
Auch in diesem Moment akzeptierte sie auf Anhieb, dass ich momentan keine weiteren Informationen von mir geben möchte. Sie legte mir nur die Hand auf die Schulter und schob mich in die Richtung von Walters Terrasse, um welche wir anderen Bediensteten ihn stets beneidet hatten.
Das Rathaus II ist eigentlich ein früheres Schwestern-Wohnheim, denn es befindet sich auf dem Gelände eines ehemaligen Krankenhaus-Komplexes, der aufgegeben wurde, als das neue hochmoderne Klinikum an anderer Stelle in Betrieb ging. Seither sind in den alten Gebäuden auf dem weitläufigen Park-Gelände diverse Behörden, unter anderem auch die Außenstelle des Rathauses, untergebracht.
Oft haben wir uns darüber aufgeregt, dass man uns in dieses etwas heruntergekommene, teilweise nur notdürftig renovierte Schwestern-Wohnheim gesteckt hat. Andererseits bringt das aber auch Vorteile mit sich, welche die Kollegen in der Innenstadt nicht genießen können.
So verfügt beispielsweise jedes Zimmer über ein eigenes Waschbecken und jedes Stockwerk über einen geräumigen Balkon, auf den man sich zum Rauchen zurückziehen kann. Einem großen Eckzimmer im Erdgeschoss, welches zum Versicherungsamt gehört, ist sogar eine breite Terrasse angegliedert.
Blickdichte Büsche umrahmen diese mit Waschbetonplatten gepflasterte Außenfläche. Genau deswegen wurde sie in der Vergangenheit gerne für Sektempfänge genutzt, wenn Kollegen ihren Geburtstag feierten oder einen der Chef einfach zwischendurch nicht finden sollte. Zimmerinhaber Walter stellte »seine« Terrasse dann stets großzügig zur Verfügung und rauchte selber gerne mal ein Zigarillo an der frischen Luft.
Auf eben dieser Terrasse war nun ein Feuerkorb aufgestellt worden, der neben ergiebigen Rauchschwaden auch heimelige Wärme verströmte. Ich zählte 14 Kollegen und Kolleginnen, die munter plaudernd drum herum standen und sich die Hände wärmten. Auch eine Schnapsflasche machte die Runde, weshalb ich mich unwillkürlich an eine Horde von Wermut-Brüdern erinnert fühlte, die rund um eine brennende Penner-Tonne steht und ausgiebig ihrem Alkoholismus frönt.
»Auch mal? Wärmt schön durch!« Walter Zimmerer kam mit der Pulle auf mich zu, wollte sie mir in die Hand drücken.
Ich schüttelte den Kopf. »Nee, lieber nicht. Mein Kreislauf ist nämlich ein bisschen schwach, weil ich nichts im Magen habe. Da käme Alkohol jetzt nicht so gut, fürchte ich!«
»Sag das doch gleich!« Alex verschwand in Walters Zimmer, kam kurz darauf mit zwei Müsli-Riegeln und einer Packung Gummi-Erdbeeren zurück.
»Wir haben auch schon was gegessen, du bist bloß zu spät aufgetaucht!«, lachte sie. »Wirst sehen, das hilft, es wird dir gleich besser gehen! Und dann würde ich an deiner Stelle sehen, dass du doch noch ein Schlückchen vom Wodka abbekommst. Das hilft echt gut gegen die saumäßige Kälte!«
Ich musste mich krampfhaft bemühen, nicht alles einfach hinunterzuschlingen, sondern langsam und mit Bedacht zu essen. Hatte ich denn jemals so etwas Leckeres verspeist, war es wirklich erst wenige Tage her, dass solche Genüsse ganz einfach und jederzeit zu haben waren? Wieder befiel mich ein Gefühl der Unwirklichkeit, als würde ich all das nur träumen.
Langsam kehrten meine Lebensgeister zurück, ich fühlte mich besser und nach einigen Schlucken Alkohol auch leichter, unbelasteter. Das seltsame Beamten-Biwak machte fast schon Spaß, ich lebte im Augenblick und genoss die Sonne und die trockene Wärme des lodernden Feuers.
Später sprach ich noch mit Peter und Alexandra über meine Erlebnisse vom Vormittag. Beide teilten meine Bedenken und Vermutungen über Ecki, hielten diesen Zeitgenossen wegen einer sehr wahrscheinlichen Geisteskrankheit für unberechenbar und gefährlich. So kamen wir schnell überein, dass ich schon morgen mit Sack und Pack im Rathaus-Camp einziehen sollte.
Außer mir hatten sich elf weitere Kollegen zu diesem Schritt entschlossen, drei davon würden Familienmitglieder mitbringen. Alle anderen wollten versuchen, sich selber durchzuschlagen und würden zu unseren Treffen somit wohl nicht wiederkommen. Unter ihnen ist auch die überempfindliche Selina, welche nach ihrer Scheidung alleine in einer schicken Penthaus-Wohnung lebt. Ihr räume ich kaum Überlebens-Chancen ein, das muss ich ehrlich zugeben.
Ich werde also heute Nacht, bevor ich zu Bett gehe, alle Rollläden herunterlassen, die Möbel mit Betttüchern abdecken und meine paar Habseligkeiten bereitstellen, um morgen meine Wohnung auf unbestimmte Zeit zu verlassen.
All meine Erinnerungen an ein bequemeres Leben, die vielen Fotoalben mit Urlaubsbildern, die technischen Geräte und Sammlerstücke werde ich zurücklassen müssen. All das, was mir früher so wichtig und wertvoll erschienen ist, hat momentan keinen praktischen Nutzen mehr für mich, wird mir beim Überleben nicht helfen können. Schade, aber nicht zu ändern.
Wird die Wohnung unangetastet bleiben oder bald schon skrupellosen Plünderern zum Opfer fallen? Ich weiß es nicht, doch mir bleibt ohnehin keine Wahl. Es handelt sich ja nur um Gegenstände. Sollte die Krise jemals enden, dann kaufe ich mir einfach alles neu. Viel schöner als vorher. Mit diesem tröstlichen Gedanken beende ich für heute meine Aufzeichnungen.
*
Mittwoch, 19. Februar 2020
Beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten kann es bestimmt auch nicht anstrengender zugegangen sein. Heute habe ich nämlich meine Wohnung sorgfältig abgesperrt und die notwendigsten Habseligkeiten in einem großen Trekking-Rucksack und zwei zusätzlichen Taschen hinüber zum Rathaus II geschleppt.
Wie schwer einem diese paar Kilogramm doch vorkommen können, wenn man sie erst einmal eine Dreiviertelstunde lang auf den Schultern trägt! Ich bin so etwas nicht gewohnt. Bisher habe ich natürlich stets das Auto benutzt, sobald irgendetwas Schweres transportiert werden musste.
Die körperliche Anstrengung war das Eine. Die andere, weitaus schlimmere Neuerung schien mir jedoch das Gefühl einer nagenden Unsicherheit zu sein.
In den Blicken vieler Menschen hat sich seit vergangener Woche spürbar etwas verändert, ist eine schier unheimliche Transformation vonstatten gegangen. Misstrauen und Gier ist in den rot geränderten Augen zu lesen, was mich doch ziemlich ängstigt. Manch einer schien bei meinem Anblick zu überlegen, ob ich in meinen Behältnissen etwas von Interesse mit mir führen könnte, was einen spontanen Überfall rechtfertigen würde.
Nein, ich habe mich heute nicht wohl in meiner Haut gefühlt! Falls jemand über mich hergefallen wäre, was hätte ich dagegen schon ausrichten können?
Erleichtert ließ ich meine Taschen nach der zum Glück sicheren Ankunft im Rathaus II fallen, erhielt zur Stärkung gleich einen Apfel und ein Glas Milch von Peter in die Hand gedrückt. Er sah mir wohl an, in welch desolatem Zustand ich mich befand. Im Gegenzug wühlte ich die verbliebenen Lebensmittel aus dem Rucksack, die ich von zu Hause mitgebracht hatte. Ein Glas Marmelade, ein Glas Senf, Teebeutel, Mehl, Zucker und mehrere Packungen Spaghetti, welche ich in den vergangenen Tagen im Küchenschrank oft sehnsüchtig anschmachtete, jedoch nicht hatte zubereiten können. Wie auch, ohne heißes Wasser, ohne Kochgelegenheit? Hier liegen die Dinge anders, wir verfügen über eine Feuerstelle, über Töpfe und Kessel.
Peter zeigte mir dann »mein« Zimmer im ersten Stock. Jeder Camp-Einwohner erhielt zum Schlafen ein eigenes Zimmer zugeteilt, nur Kinder teilen sich eines zu mehreren oder werden bei den Eltern einquartiert. Peter meinte, das Haus weiter oben zu besiedeln, sei Blödsinn – man müsse dann jedes Mal die Treppen überwinden. Deswegen habe er nicht »mein« angestammtes dienstliches Zimmer für mich reserviert, sondern dieses hier.
Da hat er Recht, ohne Aufzug sind hoch gelegene Stockwerke nun einmal schwer zu erreichen. Ich warf also meinen Schlafsack auf den hässlich abgenutzten Teppichboden, stellte meine Kosmetikartikel auf den Waschbeckenrand und verstaute die Klamotten im Schrank. Den Rest meiner Sachen beließ ich in den Taschen, stellte diese nur unten in den Einbauschrank.
Den Schreibtisch rutschte ich mit Peters Hilfe unters Fenster, damit ich als Chronik-Schreiberin das Tageslicht möglichst lange zum Arbeiten nutzen konnte. Kerzen hatte er auch bereits für mich reserviert, lud sie allesamt vor mir auf dem Tisch ab.
Das war sie also, meine neue Heimat! Ein mickriges Zimmer in der »Kriegsopferfürsorgestelle«. So vertraut mir die Diensträume als jahrelanger Arbeitsplatz bei der Stadt hätten sein sollen, so fremdartig fühlten sie sich als Wohngelegenheit an. Es ist eben wirklich alles eine Sache der Einstellung, des Blickwinkels und der damit verbundenen subjektiven Wahrnehmung.
»Herzlich willkommen, fühl dich wie zu Hause!«, bemerkte Peter mit ein bisschen Ironie in der Stimme. »Wir sind übereingekommen, die Zimmer nicht abzusperren, auch nachts nicht. Man kennt und vertraut sich ja untereinander, nicht wahr?
Außerhalb der Schlafenszeiten halten wir uns meist unten in der Lobby auf, oder aber draußen am Feuerkorb, wo wir auch zusammen kochen werden. Du kannst dich selbstverständlich zum Schreiben zurückziehen, wann immer du willst. Ansonsten werden wir alles gemeinsam tun, ob wir nun essen, beraten, uns schützen oder was immer zukünftig so anfallen wird. Bist du einverstanden?«
Ich nickte. »Klar, klingt ja auch vernünftig! Aber heute muss ich dringend noch einen letzten Alleingang machen. Ich möchte nachsehen, wie es meinen Eltern geht, ob sie einigermaßen klarkommen und noch etwas zum Essen haben. Heute Abend bin ich wieder da!«
Peter runzelte die Stirn. »Du willst alleine durch die Stadt laufen? Das ist eigentlich überhaupt nicht mehr ratsam. Mir sind schon merkwürdige Elemente da draußen begegnet, welche die Zivilisation und ihre Regeln bereits abgelegt zu haben scheinen. Die Straßen werden zunehmend gefährlich, weißt du?«
»Habe ich vorhin schon selber gemerkt!«, bestätigte ich und fand den Gedanken, einsam und alleine zur Wohnung meiner Eltern zu wandern, selber nicht mehr sehr geheuer. »Ich werde Alexandra fragen, ob sie nicht mitkommen und mich begleiten möchte!«
»Prima Idee! Hättest du vorher gerne eine Tasse Kaffee? Über dem Feuer köchelt zufällig gerade eine ganze Kanne davon!«, verriet Peter grinsend. Er kannte meine Vorliebe für dieses belebende Getränk in all seinen Variationen.
Und ob ich wollte! Dankbar nahm ich unten auf der Terrasse meine Tasse entgegen und hielt sie wie einen Schatz fest umklammert, wärmte mir nebenbei daran die Hände. Ganz sicher handelte es sich hier nicht um die besten Bohnen weltweit, die für diesen Kaffee verarbeitet worden waren; mir dünkte diese erste Tasse seit Tagen jedoch trotzdem wie ein ausgewähltes Geschenk des Himmels.
In kleinen, bewusst genossenen Schlucken nahm ich das Heißgetränk wie in einem feierlichen Ritual zu mir; ich fühlte, wie es mich belebte. Wie oft hatte ich im Dienst meinen edlen Kaffee einfach so nebenbei in mich hineinkonsumiert, ohne dem Geschmack jedes einzelnen Tropfens auf meiner Zunge nachzuspüren! Man weiß eben oft erst, was die Dinge einem wert sind, wenn man sie verloren hat.
Alexandra, diese gute Haut! Sie sagte sofort zu, dass sie mich gerne begleiten werde, kaum dass ich meine Frage gestellt hatte. Peter stattete uns beide vorsichtshalber noch mit einer Dose Pfefferspray aus, dann machten wir uns gleich auf den Weg. Bei Einbruch der Dunkelheit wollten wir aus Sicherheitsgründen schließlich spätestens zurück sein, und zu Fuß scheinen sich selbst verhältnismäßig kurze Strecken schier endlos hinzuziehen. Jetzt gehe ich hinunter zum Abendessen, weiterschreiben kann ich nachher immer noch. Ich bin schon sehr gespannt, was die Jungs im großen Hängekessel so zubereitet haben, es riecht auf dem Flur jedenfalls schwer nach Eintopf!
*
Es gab vorhin wirklich Eintopf, meine Nase hat mich nicht getrogen! Walter und Wolfgang rührten mit behäbigen Bewegungen im großen »Druidenkessel«, wie ich den schmiedeeisernen Giganten, welcher an einer standfesten dreibeinigen Vorrichtung mittels einer dicken Kette befestigt ist, künftig nennen werde. Das Ding erinnert mich nämlich extrem an den Kessel des gallischen Druiden Miraculix, oft und gerne habe ich die Comic-Abenteuer von Asterix und Obelix gelesen. Genau wie fast jede Person, die ich kenne.
In diesem Kessel brodelte jedoch kein Zaubertrank, vielmehr köchelte da ein dickflüssiger, sämiger Eintopf aus Kartoffeln, Fleischstücken und verschiedenen Gemüsesorten lecker duftend vor sich hin. Erst der unverhoffte Kaffee, und jetzt das! Ich beglückwünschte mich innerlich ausgiebig zu meiner klugen Entscheidung, hierher zu ziehen. Diese kulinarischen Highlights hätte ich sonst unweigerlich verpasst. Es mussten anscheinend auch andere Mitbewohner ihre allerletzten Vorräte von zu Hause mitgebracht und zur Verfügung gestellt haben.
Seit sich dieser für die Technik so destruktive EMP ereignet hat, habe ich sowieso den Eindruck, als hätten in mein vorher recht eintöniges Leben mehr Kontraste, mehr Höhen und Tiefen Einzug gehalten.
Innerhalb dieser wenigen Stunden, die seither vergangen sind, war ich wechselweise mit Hunger, Angst, Freude, Genuss, totaler Erschöpfung und Kameradschaftsgeist konfrontiert worden. Allesamt starke Emotionen und Erlebnisse, die zuvor in meinem Leben ziemlich unterrepräsentiert gewesen waren, oder zumindest im Alltag bei weitem nicht so intensiv ausfielen. Die Bandbreite des bewussten Erlebens hat sich für mich irgendwie erweitert, ich fühle neuerdings den aufregenden Puls des Lebens. Im Positiven wie im Negativen.
Schon seltsam, aber dieser Aspekt der Katastrophe beginnt bereits, mir zu gefallen. Ganz schön abgefahren, sich solche Gedanken in einem beginnenden Desaster zu machen, oder?
Wenn ich nur an den Weg zu meinen Eltern denke, den ich vor wenigen Stunden mit Alexandra gegangen bin! Früher fuhr ich gelegentlich nach dem Dienst mit dem Auto kurz dort vorbei, suchte jeweils schon nach kurzer Zeitdauer und ein paar nichtssagenden Gesprächen hektisch nach einem Vorwand, mich verabschieden und endlich nach Hause in den Feierabend fahren zu können.
Ich wollte meine wohlverdiente Ruhe haben. Abends noch etwas Freizeit träge vor dem Fernseher genießen können, bevor ich mich am folgenden Tag erneut in die berufliche Tretmühle stürzen musste. Ein fades Leben – meine Eltern hatten das Ihre, ich lebte mein eigenes.
Und heute? Dieselbe Welt, dieselbe Umgebung, dieselbe Jahreszeit, dieselbe Familie. Dennoch ist nichts mehr so, wie ich es mein ganzes bisheriges Leben lang als unumstößlich gewiss wahrgenommen habe.
Alexandra und ich brachen am frühen Nachmittag auf, die genaue Uhrzeit lässt sich zurzeit nicht mehr ohne weiteres herausfinden. Aber das ist egal, wen müsste es auch kümmern, wie spät es gerade ist? Das enge Korsett der Zeitplanung war so ziemlich das erste, wovon ich und alle anderen Betroffenen nach dem EMP befreit wurden. Jawohl, befreit! Genauso empfinde ich das. Bei Temperaturen um die 0 Grad schneite es leicht, nass und schwer klatschten die nur halb gefrorenen Schneeflocken zu Boden. Meine Eltern wohnen nicht allzu weit entfernt, vielleicht so um die zwei Kilometer. Das ist eine Distanz, welche auch zu Fuß bequem zu erreichen ist. Obwohl ich mit dem Auto schon sehr oft dieselbe Strecke gefahren bin, drängte sich mir gleich der Eindruck auf, als würde ich heute diesen Weg zum allerersten Mal zurücklegen.
Es muss an der erhöhten Aufmerksamkeit liegen. Daran, dass mein Fokus auf ganz anderen Details ausgerichtet ist. Wo mich früher Ampeln, viel zu langsam zockelnde Verkehrsteilnehmer oder Parkmöglichkeiten interessieren mussten, da konnte ich heute ganz andere Kleinigkeiten bewusst wahrnehmen.
Hier der Blick in einen romantischen Hinterhof zwischen Backsteingebäuden, dort eine Mutter, die ihren beiden Mädchen soeben ihre letzten Äpfel in die Hand drückt, um sie vorläufig vor dem Hungern zu bewahren, all das war neu für mich. Gleichzeitig war es ratsam, die fremden Menschen im Auge zu behalten, die einem so begegneten. Alles im Hinblick darauf, ob man sich vor ihnen aufgrund der Ausnahmesituation in Acht zu nehmen hatte, oder ob es sich eher um friedliche Zeitgenossen zu handeln schien. Alexandra erging es offenbar ganz ähnlich. »Ich vermisse die Aktenleserei gar nicht, findest du das eigentlich merkwürdig?«, fragte sie nachdenklich. »Es gibt doch so viele andere Dinge, so viele Möglichkeiten, seinen Tag auszufüllen und interessant zu gestalten. Nur hatten wir vor lauter eintöniger Arbeit überhaupt nicht die Möglichkeit dazu!«
Ich sah ihr in die Augen und nickte verständnisvoll, während wir gemächlich eine alte Gaststätte passierten, die schon seit längerer Zeit ihre Pforten geschlossen hatte.
»Schau mal, zum Beispiel hier! Die haben dort hinten, wo einst der Biergarten gewesen sein mag, noch diese schönen alten Metallschilder hängen! Sie sind zwar weitgehend verrostet, aber mir haben diese bunten Werbetafeln schon als Kind sehr gut gefallen. Mir würde es echten Spaß machen, so ein uraltes ›AfriCola‹-Schild schön vom Rost zu befreien, es neu zu lackieren und zu bemalen. Einfach als Wandschmuck.«
»Genau!«, strahlte Alex. »Ich liebe Tätigkeiten, von denen am Ende des Tages etwas bleibt. Wenn ich etwas erschaffen habe, das ich später noch sehen und anfassen, mich daran erfreuen kann, meine Tätigkeit einen Sinn hatte.
Da stellt sich dann viel leichter ein Erfolgserlebnis ein, als das bei unserem Job im Rathaus der Fall ist … nein, war, meine ich natürlich! Wenn ich von dort am Abend nach Hause gegangen bin, war ich einfach nur ausgelaugt und genervt. Der Aktenstapel vom Morgen war erledigt, dafür lag ein neuer da. Es fiel mir immer schwerer, hieraus eine Befriedigung zu ziehen!«
»Du sprichst mir aus der Seele!« Die nächsten paar hundert Meter gingen wir schweigend nebeneinander die Straßen entlang, jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Meinen Schal fest um den Kopf gewickelt, wanderte ich durch den Schneeregen, ohne mir wie sonst Gedanken um meine Frisur zu machen. Man wird inzwischen nicht mehr für eine tolle Haartracht oder die neueste Mode bewundert, sondern eher für Organisationstalent und Mut. Plötzlich blieb Alex abrupt stehen. »Ach, du lieber Himmel!
Schau mal, es hat schon angefangen!«
Ich sah in die von ihr angezeigte Richtung auf der anderen Straßenseite und stellte fest, dass man wohl eine kleine Metzgerei mit angeschlossenem Lebensmittelladen ausgeplündert hatte. Die Fensterscheiben waren eingeschlagen worden, Glasscherben und Verpackungsteile lagen wüst auf dem Gehweg verstreut.
»Das wird jetzt wohl überall Schule machen!«, stellte ich angewidert fest. Dennoch beschlich mich eine leise Ahnung, dass selbst grundanständige Leute wie Alex oder ich noch in Situationen geraten mochten, in denen wir einige unserer anerzogenen Grundsätze fallen lassen müssten, um zu überleben.
Aber heute noch nicht! Man konnte natürlich auch leicht mit dem Finger auf andere zeigen, so lange man selbst einen Teller Eintopf im Magen hatte.
Wir erreichten die Straße, in welcher meine Eltern vor fünf Jahren ihre Eigentumswohnung gekauft hatten. Lange mussten sie damals nach einer behindertengerechten Wohnung im Erdgeschoss suchen, die den Bedürfnissen meines nach einem Schlaganfall gehbehinderten Vaters gerecht werden konnte; doch die Geduld bei der monatelangen Suche war schließlich belohnt worden, ihre neue Wohnung war ebenso funktional wie schön.
»Sieh mal, diese Fahrbahn ist schon von den während der Fahrt liegen gebliebenen Fahrzeugen befreit worden! Sollten wir jemals zu unserem ›alten‹ Leben zurückkehren können, werden die Versicherungsgesellschaften wohl erst einmal alle blitzartig pleitegehen! Ich möchte nicht wissen, wie viele Totalschäden sich alleine in dieser Straße konzentrieren!«
Ich musste trotz des unschönen Anblicks der ineinander verkeilten Blechlawinen lächeln. »Du hast vielleicht Sorgen! Na, ich habe ja vorläufig auch noch gut lachen: Mein ›schöner Autowagen‹ steht schließlich äußerlich wohlbehalten zu Hause in seiner Parkbucht!
Wobei ich übrigens ohnehin der Meinung bin, dass das Geldsystem sich nicht so einfach von heute auf morgen wieder erholen wird; weder für die Versicherungskonzerne, noch für sonstige Wirtschaftsunternehmen wird in der ersten Zeit nach der Krise
›Business As Usual‹ problemlos wieder funktionieren. Besonders dann nicht, falls es weltweit zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und aller elektronischen Systeme gekommen sein sollte, was wir ja nach wie vor nicht sicher wissen.
So, wir sind am Ziel angelangt, meine Eltern wohnen hier in Nummer 31. Ich gehe mal eben um die Hausecke, um hinten an die Terrassentür zu klopfen!«
Sorry liebe Leute, mir fallen alle paar Minuten die Augen zu. Die Buchstaben auf dem Blatt vor mir verschwimmen schon zu einem schwarzen Einheitsbrei. Ich werde mich jetzt besser mit einem Extrapaar dicker Strick-Socken an den Füßen in meinem Schlafsack zusammenrollen. Weiterschreiben kann ich morgen immer noch, ich muss mich ja zum Glück nicht mehr dem starren Diktat fester Arbeitszeiten beugen.
Wann werde ich es wohl endlich lernen, mich kürzer zu fassen?
Gute Nacht, allerseits!
*
Ach, ist das herrlich! Ich komme soeben vom Kaffeetrinken mit meinen Mitbewohnern zurück, sogar ein paar Schoko-Kekse haben alle zum Frühstück erhalten! Frisch gestärkt kann ich nun meinen Bericht von gestern fertigstellen.
Ich muss mich allerdings ein bisschen beeilen, denn nachher wollen wir uns unten in der Lobby zum Brainstorming wiedertreffen, und meine Unterwäsche muss ich auch noch von Hand im Waschbecken reinigen. Lauter ungewohnte Tätigkeiten, die da neuerdings auf einen warten.
Gestern klopfte ich also behutsam an die Terrassentür meiner Eltern; schon durch die Scheibe bemerkte ich, dass beide mit versteinerten Gesichtern auf der Couch saßen und deprimiert dreinsahen. Freilich, die beiden sind in ihrem Alter nicht mehr sehr beweglich und verbringen daher normalerweise täglich viel Zeit vor dem Fernseher, welcher jetzt jedoch nicht mehr funktioniert.
Sich unterhalten können sie ebenfalls nicht. Mein Vater vermag seit seinem Schlaganfall nicht mehr zu sprechen, weil das Sprachzentrum im Gehirn damals schwer getroffen worden ist. Da hat tragischerweise auch eine jahrelange logopädische Behandlung keinerlei Verbesserung zeitigen können. Oft schon stürzte mein Vater deswegen in den Zustand einer tiefen, lähmenden Verzweiflung ab, aus dem man ihn nur mühsam wieder hervorholen konnte.
Als Alexandra und ich meinen Eltern schließlich Gesellschaft leisteten und ihnen von unserem neuen Camp-Leben erzählten, heiterte sich deren Stimmung sichtlich auf. Ich schlug ihnen vor, doch möglichst den Versuch zu starten, etwas Ähnliches mit der Nachbarschaft aus dem hiesigen Wohnblock ins Leben zu rufen. Dann könnten die Menschen gegenseitig aufeinander sehen, keiner wäre in seinem Elend alleine gelassen.
Zuerst hatte meine Mutter ein paar Bedenken, weil sie einige der Nachbarinnen nicht leiden mochte. Aber dann stellte sie immer mehr Fragen, wie wir denn gewisse Unstimmigkeiten überbrückt hätten. Mein Vorschlag ist zumindest auf fruchtbaren Boden gefallen, und das finde ich beruhigend.
Wir erfuhren, dass gestern überall im Wohnblock Soldaten an die Türen geklopft hatten, um der Bevölkerung eine wichtige Mitteilung zu machen. Ab morgen Abend gelte bis auf weiteres eine nächtliche Ausgangssperre, weil inzwischen der Notstand in Deutschland verhängt worden sei.
»In Deutschland? Bist du dir sicher, dass der Soldat wirklich ›in Deutschland‹ gesagt hat?«, fragte ich meine Mutter eindringlich. Sie nickte nur traurig.
Zum Schluss ließ ich mir von Mama noch die Vorräte in der Speisekammer zeigen; ich wollte sichergehen, dass diese in den nächsten Tagen noch nicht zur Neige gehen würden. Doch es verhielt sich genauso, wie ich es mir schon gedacht hatte: Die Generation aus dem Zweiten Weltkrieg ist offensichtlich noch immer in der Gewohnheit gefangen, Lebensmittel für den Notfall zu horten. Was ich früher mitleidig belächelt hatte, das stellt sich nun als vorausschauendes Handeln heraus. Nein, verhungern werden die beiden noch lange nicht!
Beim Abschied drückte ich meine Eltern so lange an mich, wie ich es seit der Kindheit nicht mehr getan hatte. In solchen Krisensituationen rücken Familien anscheinend trotz aller Differenzen automatisch wieder näher zusammen, weil sie sich gegenseitig brauchen. Blut ist eben doch dicker als Wasser!
Ich musste meine Mutter mit Nachdruck daran hindern, uns noch eine Art von gut gefülltem »Care-Paket« für den ach so weiten Nachhauseweg ins Rathaus II zusammenzustellen. Ich flunkerte halbherzig, dass wir mehr als genug Lebensmittel zur Verfügung hätten, sie sich also keine Sorgen zu machen brauche. Mit trotziger Miene drückte sie aber dennoch jeder von uns eine Salami in die Hand, bevor wir gehen durften.
Alexandra und ich traten den Rückweg an; wieder war mir stellenweise nicht ganz wohl in meiner Haut, denn wir gewahrten beispielsweise in einer Seitenstraße ein Grüppchen von Jugendlichen, welches anscheinend etwas Verbotenes im Schilde führte. Viele Augenpaare verfolgten uns aufmerksam, bis wir aus dem Blickfeld verschwunden waren.
Unsere Salamis hatten wir vorsichtshalber rechtzeitig unter den Jacken verschwinden lassen, um bloß keine Begehrlichkeiten zu wecken. Außerdem hielt ich das Döschen mit dem Pfefferspray in der Hosentasche fest umklammert, um es im Notfall schnell einsatzbereit zu bekommen. Diese Tage der Neuordnung bergen neben positiven Erfahrungen auch beängstigende Schattenseiten, das ist leider unübersehbar.
Ja, und zu Hause habe ich dann gleich an diesem Bericht weitergeschrieben, während Alexandra Peter von der angeblich deutschlandweiten Inkraftsetzung einer Nacht-Ausgangssperre berichtete. Wie schnell doch die Tage verfliegen! Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich Langeweile anfühlt.
*
Donnerstag, 20. Februar 2020
Jeder einzelne Tag bringt etwas Unvorhergesehenes, worauf wir aus der Situation heraus kreativ und vor allen Dingen unmittelbar reagieren müssen. Da ist besonnene Diplomatie genauso gefragt wie Einfallsreichtum, welcher auch noch auf die Sekunde genau abrufbar sein muss.
Heute sind wir beispielsweise haarscharf an einer Räumung unseres Rathaus-Camps vorbeigeschrammt. Hätten wir unseren Anführer Peter nicht gehabt, so wäre sicherlich einiges schief gegangen.
Es ist schon merkwürdig! Nie haben wir den schmächtigen und körperlich eher kleinen Peter zum Anführer gewählt oder ihn in irgendeiner Form mit dieser schwierigen Aufgabe betraut. Er ist ganz natürlich von Anfang an in diese anspruchsvolle Rolle hineingewachsen, besitzt eindeutige Führungsqualitäten, die jeder in unserer aus der Not geborenen Zweckgemeinschaft wie selbstverständlich anerkennt.
Dabei hat er bis vor einer Woche in seiner Eigenschaft als Beamter niemals eine leitende Position bekleidet, er verhielt sich eher unauffällig und tat seinen Dienst gerade so nach Vorschrift. Katastrophen wie diese scheinen die wahren Talente der Menschen zuverlässiger ans Tageslicht zu bringen, als jeder hoch dotierte Selbstfindungskurs. Auch dann, wenn diese Fähigkeiten zuvor ein ganzes Leben lang tief in der Persönlichkeit vergraben unauffällig geschlummert haben, der Inhaber selbst nichts von seinem Glück geahnt hat.
Nach dem Morgenkaffee nebst kleinem Frühstück saßen wir heute wie gewohnt in der Lobby zusammen, um über legale Möglichkeiten der Lebensmittelbeschaffung nachzudenken. Die Vorräte schmelzen bereits sichtbar dahin, wir müssen unbedingt rechtzeitig für Nachschub sorgen.
Wir kamen nach kurzer Diskussion überein, zunächst die Innenstadt zu rein informativen Zwecken aufzusuchen. Es muss in einem ersten Schritt abgeklärt werden, was dort aktuell vor sich geht, wie sich die Dinge in der Zwischenzeit entwickelt haben. Wir planten also zum Auftakt eine Art »Katastrophen-Stadtbummel«. Sind nach der ersten Orientierungslosigkeit womöglich sogar Apotheken, Arztpraxen, Banken oder Supermärkte provisorisch wieder geöffnet? Ist Geld als Zahlungsmittel überhaupt noch im Umlauf, oder hat bereits der Tauschhandel Einzug gehalten? All diese Fragen galt es abzuklären, bevor man weitere Pläne schmieden konnte.
»Wenn wir nachher alle gemeinsam losziehen, dann nimmt bitte jeder seine gesamten Geldbestände in bar mit, welche er noch in Besitz hat. Falls Geschäfte geöffnet haben sollten, dann müssen wir nämlich so viel als möglich ergattern, bevor die Warenbestände endgültig ausverkauft sind. Mit Nachschub ist schließlich nach Lage der Dinge nicht wirklich zu rechnen!«, verfügte Peter nach einer kurzen Denkpause.
»Sollten Bankfilialen wider Erwarten Bargeld herausrücken, müssen zusätzlich die Girokonten geleert werden. Mein eigenes selbstverständlich auch! Das Sparen können wir uns momentan sparen!«, versuchte er sich an einem sarkastischen Witz.
Ich sinnierte betroffen vor mich hin, sagte in Gedanken meinen komplizierten Finanzplanungen adieu. Was hatte ich mir von meiner angesparten Kontoeinlage nicht alles kaufen wollen! Nach heutigen Verhältnissen lauter sinnloses Zeug, auf das ich da meine Zeit und Energie verschwendet hatte. Mein Blick glitt verträumt zur großen Glasfront hinaus, als ich mir diese Extravaganzen bildlich vorstellte, welche mir den bis dato tristen Alltag zwischendurch versüßen sollten. Doch plötzlich war ich hellwach!
»Da kommt einer!« Die Köpfe meiner Mitbewohner flogen herum, alle betrachteten mit fragenden Blicken die Gestalt, welche sich langsam aus dem morgendlichen Eisnebel schälte und mit ausladenden, selbstsicheren Schritten auf den Eingang zustrebte.
»Mist!«, stöhnte Peter. »Erkennt ihr ihn etwa nicht? Das ist dieser arrogante Schönling Frieder, der immer alles besser kann und weiß als das halbe Universum. Was will ausgerechnet dieser Blödmann im Kaschmir-Mantel denn hier? Das kann nichts Angenehmes oder Vernünftiges sein!«
Peter erhob sich seufzend, um den geschniegelten »Blödmann im Kaschmir-Mantel« gleich an der Glastür in Empfang zu nehmen und möglichst stehenden Fußes abzuwimmeln.
Ich muss ein wenig ausholen. Frieder ist wohl das, was man unter Kollegen wenig freundlich einen »Schleimscheißer«,
»Arschkriecher« oder, verbal etwas stilvoller, verächtlich einen »Emporkömmling« nennt.
Obwohl von allerhöchstens durchschnittlicher Intelligenz, verstehen sich solche Menschen meisterlich auf das Dampfplaudern – das ist die hohe Kunst, mit vielen Worten eigentlich gar nichts zu sagen, dabei aber großen Eindruck bei ähnlich strukturierten Mitbürgern zu schinden. Man kennt dieses verrückte Phänomen von Politikern zur Genüge, nicht wahr?
Frieder hat zusätzlich Intrigen, Mobbing und seine Ellbogen beharrlich als Hilfsmittel benutzt, um sich mit der Zeit auch ohne herausragende dienstliche Leistungen eine recht gute Position innerhalb der biegsamen Behördenstruktur der Stadtverwaltung zu sichern. Wer nicht für ihn ist, ihn nicht ausgiebig hofiert und bauchpinselt, der ist automatisch gegen ihn und wird gnadenlos bekämpft. Bei den meisten Kollegen genießt er deswegen auch nicht gerade das höchste Ansehen, wird hinter seinem Rücken »der Un-Frieder« genannt.
Frieder Weiland legte auch seinem Ruf gemäß prompt los, kaum dass Peter die Glastür aufgesperrt hatte. »Was ist denn hier los? Entspricht es Ihrer Dienstauffassung, einfach tatenlos in der Halle herum zu hocken? Drüben im Rathaus I wird jede Hand dringend zum Zupacken gebraucht, und Sie machen sich hier einen lustigen Tag mit Zeltlager-Romantik!
Wer hat Ihnen überhaupt genehmigt, sich in diesen Diensträumen aufzuhalten? Was soll der Bürger denken? Hier sieht es aus und riecht wie in einem Unterschlupf für Gammler!
Ich muss sie bitten, das Rathaus II umgehend zu verlassen, Sie halten sich hier unbefugt auf! Entweder, Sie gehen freiwillig und halten sich anschließend zu unserer Verfügung, oder ich muss Meldung machen und ihre abartige Truppe gegen Ihren Willen auflösen lassen!«
Peter ließ sich nicht im Mindesten beeindrucken, obwohl Frieder Weiland gut und gerne an die zwei Meter und damit beinahe zwei Köpfe größer war. Wie die beiden dort in gespannter Körperhaltung im Eingangsbereich standen und sich gegenseitig abschätzig taxierten, fühlte man sich unwillkürlich an die Geschichte von David und Goliath aus der Bibel erinnert.
Frieder hatte sein giftstrotzendes Pulver erst einmal im üblich arroganten Tonfall verschossen, seinem Kontrahenten Peter jedoch nicht den beabsichtigten Schaden zugefügt. Im Gegenteil, dieser wirkte leicht amüsiert und legte nun seinerseits in ruhigem, vollkommen beherrschten Ton los.
»Herr Weiland, ich muss mich doch sehr wundern! Sollte es Ihnen etwa entgangen sein, dass der Notstand ausgerufen wurde und nun das Militär in dieser Stadt das Sagen hat? Bedienstete der Stadtverwaltung sind allerhöchstens noch Erfüllungsgehilfen, die sich den Weisungen der Soldaten ohne Fragen zu beugen haben; hierbei ist es übrigens ganz gleich, welchen Dienstgrad wir Mitarbeiter der Stadtverwaltung innehaben – was auch für Ihre Person gilt! Nun, ich weiß nicht, was Ihr Aufgabengebiet beinhaltet; wir haben heute Morgen jedenfalls von den Streitkräften den ausdrücklichen Befehl erhalten, hier unbedingt auszuharren, falls hilfesuchende Bürger unseren Rat benötigen sollten. Was im Übrigen vereinzelt schon geschehen ist! Sehen Sie zum Beispiel diese Frau mit den kleinen Kindern dort drin?«
Peter zeigte vielsagend auf die beiden Buben, welche mit unserem Kollegen Kai und seiner Ehefrau in unserem Camp eingezogen waren und seither Leben in die Bude brachten. Zurzeit schmiegten sich die Rabauken allerdings dekorativ an ihre Mutter, als handele es sich tatsächlich um eine bemitleidenswerte Flüchtlingsfamilie.
»Hier sind Kinder untergekommen, denen sonst ernste Gefahr und Hunger gedroht hätte! Wir gewähren ihnen weisungsgemäß Schutz und Nahrung, wie Sie sehen!«, konstatierte Peter mit vorwurfsvollem Blick.
›Dass dies gar keine notleidende Familie ist, die hier zufällig Schutz gesucht hat, das kann der dämliche Weiland ja nicht ahnen‹, dachte ich mir und grinste verstohlen in mich hinein.
»Außerdem sollen wir nebenbei das Dienstgebäude vor Plünderung oder Verwüstung bewahren und jeden, der hier auftaucht, von der Inkraftsetzung der Notstandsgesetze informieren«, fuhr Peter mit viel Pathos in seinem Vortrag fort.
»Von der totalen nächtlichen Ausgangssperre muss ebenso jeder Bürger erfahren wie von der Warnung, dass mit Plünderern ab sofort rigoros kurzer Prozess gemacht wird. Wir sind immer noch Beamte der Stadt Bayreuth, und damit für diese Aufgabe bestens geeignet.
Wie Sie wissen, können derart wichtige Nachrichten ohne Nutzung von Fernsehen, Internet und Radio nur noch sehr schwierig und langsam unter der Bevölkerung verbreitet werden! Deshalb gehen wir immer wieder in Gruppen hinaus, um auch die Menschen auf der Straße zu erreichen.«
Weiland blieb zunächst einmal jede bösartige Erwiderung im Halse stecken, er schien krampfhaft zu überlegen. Schließlich fand er seine Fassung wieder, setzte den gewohnt blasierten Gesichtsausdruck auf.
»Ist ja schon gut, in Ordnung! Dann machen Sie mal besser weiter so! Diese Außenstelle muss aber unbedingt geöffnet bleiben, und zwar rund um die Uhr, ist das klar? Und lüften Sie mal durch, es riecht nach Ausdünstungen!«
Peter grinste unverhohlen und salutierte markig. »Jawohl, Sir!
Wie Sie wünschen, Sir!«
Frieder Weiland entfernte sich kopfschüttelnd; aber nicht, ohne noch einen vernichtenden Blick auf Peter abzuschießen. Dann war er aus unserem Blickfeld verschwunden.
»Mein lieber Schwan!«, sagte ich anerkennend. »Du kannst von großem Glück reden, dass du nicht Pinocchio bist! Deine lange Nase würde sonst jetzt mindestens bis hinüber nach Bindlach reichen!«
Schallendes Gelächter bestätigte, dass die Kollegen sich wohl Ähnliches gedacht hatten und Peter für seine Demonstration von Münchhausens Künsten ebenfalls sehr dankbar waren.
»Reife Leistung, Alter!«, bemerkte Hausmeister Klaus bewundernd und klopfte Peter derb auf die Schulter, während alle anderen zustimmend nickten. »Ich dachte schon, ich müsste diesem Lackaffen gleich meine Schlüssel übergeben! Wie ihr wisst, ist das Hauptamt mir gegenüber leider durchaus weisungsberechtigt. Im Grunde genommen hat Frieder Weiland also sogar das Hausrecht!« Puh, das war ja noch einmal gut gegangen! Selbst wenn Frieder uns nachher beim Katastrophen-Stadtbummel entdecken würde, na und? Dank Peters Märchen würde er denken, wir seien ausgeschwärmt, um unsere Mitbürger von der Ausgangssperre zu informieren. Einfach genial, dieser Schachzug.
Frieder hatte vor lauter Verwirrung nicht einmal das Mittelalter-Lager im Tresorraum oder den Feuerkorb samt Kochkessel auf Walters Terrasse entdecken können. Diese außergewöhnlichen Gegenstände hätten wir schließlich auf gar keinen Fall nachvollziehbar mit dienstlichen Belangen erklären können! Wir waren dem Hinauswurf nur um Haaresbreite entgangen.
Dieser Tag hielt jedoch noch mehr psychisches Ungemach bereit, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten. So freuten sich meine Kollegen unbändig darauf, nach all der Stubenhockerei endlich einmal hinaus an die frische Luft zu kommen und holten eifrig Schals, Mützen und Handschuhe aus ihren Zimmern.
Ich hingegen entschuldigte mich bei Peter, um nicht mit in die Stadt gehen zu müssen. Ich wollte lieber die Geschichte des Vormittags gleich detailliert aufschreiben, damit sie mir noch frisch genug im Gedächtnis haftet.
Peter zeigte sich mit diesem Vorschlag gleich einverstanden. Er hatte sowieso anregen wollen, dass mindestens einer hier zurückbleiben solle, schon um auf alles aufzupassen, oder für den Fall, dass Frieder zurückkäme. Ich möge zum Schreiben nur bitte hier unten in der Lobby bleiben, meinte er zum Abschied. Gerade vor fünf Minuten bin ich mit den Aufzeichnungen fertig geworden und will jetzt noch ein wenig die seltene Ruhe genießen, bis die Meute in Kürze mit ihrem Bericht und hoffentlich auch mit einigen Essensvorräten zurückkehren wird. Mein
Magen meldet bereits Bedürfnisse an.
Oh, verdammt! Da klopft schon wieder einer an die Glastür!
Das kann aber nicht Frieder sein, der Mann trägt Uniform!
*
Mein armes Herz schlägt mir immer noch bis zum Hals! Himmel noch mal, können einen die nicht einfach alle in Frieden lassen? Da hilft man sich gegenseitig in Eigeninitiative, tut keinem Menschen was zuleide und trotzdem meinen irgendwelche Wichtigtuer, sie müssten einen gängeln und einem das Leben noch schwerer machen! Die Offiziellen haben im Grunde selber keinen Plan, trotzdem soll jeder willenlos nach ihrer Pfeife tanzen. Vor der Eingangstür stand also dieser junge Soldat, drückte sich die Nase an der Glasscheibe platt, um in die Lobby zu spähen. Ich sperrte die Tür auf und fragte freundlich, ob ich ihm irgendwie helfen könne.
»Ja!«, meinte er kurz und bündig. »Sie geben mir jetzt diese Schlüssel, nehmen Ihre Sachen und verlassen bitte das Haus! Hier wird ab sofort ein Koordinations-Stützpunkt der Bundeswehr eingerichtet. Schon heute Abend werden unsere Ausrüstung, unsere Fahrzeuge und meine Kameraden hier sein. Befehl von oben!« Er zuckte entschuldigend mit den Schultern; vermutlich hatte er meinen entsetzten Blick aufgefangen.
»Aber … das können Sie doch nicht machen!«, stammelte ich und versuchte, meine durcheinander purzelnden Gedanken zu ordnen. »Hier leben Menschen, die sich einander helfen und gemeinsam zu überleben versuchen!« Die Schlüssel ließ ich vorsichtshalber unauffällig in meine Hosentasche gleiten.
Der Soldat schüttelte bedauernd den Kopf. »Das tut mir leid für Sie, aber da müssen Sie sich schon eine andere Bleibe suchen! Dies ist ein öffentliches Gebäude und somit auch für öffentliche Aufgaben bestimmt. Wir koordinieren von hier aus künftig den Einsatz, welcher der Bevölkerung über das Gröbste hinweg helfen und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung gewährleisten soll – also sind wir auch für Sie und die anderen Leute tätig, die angeblich hier wohnen!
Apropos … wo sind denn diese ›anderen‹ überhaupt, von denen Sie gesprochen haben? Sie müssten sich mit der Räumung bitte beeilen!« Der junge Mann verrenkte sich den Hals, um an mir vorbei ins Haus gucken zu können.
Mir kam eine vage Idee. Warum drehte ich nicht einfach den Spieß um und erzählte das glatte Gegenteil der Version, welche Peter erst heute Morgen beim »Un-Frieder« gebracht hatte? Versuchen musste ich es!
Ich warf einen kurzen Blick auf das Namensschild an der Bundeswehr-Uniform, welches den Soldaten als »Schneider« auswies.
»Sehen Sie mal, Herr Schneider – wir alle ziehen doch im Grunde am selben Strang, nicht wahr? Wir wollen erreichen, dass die Bevölkerung Bayreuths diesen Ausnahmezustand so unbeschadet als möglich übersteht; insoweit gehen Sie sicherlich mit mir konform?« Schneider nickte, trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.
»Das Militär hat seine eigenen Aufgaben und Methoden, an die Sache heranzugehen, die restlichen Beamten ebenfalls. Nun, ich repräsentiere diese ›anderen‹ Beamten, nehme meine Pflichten ebenso ernst wie Sie die Ihren. Und ich bin zum Glück nicht die Einzige. Das Militär wird jede unterstützende Hand brauchen, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, wenn die durch Hunger und Chaos ausgelösten Zustände erst noch viel schlimmer werden. Sie haben doch sicher auch bemerkt, dass die Straßen zunehmend unsicherer werden?«
»Ja logisch, ist doch bei jeder Katastrophe so!«, bestätigte Schneider genervt. »Und, worauf wollen Sie jetzt eigentlich hinaus?«
Fein. Er zeigte also Interesse an meiner Version! Von neuem Mut beseelt fuhr ich fort: »Ich mache es kurz, um ihre kostbare Zeit nicht zu verschwenden.
Heute Mittag haben wir durch den städtischen Boten eine Nachricht von der Frau Oberbürgermeister erhalten; Sie bei der Bundeswehr würden das bestimmt eher einen ›Befehl‹ nennen.
Im Sitzungssaal des Rathauses fand heute in den frühen Morgenstunden eine Einsatzbesprechung statt. Soviel ich weiß, nahmen Befehlshaber des Militärs, der Polizeidienststellen, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr und der Stadtverwaltung daran teil. Der Repräsentant für Ihr Ressort, das Militär, war eine Führungsperson mit sehr hohem Dienstgrad, wie man mir mitteilte. Sorry, aber ich kenne mich als Frau mit Uniform-Dekorationen und Dienstgraden des Militärs nicht so gut aus!«, lächelte ich entschuldigend.
»Man vereinbarte Regelungen über Zuständigkeiten und verteilte die verschiedenen Aufgaben, denen wir uns alle in der nächsten Zeit stellen müssen«.
»Und weiter?« Der Soldat sah verunsichert aus, runzelte skeptisch die Stirn.
»Nun, ich glaube, dass bei Ihrer Einheit der Informationsfluss untereinander nach dem EMP nicht mehr ganz so gut funktioniert wie im Normalbetrieb. Jedenfalls wurde einhellig beschlossen, dass wir städtischen Bediensteten hier das Gebäude bewachen sollen, gleichzeitig für das Militär die Nachricht von der Ausgangssperre und den sonstigen notstandsrechtlichen Verfügungen verbreiten helfen müssen. Überdies sollen wir bedürftigen Personen Unterkunft bieten, soweit es die Kapazitäten dieses Gebäudes zulassen. Hat man Ihnen davon etwa gar nichts gesagt?«
Schneider starrte betreten auf seine Schuhspitzen. »Nein, leider! Sonst hätte man mich doch gar nicht hergeschickt. Meine Vorgesetzten wussten vielleicht selber nichts davon. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Wir müssen doch irgendwo diese Zentrale einrichten, das ist doch auch wichtig!«
»Da hätte ich schon eine prima Idee!«, grinste ich zufrieden und trat zur Demonstration an die Glasfront neben dem Eingangsbereich.
»Hier in der Lobby wäre sowieso zu wenig Platz gewesen, wenn Sie mich fragen! Aber dort vorne im Straßenverkehrsamt wäre der perfekte Ort für eine solche Einsatzzentrale! Zumal direkt vor der Haustüre auch ein großer Parkplatz genügend Raum für Fahrzeuge, sogar für Panzer und Zelte bietet. Das ehemalige Pförtnerhäuschen vom Krankenhaus können Sie auch mit nutzen, damit niemand Unbefugtes auf das Gelände kommt.«
Schneider überlegte angestrengt. »Hmmm … ich habe erst vor kurzem ein Auto angemeldet. Wenn ich mich recht entsinne, ist die Zulassungsstelle doch ein sehr großer Raum mit im Halbkreis aufgestellten Schreibtischen, oder? Das wäre in der Tat ideal für uns!«
»Genau!«, bestätigte ich strahlend. »Ganz früher war das einmal die Leichenhalle des Krankenhauses, haben Sie das gewusst?«
»Nein!«, gab Schneider desinteressiert zu. »Sind dort eigentlich noch weitere Räume, die zur Verfügung stehen würden? So genau habe ich mich dort auch wieder nicht umgesehen, als ich auf meine Auto-Zulassung wartete!«
»Aber klar doch! Die Halle mündet nahtlos in die ehemalige Krankenhaus-Verwaltung, das sind zwei Stockwerke mit Einzelzimmern nebst Teeküchen und Waschräumen. Bisher waren dort die Verkehrsüberwachung und die Führerscheinstelle untergebracht. Was will man mehr?«
Jetzt strahlte auch Soldat Schneider. »Sie haben aber gute Ideen! Da werde ich meine Einheit mal aufklären gehen! Wo ist eigentlich der Hausmeister, damit er mir schon mal alles aufsperren könnte?«
»Der müsste jede Minute zurück sein! Er ist mit den anderen Bewohnern aufgebrochen, um Lebensmittel zu besorgen und die Neuigkeit von den Notstandsgesetzen in der Innenstadt zu verbreiten. Wissen Sie was? Wir beide trinken jetzt einen Kaffee und warten auf ihn, einverstanden?«
Oh ja, Schneider war sogar sehr einverstanden! Auch die Soldaten waren wohl froh und glücklich über alles, was in den Magen kam und an ein normales Leben vor dem EMP erinnerte. Ich geleitete ihn also auf Walters Terrasse zum Feuerkorb, entzündete diesen und erklärte, wie wir hier mittels Eintopf-Kessel für die Bedürftigen sorgen würden. Kochte einen Kaffee aus löslichem Pulver und schlug ihm augenzwinkernd vor, er solle die Idee mit der Zulassungsstelle doch ruhig als seine eigene ausgeben, das mache mir gar nichts aus.
Als Hausmeister Klaus schließlich in Begleitung seiner Truppe das Gelände betrat, lief ich ihm entgegen, flüsterte ihm und Peter ein paar hastige Erklärungen zu. Peter schickte Klaus dann sofort zusammen mit dem hoch zufriedenen Schneider zur Zulassungsstelle, damit dieser seiner Einheit offiziell die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen konnte.
»Pinocchio, hä? Dafür habe wohl nicht nur ich ein begnadetes Talent«, raunte er frech grinsend in meine Richtung.
Zum zweiten Mal an einem Tag war unser Rathaus-Camp also auf wundersame Weise gerettet worden, auch wenn ich Lügen eigentlich abgrundtief hasse und vorhin beim kreativen Zurechtbiegen der Wahrheit ganz schön geschwitzt habe.
In informationstechnisch besser ausgestatteten Zeiten hätte meine Flunkerei natürlich niemals funktioniert, sie wäre nach einer Rückfrage Schneiders sofort als solche identifiziert worden. So paradox es klingt: Ich hatte mir zum ersten Mal die Folgen des EMP für unsere Zwecke zunutze machen können.
Jetzt gehe ich erst einmal etwas essen. Danach werde ich in der friedlichen Abgeschiedenheit meines kleinen Zimmers den Rest der turbulenten Erlebnisse dieses Tages niederschreiben, bevor mich die Müdigkeit vollends übermannt.
*
Schon als Peter und Klaus, gefolgt von allen anderen Mitbewohnern bei ihrer Rückkehr das Gelände betraten, erschrak ich regelrecht. Auf Anhieb konnte ich ihnen aufgrund von Mimik und Körperhaltung ansehen, dass es sich hier um einen reichlich demotivierten, frustrierten Trupp handeln musste.
Was mochten sie in der Stadt erlebt haben, was konnte meinen Gefährten Unangenehmes widerfahren sein? Ich brannte darauf, Näheres hierüber zu erfahren, denn die neu gesammelten Erkenntnisse würden ja schließlich auch mich in gleichem Maße betreffen. Als Soldat Schneider sich endlich auf den Weg machte, um mit froher Kunde zu seiner Einheit zurückzukehren, sah ich den richtigen Moment gekommen, Fragen stellen zu können.
»Na, meinen Teil der Geschichte über diesen Nachmittag habt ihr ja soeben zur Genüge mitbekommen. Aber jetzt erzählt mal, wie ist es bei euch gelaufen? Ich platze vor Neugier! Ein paar Tüten habt ihr aus der Stadt immerhin mitgebracht, wie ich sehe.« Peter blickte drein, als wäre er drauf und dran, jemandem den Kragen umzudrehen oder einen Amoklauf zu starten. »Sei bloß froh, dass du nicht dabei warst! Heute habe ich mich zum ersten Mal ernsthaft gefragt, ob es der Mensch vielleicht gar nicht wert ist, zu überleben! Guck mal bitte in diese Plastiktüten und schätze,
was die Sachen dort drin gekostet haben könnten!«
Mit fragendem Blick schnappte ich mir die Tüten, überflog grob den Inhalt. Jede Menge Nudelpackungen, Fertigsoßen, Duschgel, Zucker, Salz, ein paar Konserven und Instant-Kaffee konnte ich auf Anhieb erkennen. Vier große Tüten voll.
»Na ja – vielleicht so 150 bis 180 Euro, alles in allem?«, fragte ich zaghaft. Sehr lange werden uns diese paar Lebensmittel sowieso nicht reichen, wir haben schließlich insgesamt 18 Personen zu verköstigen.
Peter schnappte scharf nach Luft. »Oh ja, noch vor einer Woche hättest du die Preise wahrscheinlich gar nicht schlecht geschätzt! Aber an dir ist auch bislang die sprunghaft explodierende Inflation, oder vielmehr der skrupellose Wucher unbemerkt
vorbeigegangen, der inzwischen dort draußen die hässlichen Blüten der Gier austreibt«, stieß er ironisch hervor.
»Dann will ich dich mal aufklären: Diese paar Sachen haben genau 3.558 Euro und 37 Cent gekostet, doch wir hatten keine andere Wahl! Die vielen Leute im Supermarkt haben sich die Sachen gegenseitig rücksichtslos aus den Händen gerissen, da blieb uns keinerlei Zeit zum Überlegen oder für Diskussionen.
Ich musste geschlagene eineinhalb Stunden lang in einer endlosen Schlange an der Kasse stehen, denn die Angestellte hat sämtliche Waren genervt mit Block und Stift aus dem Kopf zusammenrechnen müssen, worin sie nicht sehr geübt zu sein schien. Die anderen haben derweil draußen gewartet, wurden des Öfteren zur Seite geschubst und angepöbelt.
Widerstandslos zahlen, oder halt mit leeren Händen gehen und verhungern, das waren die beiden einzigen Optionen, die uns dort drinnen blieben. Jetzt sind wir so gut wie pleite!«.
Ich bin selten sprachlos, doch in diesem entmutigenden Moment vor zwei Stunden blieb mir schier die Spucke weg. Die Vorstellung, dass es da draußen Menschen gibt, die im Grunde genau wie wir unter den Folgen des EMP zu leiden haben, also im selben Boot sitzen und dennoch nur an ihren eigenen Vorteil denken, verursacht in mir Ekelgefühle und Wut. Warum müssen sich nur manche Leute am Leid ihrer Mitmenschen auch noch bereichern?
»Scheiße!«, sagte ich betroffen zu Peter; etwas Erquicklicheres fiel mir beim besten Willen nicht ein. »Dann konntet ihr wohl auch kein zusätzliches Geld bei der Bank abholen? Dass die Geldautomaten nicht mehr funktionieren, ist ja sonnenklar. Aber eigentlich müssten die Banken doch wenigstens in der Filiale Bargeld aus den Guthaben herausrücken, das steht dem Kunden rechtlich zu!«, dachte ich laut nach.
Peter schüttelte resigniert den Kopf; er sah mich an, als hätte ich etwas besonders Dummes gesagt.
»Bei allen Banken, an denen wir vorbeikamen, bot sich annähernd das gleiche Bild. In den Fensterscheiben hängen handgeschriebene Plakate, auf denen man sich bei den geschätzten Kunden heuchlerisch für die Unannehmlichkeiten entschuldigt; man bitte um ein wenig Geduld und hoffe, dass die Schwierigkeiten bald behoben seien und man zum normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren könne.
Die Texte gleichen sich im Wesentlichen wie ein Ei dem anderen: Sorry, der Geldautomat funktioniert momentan nicht, Barabhebungen sind daher ausgeschlossen. Da die jeweiligen Kontostände wegen ebenfalls funktionsunfähiger Computer nicht abgefragt werden können, zahle man zurzeit auch sonst kein Geld aus, die Filiale bleibe bis auf weiteres geschlossen.
Im Übrigen seien sämtliche Geldbestände mit einer Zeitschaltuhr gesichert, welche bei einem längeren Stromausfall den Tresorraum verriegelt hält. Man brauche sich also gar nicht erst an einer Plünderung versuchen.«
Nur sehr langsam und zäh drang mir die bittere Erkenntnis bis ins Bewusstsein durch, was diese katastrophalen Neuigkeiten für uns bedeuten; mein Gehirn weigerte sich wahrscheinlich mit aller Kraft, die schreckliche Wahrheit zu verarbeiten. Ich sank in mir zusammen und sah in Peters leere Augen, in denen pure Resignation zu lesen war.
»Dann war dies wohl unser letzter Einkauf!«, konstatierte ich.
»Und das nur, weil einige Unmenschen den Hals nicht voll kriegen können! Würden sie normale Preise verlangen, dann hätte unser Geld gleich viel länger gereicht.«
Peter schüttelte traurig den Kopf. »Nein, das hätte im Grunde unsere Situation auch nicht wesentlich verbessert. Wären die Waren billiger geblieben, dann hätten eben viel mehr Leute die Chance genutzt, heute noch mit ihrem restlichen Geld einkaufen zu gehen; dann hätten wir vermutlich gar nichts mehr ergattern können. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst: die Lage ist bedenklich, wenn nicht sogar aussichtslos!«
Verdammt, Peter hat natürlich recht! Aber jetzt, nachdem ich nach Überwindung des ersten Schocks in meinem Zimmerchen ein wenig nachgegrübelt und mich selber bemitleidet habe, regt sich in mir verzweifelter Widerstand. Nö, ich möchte definitiv nicht einfach aufgeben und unsere missliche Lage akzeptieren!
Morgen werde ich Alexandra fragen, ob sie bereit wäre, einen weiteren »Katastrophen-Stadtbummel« mit mir zu ertragen, auch wenn uns dieser bestimmt ziemlich deprimieren wird. Ich muss mir unbedingt ein eigenes Bild von den Zuständen in Bayreuth machen, vielleicht kommt mir ja eine brauchbare Idee. Das wird garantiert ziemlich anstrengend werden, daher gehe ich heute ausnahmsweise etwas früher schlafen.