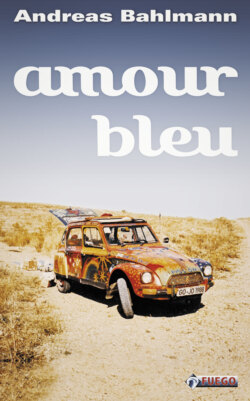Читать книгу Amour bleu - Andreas Bahlmann - Страница 4
Оглавление***
Liebe ist eine Sache der Duldung und riecht unangenehm.
Tränen sind kein Ausdruck des Leidens, sondern eine Waffe des Mitleids.
Für Umarmungen in meiner Kindheit reicht die Erinnerung nicht aus.
Stattdessen war ich viel alleine und mein Herz pulsierte unbarmherzig gegen die Einsamkeit an, aber auch gegen den Tod, der mich jederzeit ereilen konnte.
Der Herzschlag beruhigt und hält die chronische Todesangst am Leben.
Der Tod soll wie Schlaf sein, nur länger und noch dunkler, schwarz halt und lautlos, vollkommene Stille.
Man muß jederzeit darauf vorbereitet sein, mit einer reinen Seele.
Also empfiehlt es sich doch besser, das Einschlafen zu vermeiden.
Übrig blieben der Spott und die Unfähigkeit zu lieben.
Die Wut auf Tränen.
Die Heimatlosigkeit und die Suche nach irgendeiner Zugehörigkeit, aber auch die Mitleidlosigkeit mit dem Selbstmitleid.
Übrig blieb die kalte Gefühlsdecke der höhnischen Erpressung nach der Umarmung.
Vertrauen macht dich nur erpressbar, und die Eltern sind Verbündete des Fegefeuers.
»Es ist nur zu Deinem Besten!« lallte die urvertraute Stimme aus dem eisigen Nichts der Erinnerung, während ich gegen den Brechreiz ankämpfte, den der besoffene Gestank seiner Worte in mir erzeugte, bevor ich verprügelt wurde, um mich für das Leben abzuhärten. Manchmal zerbrach der Kleiderbügel an der Härte des Lebens, das angeborene Urvertrauen am splitternden Holz.
Später meine Liebe.
Sie war gegangen.
Der Platz neben mir war leer.
Ich war entsetzt, vielleicht auch verzweifelt, aber nicht überrascht.
Ich hatte es so sehr gewollt, auch versuchen wollen.
Und ich war wieder allein, mein Leben kannte sich damit gut aus.
Da war ich sicher vor dem Vertrauen zu anderen.
Und auch frei von dem Vertrauen der anderen.
Aber ich hatte Liebeskummer, und es schmerzte unendlich.
Ich schaute aus dem Fenster.
Mein zerrissenes Herz, meine rotgeweinten Augen, lautlos versiegende Tränen, die sich in salzigen Flussbetten durch mein rotfleckiges, erschöpftes Gesicht fraßen.
Tränen wie brennender Regen erzeugten Feuerqualen, so heiß, daß sie mich vor Kälte erfrieren ließen, ...weil unsere Liebe zerbrochen war.
Sie hatte ihren Kopf nach vorne gebeugt, ihre langen, dunklen Locken hingen herab, teilten sich an ihrem Hals und legten ihren schönen Nacken frei. Ich wollte ihn küssen, tat es aber nicht, weil ich es einfach nicht konnte.
Ich tat und konnte vieles nicht, auch wenn ich es mir sehr wünschte, aber früher oder später wird es dann doch wieder gegen dich gedreht und brutal in deine Seele zurück gestochen. Also blieb ich stumm sitzen.
Sie schüttelte kurz und heftig ihre Haare und schaute mich aus großen, mit Tränen gefüllten Augen an. Aus ihrem sanften Gesicht schrie eine tiefe Traurigkeit. Es schnürte mir die Kehle und mein Herz zu und fesselte mich, zu keiner Bewegung fähig, auf meinem Platz. Ich begann, an ihren Gefühlen und meinen Gefühlen qualvoll zu ersticken. Sie wischte sich mit ihrem grazilen Zeigefinger unter ihrer Nase entlang und schluchzte schniefend.
Wie sehr wünschte ich mir, die salzigen Perlen ihrer von Tränen benetzten Augen mit meinen Lippen aufzunehmen, sie zu trösten oder sie wenigstens zu umarmen.
Aber ich konnte es nicht.
Es ging einfach nicht.
»Es ist nur zu Deinem Besten!« lallte es höhnisch aus dem eisigen Nichts.
Ich wollte Isabelle, aber wieso konnte ich ihre Liebe und ihre Umarmungen manchmal nur ertragen?
Wie ein Tiger in seinem zu kleinen Käfig lief ich vor den Gitterstäben meiner Seele auf und ab. Mein Herz stolperte beim verzweifelten und doch vergeblichen Versuch, mit heftigen, sich selbst überschlagenden Pulsschlägen meine Liebe zu ihr hinaus zu pumpen.
Die Gitterstäbe standen zu fest und hielten dicht, so sehr ihre Augen auch flehten.
Jeder ihrer Wimpernschläge schnürte das Vakuum enger um meine nach Luft ringende Liebe.
Alles tat weh, viel mehr als alles.
Dann war sie schluchzend aufgestanden und wortlos gegangen.
Sie ließ nicht nur mich zurück, sie ließ einfach alles zurück.
Und ich war sitzen geblieben.
Stumm schrie ich immer wieder ihren Namen heraus, aber sie würde mir nicht mehr antworten.
Sie würde es nicht mehr wollen, es war vorbei.
Isabelle war fort.
Ihr Platz fühlte sich immer noch warm an, und meine Tränen konnten diese Liebe nicht zum Erkalten bringen.
Früher hatte ich nie geweint. Jetzt wollte ich so sehr, dass sie noch vor mir sitzen würde, auf dem grünen Samtkissen am Boden, zart lächelnd aus ihren großen Augen schauend, mit behutsamer Zärtlichkeit und verspielt eine Haarsträhne um ihre Finger wickelnd, um sie dann aus ihrem Gesicht zu streichen.
Ich liebte Isabelle. Ich hätte es ihr sagen und zeigen müssen! Aber darf man einem Menschen, den man liebt, auch gleichzeitig vertrauen? Meine Erinnerungen reichten dazu nicht aus.
Aber Isabelle musste es doch gefühlt haben, meine Gedanken, mein Verlangen nach ihr ...
Es hatte sich alles wie in einem Film abgespielt, und dieser verdammte Film sollte endlich aufhören und gefälligst ein »Happy-End« haben, so wie alle anständigen Liebesfilme.
Aber dieser Film ließ sich nicht abstellen, und meine Tränen des Schmerzes, der Liebe, der Sehnsucht und der Wirklichkeit gruben sich ihren Weg durch mein Gesicht.
Mühsam versuchte ich, meine Gedanken und Gefühle klar zu kriegen und den Weg zum Plattenspieler zu finden, um diesem sinnlos gebrauchten Tag noch irgendeine sinnvolle Wendung zu geben.
Liebeskummer kann durchaus sinnvoll sein, und er hat gewiß auch seine tiefe Berechtigung, aber er nervt genauso sehr wie er schmerzt, weil er alles lähmt und man die verlorene Liebe erst durch den Verlust neu entdeckt oder sogar nur durch den Verlust diese Liebe überhaupt erstmals spürt.
Irgendwie schaffte ich es, mich zu erheben.
Von tonnenschwerer Leere niedergedrückt durchfingerte ich meine Schallplatten, um mein auf Liebeskummer maßgeschneidertes Stück zu finden, welches meinen untröstlichen Gemütszustand in sich aufnehmen und ihm eine Stimme geben könnte. Es würde meine Sehnsucht zwar ins Unermeßliche steigern, sollte aber helfen. Früher gab es ein paar Freunde, die erzählten so was. Sie kannten sich wohl ziemlich gut in Liebesdingen aus, zumindest redeten sie viel darüber. Mir blieb mehr das interessierte Zuhören und manches klang ganz brauchbar.
Hatte man seine musikalische Auswahl getroffen, wäre der Weg frei für das ungehemmte Zerfließen in Selbstmitleid. Danach das nahezu vollständige Erlahmen der Arbeitsfähigkeit, einhergehend mit dem Erliegen jeglicher Hygiene-Motivation und der theatralischen Erkenntnis der verflossenen Liebe als DIE eine, absolut große und wahre Liebe.
Zur Erlangung der angemessenen sozialen Aufmerksamkeit im gesellschaftlichen Umfeld lässt sich dieses komplexe Pathos-Gesamtpaket außerdem äußerst effektiv durch das laute Hören von Musik abrunden... das zerbrochene Herz mußte schließlich tränenreich wieder zusammengepuzzelt werden, auch wenn ich mich fragte, wofür und für wen.
Der Pathos des Selbstmitleids triumphierte. Ich litt Höllen-Qualen und ich ging aufs Ganze. Es landete »Unchained Melody« von den Righteous Brothers auf dem Plattenteller.
Eine der besten Entscheidungen, die diese schweren Stunden für mich treffen konnten...
»… Oh … my love … my darling … I’ve hungered for your touch …« schluchzte es triefend aus dem Lautsprecher.
Diese nicht nur erstklassig gesungene, sondern auch unverhüllt kitschige und gerade deswegen so erstklassige Rock’n’Roll –Schnulze beantwortete nicht nur nahtlos sämtliche Fragen meines todunglücklichen Daseins, sondern steigerte meinen Liebes-Schmerz noch einmal dramatisch – es war großartig!
Die eisige Decke der Vergangenheit wurde auf der Überholspur ausgebremst.
Tränen, Verzweiflung, Selbstmitleid und das Glorifizieren der verlorenen Liebe..., all das konnte ich jetzt nochmals ungehemmt beweinen, betrauern und beschmerzen.
Meine Erinnerung rebellierte mit vehementer Ratlosigkeit, schaute schließlich betreten weg und schwieg mit eisigem
Hohn.
Das Lied war viel zu früh zu Ende, meine Bilder der Liebe blieben.
Aber waren es auch ihre?
Es gab diese lähmenden Momente, ihre stillen Tränen der Einsamkeit, auf die ich nur mit Sprachlosigkeit reagierte.
Isabelle saß im Schneidersitz vor mir und lächelte traurig. Ich wollte sie berühren, ihre Haut riechen, aber meine Sinne trieben haltlos in der trüben Gefühls-Leere, und mir ging es noch viel schlechter als vorher. Liebeskummer ist eine beinharte Realität, dabei überhaupt nicht alltagstauglich und vor allen Dingen unmöglich zu ignorieren...
Zum Teufel damit!
Sollten doch alle an meinem Liebeskummer teilhaben, der so musikalisch punktgenau von den Righteous Brothers getragen wurde!
»Oh … my love … my darling …« dröhnte es nun entschieden lauter nicht mehr nur durch meine kleine Wohnung.
Wahrscheinlich fielen sich mittlerweile im Treppenhaus alle Hausbewohner inniglich in die Arme.
Danach folgte Led Zeppelins Jahrhundert-Ballade ›Stairway to Heaven‹, natürlich dreimal hintereinander. Anschließend drängte sich Led Zeppelin mit ›Black Dog‹ auf den Plattenteller.
»Hey, hey Mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove…« kreischte Sänger Robert Plant, bevor die Band, unnachahmlich angetrieben von Schlagzeuger John Bonham, dieses Stück in die Rockgeschichte hämmerte.
Die wilde Rückkehr meiner Seele und meines Herzens löste schlagartig schieres Entsetzen in mir aus.
Also sofort zurück zu den Righteous Brothers… und dieses Mal volle Pulle! »OH … MY LOVE … MY DARLING …« brüllte es nun bis zum Verzerren aus der Box, durch das Haus, hinaus auf die Straße und über die Stadt.
Reflexartig stieß ich unwirsch gegen den Tonarm auf dem Plattenteller. »… MY DAR … …« verabschiedete sich mit einem laut keifenden Kratzen ins musikalische Exil. Es reichte.
Mir ging es immer noch saumiserabel, aber das Leben mit seinem ganzen Schmerz begann dennoch wieder in musikalisch korrekten Bahnen zu pulsieren, um in deren Sicherheit hinein zu schlüpfen. Die Plattennadel hatte den Rock’n’Roll-Kitsch weggekratzt und George Thorogoods Version von ›One Bourbon, one Scotch, one Beer‹ vertrieb mit seinem gnadenlosen Boogie, acht Minuten und sechsundzwanzig Sekunden lang, meine geistige Liebeskummer-Lähmung.
Ich musste raus ..., aber nicht, um in irgendeiner Bar zwei Whisky – einen Bourbon und einen Scotch – anschließend mit einem Bier hinunter zu spülen...
Ich mußte einfach raus, um nicht mit den nächsten Atemzügen mein elendiges Leben auszuhauchen.
Mühsam rappelte ich mich auf, zwängte meine Füße in die Turnschuhe und griff mit kraftloser Entschlossenheit nach meiner Jacke.
Ich schaffte es ohne Zwischenfälle die Treppen hinunter und trat vor die Haustür. Draußen war es dunkel und naßkalt, trotz des Frühlings, Anfang Mai. Es hatte geregnet und ich schaute in einen mondlosen, aber sternklaren Nachthimmel.
Ich fror und zitterte in Schauern am ganzen Körper. Die vielen Tränen hatten mich körperlich und seelisch ausgemergelt, und der Heulbojen-Gesang der Righteous Brothers hatte mir den letzten Rest abverlangt.
Ich holte tief Luft und fühlte erneute Tränen in mir hochsteigen. Meine Augen brannten, aber ich ging nach vorne und nicht zurück in die Wohnung.
Hinter mir fiel die Tür ins Schloß, und ich stand wie betäubt auf dem Gehweg.
»Guten Abend, Monsieur«, hörte ich von gegenüber eine mir vertraute, freundlich warm klingende Stimme. Mein verschwommener Blick erahnte eine menschliche Silhouette, aber mein Gehör täuschte mich nicht.
Es war Djamal, der Inhaber des kleinen Lebensmittel-Magazins an der Ecke auf der anderen Straßenseite.
Anfang der sechziger Jahre, während der Kriegswirren in Algerien, war er als kleines Kind mit seinen Eltern nach Paris gekommen. Dort galt es zwar auch, gerade für Algerier, harte Lebensbedingungen zu meistern, aber sie waren dort sicherer als in ihrer Heimat, worüber sie sehr froh und dankbar waren. Djamals Vater Faruk ernährte die Familie als Straßenarbeiter. Sie lebten in sehr beengten Verhältnissen im Pariser Arbeiterviertel Belleville, wo Djamal seine Kindheit und Schulzeit verbrachte. Er war das jüngste von fünf Kindern. Sie teilten sich mit acht Personen eine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung, und seine Mutter Rana kümmerte sich liebevoll um die Kinder und lachte viel mit ihnen. Sie waren eine fröhliche Familie. Nachdem er die Schule beendet hatte, arbeitete Djamal, wie sein Vater, als Straßenarbeiter.
Irgendwann, an irgendeiner Straßenbaustelle, als er mit Schaufel und Spitzhacke auf einem Gehweg inmitten aufgestapelter Pflastersteine eine tiefe Grube ausschachtete, lief ihm Azzedine über den Weg.
Es war Liebe auf den ersten Blick.
Als er dann mit Azzedine seine eigene Familie gründete, zogen sie in den Pariser Vorort La Garenne Colombes, weil ihm ein Cousin seines Vaters, der sich zur Ruhe setzen wollte, sein kleines Geschäft zur Übernahme angeboten hatte. Die junge Familie nahm das Angebot dankend an. Das Leben war hier etwas einfacher und beschaulicher, die Wohnungsmiete günstiger und der Straßenverkehr außerdem weniger gefährlich für die Kinder. Djamal fegte, wie jeden Abend und Morgen, den Gehweg und Eingangsbereich vor seinem kleinen Magazin. Das scharf bürstende Geräusch seines Reisig-Besens hallte zwischen den Hauswänden und erfüllte die ansonsten menschenleere Straße.
Ich erwiderte seinen Gruß nicht und schaute nur wortlos zu ihm hinüber. So freundlich es mir mein Gemütszustand ermöglichte, winkte ich mit einer fahrigen Handbewegung zurück.
Ich brachte sogar ein kurzes Lächeln zustande und wollte eigentlich stillschweigend weitergehen.
»Hey, Gottfried! Er kann nichts dafür, dass es dir so schlecht geht – er hat dir nichts getan,« schob es sich in meine trübsinnigen Gedanken und meine vom schlechten Gewissen gesteuerte Höflichkeit drängte mich mit schweren, schlurfenden Schritten hinüber auf die andere Straßenseite, zu Djamal. Sein Geschäft lag ebenerdig in einem Eckhaus an der Einmündung zur Rue Colbert, schräg gegenüber von meinem Hauseingang. Das war sehr komfortabel, denn ich brauchte immer nur über die Straße zu fallen, wenn ich etwas benötigte.
Djamal kannte fast jeden im Viertel, und seine immer freundliche Art war beliebt. Sein kleiner Laden war ein steter Treffpunkt lebhaft miteinander plaudernder Anwohner der näheren Umgebung, die dann in kleinen oder manchmal auch größeren Gruppen vor oder in seinem Geschäft zusammen standen und den neuesten Tratsch aus Nachbarschaft und Weltpolitik austauschten. Vom frühen Morgen bis manchmal sogar tief in die Nacht traf man ihn in seinem kleinen Laden an der Straßenecke an, und er war immer freundlich, immer gut gelaunt und offen für einen kleinen Plausch.
Nie beklagte er sich und nie erlebte ich ihn krank.
Seiner Familie galt seine ganze Liebe.
Sein kleines Geschäft war sein ganzer Stolz, für das er hart arbeitete, um seine Familie ernähren zu können. Wenn er neue Waren für seinen Laden besorgte oder andere Dinge zu erledigen hatte, vertrat ihn Azzedine. Die beiden hatten zusammen vier Kinder im Alter von vier bis neun Jahren, alles Mädchen.
Azzedine war eine bildschöne Frau, in deren Gesicht sich allmählich der anstrengende Familien-Alltag einzugraben begonnen hatte. Sie blieb dennoch bildschön. Im Gegensatz zu vielen ihrer weiblichen Landsleute band sie sich kein Kopftuch um, es sei denn, das Wetter war kalt oder es regnete. Sie trug ihre langen, fast tiefblau schimmernden schwarzen Haare meistens offen und mit anmutigem Stolz. Nach Schulschluss alberten ihre vier Töchter fröhlich lachend und spielend im Laden oder auf dem Bürgersteig vor dem Geschäft herum. Azzedine und Djamal ermahnten sie ab und an kopfschüttelnd und liebevoll lächelnd, aber auch zur Mäßigung, wenn es etwas zu wild wurde. Manchmal, wenn sie sich unbeobachtet wähnten, tauschten sie kleine, liebevolle Zärtlichkeiten aus, streichelten einander sanft über die Wangen oder gaben sich auch mal verstohlen ein Küsschen. In der Herkunfts-Kultur ihrer Eltern war so etwas in der Öffentlichkeit verpönt, aber man lebte ja in Frankreich, in Paris, in der Stadt der Liebe.
Ich betrat das kleine Magazin. Djamal hielt mit dem Fegen inne, lehnte seinen Besen an eine der ausgestellten Obst- und Gemüsekisten, folgte mir und trat hinter seinen Verkaufstresen. Nach all den Jahren war selbst in diesem kleinen Schritt noch keine gedankenlose Routine erkennbar. Djamal zelebrierte dieses Einnehmen seines Platzes immer noch mit sichtlich ungebrochenem Genuss, und diese Freude übertrug er in einer unaufdringlichen Art und Weise überall im Verkaufsraum und auf die Kundschaft. Man kaufte einfach gerne bei ihm ein, auch, wenn es bei ihm etwas teurer als im Supermarkt war, der sich ein paar Straßen weiter befand. Aber dafür fand hier das Leben statt, und das konnte man für keinen Preis der Welt kaufen.
»Haben Sie die Musik so laut gehört, Monsieur Gottfried?« fragte mich Djamal. Ich nickte nur bejahend.
»Ich mag dieses Lied, Monsieur Gottfried. Es ist schön, eine schöne Melodie.« Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet! Ich war überrascht, denn mit keiner Silbe erwähnte er die brutal hohe Lautstärke, die mindestens straßenbeschallend gewesen sein musste,... kein Wort der Beschwerde,...nichts dergleichen.
Djamals innere Ruhe und sein Lebensglück waren beneidenswert, weil es ihm trotz der täglichen harten Arbeit eine solche Gelassenheit bescherte. Ich mochte ihn vorher auch schon, aber jetzt erst richtig.
»Monsieur Djamal…, « begann ich zögerlich, »… wir kennen uns doch schon eine ganze Weile…, wollen wir nicht ›Du‹ zu einander sagen?«
Djamal lächelte und reichte mir zur Antwort die Hand: »Gern!« Mit einem herzlichen Händedruck besiegelten wir das »Du«.
Dann deutete ich auf die Zigaretten im Regal hinter ihm, und er gab mir eine kleine Schachtel französischer, filterloser Gauloises und eine Packung Streichhölzer. Er sah mich mit einem leicht verwunderten Gesichtsausdruck an: »Was ist mit dir? Du hast doch noch nie Zigaretten bei mir gekauft. Es geht dir nicht gut, nicht wahr?«
»Leider nein«, entgegnete ich matt.
»Was fehlt dir denn? Bist du etwa krank?«
»Die Liebe, sie fehlt mir…« sagte ich und sah ihn traurig an.
Djamal musterte mich mit einem Blick der Anteilnahme und sagte nur:
»... Isabelle ...?«
»Ja ...,« nickte ich und kämpfte gegen erneut aufsteigende Tränen an.
Ohne weitere Worte zu wechseln legte ich ihm das Geld für die Zigaretten auf den kleinen Tresen. Er öffnete eine Schublade unter dem Tisch, und die Münzen fielen klackernd hinein. Beim Verlassen seines Geschäfts drehte ich mich noch einmal zum Abschied um, und Djamal wünschte mir mit einem aufmunternden Lächeln alles Gute. Ich lächelte zurück.
Draußen folgte ich der Rue Pierre Brossolette, die entlang der Bahngleise verlief. Ich schaute nach oben und sah mein Zimmerfenster. Gleichgültig stellte ich fest, daß drinnen noch das Licht brannte und ein Fensterflügel nur angelehnt war. Ich wohnte im vierten Stock und zu holen gab es bei mir nichts, außerdem war es mir egal.
Ich nahm eine Zigarette aus dem Päckchen, steckte sie an und inhalierte tief. Der harte Rauch brannte in meiner Lunge. Ich unterdrückte reflexartig einen starken Hustenreiz, der alles nur noch verschlimmert hätte. In meinem Mund und Rachen breitete sich ein Geschmack aus, als hätte ich in einen verkokelten Balken gebissen.
Aber ich rauchte tapfer weiter.
Die Sehnsucht zerfraß mir bereits mein Herz, als Zugabe fühlte ich mich jetzt auch noch wie innerlich ausgeräuchert. Alles um mich herum, mein Dasein, geschah wie ferngesteuert. Ich wurde gegangen, vorbei an der kleinen Bäckerei und dem Friseur-Laden, dann wurde ich die Straße überquert, die Eisenbahnbrücke wurde mühsam bezwungen, und der Bahnsteig 2 landete unter meinen Füßen, wo man die Bahn in die City von Paris besteigen konnte.
Der Bahnhof lag in bequemer Sichtweite unter meinem Wohnungsfenster. Die rumpelnden Züge und mich trennten nur vier Stockwerke mit knarrenden Holztreppen und wenige Straßenmeter Fußweg.
Das quietschende Bremsen der einfahrenden, das laute Dröhnen der abfahrenden Vorstadtzüge und RER-Bahnen war tagsüber alle paar Minuten zu hören, abends weniger. Nachts zwischen halb drei und vier Uhr ruhte der Bahnhof der Pariser Vorstadt »La Garenne Colombes«.
Mich störten die Züge nie, ganz im Gegenteil.
Ich mochte diesen Teil meines neuen Lebens, besonders wenn es dunkel war und jedes Geräusch wichtig wurde, weil es sich nicht mehr mit dem Tageslärm vermischte. Die zischend öffnenden Türen, die bedachtsamen oder stolpernden Schritte der aussteigenden Nachtschwärmer, das Klacken der Absätze, das Reißen eines Streichholzes oder Klicken eines Feuerzeuges, welches die eigene Ankunft oder das Weiterfahren des Zuges mit dem Anzünden einer Zigarette quittiert. Die schabenden Schritte auf den Treppenstufen der Eisenbahnbrücke, das Bellen eines Hundes irgendwo in der Ferne oder das Miauen einer Katze im Hinterhof um die Ecke... ich liebte diese geräuschvolle Kulisse des Lebens.
Nach einer gefühlten Ewigkeit näherte sich ratternd die RER-Bahn. Eine Ewigkeit voller schwermütiger Gedanken, die nicht aus dem Herz entweichen wollten, zu sehr zerrte in mir die Liebe nach Isabelle.
Henri hatte also tatsächlich Recht gehabt.
Henri?
Wieso kam ich jetzt bloß auf Henri?
»Ja, ... ich weiß, Henri«, sagte ich im gedanklichen Dialog zu mir selbst:
»Es ist nicht gutgegangen mit uns beiden ...«
Aber ob es wirklich an unseren Sternzeichen lag, wie er damals orakelt hatte?
Ich wußte nur so viel: Mit Isabel war es anders geplant und gehofft gewesen, … wenn ich denn überhaupt einen Plan oder eine Hoffnung gehabt haben sollte ...
Nur spielte das jetzt überhaupt keine Rolle mehr.
Die Metro hielt an, die Türen öffneten sich zischend. Der Sog dieser geöffneten Stahlschlange nahm mich in ihrem Inneren auf und plazierte meine willenlose und weinerliche Existenz auf einer muffig riechenden, leicht speckigen Kunstleder-Sitzbank.
Die ratternde Reise auf den Gleisen zu dieser einzigartigen Großstadt schüttelte meinen guten Freund Chandon in meine Gedanken.
Unsere Freundschaft begann zufällig in einem Pariser Bistro-Café, ausgelöst durch einen umgefallenen Stuhl.
Zufällig?
So richtig mag ich nicht an Zufälle glauben. Sie erweisen sich doch meistens als Verkettungen von Zufälligkeiten, deren jeweilige Geschichten beinahe zwangsläufig, aber zufällig zusammengeführt werden, was dann wiederum vom Zufall abhängt.
Damals wurde in diesen Pariser Bistros noch viel geraucht, und beim Betreten empfing einen diese unvergleichliche Geruchs-Melange aus Pastis, Rotwein, Espresso und dem unparfümierten Tabakqualm der französischen Gauloises oder Gitanes.
Die kleinen blauen Zigarettenschachteln mit dem Gallier-Helm oder die flachen, blauen, aufschiebbaren Pappschachteln mit der abgebildeten Tamburin spielenden und tanzenden Zigeunerin, waren als französisches Kulturgut überall erhältlich.
Ich liebte diesen süßlich-herben, schweren Geruch und die leicht hallige Akustik der Bistros mit ihren gefliesten Böden, auf denen nach Feierabend die graue Asche, ausgetretene Zigarettenkippen, zusammengeknüllte Papierservietten, leere Zuckertütchen, heruntergefallene Baguette- oder Eierschalenreste vom Kellner, manchmal auch vom Patron selbst, mit Besen und Kehrblech zusammengefegt wurden. Aber nicht selten wurde der ganze Boden-Unrat auch mit Schwung über den Gehweg in den Rinnstein gefegt, um dort den im Morgengrauen auftauchenden, sich träge vorwärts schleichenden, alles in sich aufsaugenden Kehrmaschinen, gelenkt von dösenden, stumpf und müde dreinblickenden Fahrern, zum Fraß vorgeworfen zu werden.
Damals betrat ich um die Mittagszeit das Bistro-Café Les Colonnes in der Rue du Général Leclerc, nahe der Metro-Station Issy-les-Moulineaux.
Drinnen war es ziemlich voll und laut.
Die französische Lebhaftigkeit und legere Lebensart vermischte sich mit dem geschäftighektischen Geschirr-Geklapper, übertönt vom kreischenden Zischen der Kaffee-Maschinen beim Zubereiten von Espresso und Milchschaum.
Ich schaute mich nach einem freien Platz um.
Ich verspürte keine Lust auf einen Kaffee im Stehen an der Theke, auch wenn der Verzehr von Getränken oder essbaren Kleinigkeiten dort preiswerter als auf einem der Sitzplätze war. Am teuersten war es draußen, an einem der Tische an der Straße, wegen der längeren Bedienungs-Wegstrecke.
An der Theke hingegen erfuhr man die Vorzüge einer schnörkellos direkten, jede Überflüssigkeiten vermeidenden Bedienung.
Entweder wurden das Getränk oder der kleine Imbiss resolut knackig vor dir abgestellt oder rutschten mit viel Schwung und punktgenauem Stopp zu deinem Platz. Man brauchte nur noch die Hand zu senken, einzutauchen und umzurühren, wenn man bereits einen Löffel in der Hand hielt oder einfach reinzubeißen. Am Fenster, an einem der kleinen runden Tische, entdeckte ich einen freien Platz. Ich bahnte mir einen Weg durch die eng sitzenden, schwatzenden, flirtenden, lesenden und lachenden Bistro-Gäste und blieb am Tisch hinter dem freien Stuhl stehen. Gegenüber saß ein etwas unscheinbar und älter aussehender Mann. Er schien tief in seine Gedanken versunken und schaute seitlich nach draußen. Seinen dunklen, grobstoffigen Mantel hatte er nicht abgelegt, ebenso wenig seine Baskenmütze. In seinen Händen hielt er behutsam eine Postkarte. Vor ihm auf dem Tisch stand auf einem dickrandigen Unterteller eine leergetrunkene Espresso-Tasse, an deren Rand sich braune, verkrustete Spuren heruntergelaufenen Espressos abzeichneten.
Inmitten dieser lärmenden, lebhaften Umgebung strahlte der Mann eine seltsame aber angenehme Ruhe aus, beinahe wie eine Oase der Stille.
Ich fragte ihn, ob der Platz an seinem Tisch noch frei wäre.
Sofort tauchte er freundlich lächelnd aus seinen Gedanken auf und bot mir mit einer einladenden Geste den freien Stuhl an. Ich setzte mich dankend und bestellte einen doppelten Espresso.
Mein Gegenüber orderte das Gleiche.
Wir schauten durch das Fenster und verfolgten schweigend das geschäftige Treiben draußen auf der Straße. Vor uns stauten sich ungehalten hupende Autos, die nicht weiterfahren konnten, weil ein Lieferwagen auf der Fahrbahn parkte. Sein Fahrer, ein untersetzter Mann in Latzhose, mit schmutzig-gelb erkaltetem Stummel einer filterlosen Maispapier-Zigarette zwischen seinen Lippen, stand vornübergebeugt, vom Hupkonzert gänzlich unbeeindruckt, in der geöffneten Hecktür seines Vehikels und lud in aller Seelenruhe seine Warenkartons aus. Wieder andere Autos hupten nervös, weil die Vorderleute nicht zügig genug durch den Verkehr drängten. Klingelnde und laut knatternde Mopeds suchten im Slalom schlängelnd ihren Weg durch die überfüllten Fahrspuren. Fußgänger, selten mal ein Radfahrer, passierten den Bürgersteig vor unserem Fenster. Die meisten Passanten gingen eiligen Schrittes vorbei. Einige hielten Aktentaschen in der Hand, manche hatten lange Papprollen unter den Arm geklemmt und hetzten zum nächsten Termin. Ein Grüppchen von jüngeren und älteren Frauen stöckelte, mit ihren an feinen Riemchen in der Armbeuge hängenden Handtaschen, fröhlich schwatzend an uns vorbei.
Etwas weiter weg schien ein eng umschlungen flanierendes Liebespaar das hektische Geschehen um sich herum komplett auszublenden.
Das Geschenk der Liebe, eine wohltuende Ausnahme angesichts der rastlos hastenden und eilenden Passanten-Gemeinde.
Einige übertrieben es mit der Terminhetze und rempelten rücksichtslos einen auf seinen Handstock gestützten vorsichtig dahintappenden Greis an. Andere verfehlten im Sprint gegen die Zeit nur um Haaresbreite eine mit schweren Tragetaschen bepackte, gebeugt gehende alte Frau, die dadurch fast zu Fall kam.
Die alten Leute hatten unendlich viel Zeit und Würde in ihren Bewegungen und erschienen wie lebende Mahnmale wider die Hetze des geschäftigen Lebens.
»Was für ein irrsinniger Wahnsinn«, dachte ich beim Betrachten dieser Szenerie auf dem Trottoir vor mir.
Im selben Moment sprang unvermittelt mein Tischnachbar auf. Dabei schleuderte sein Stuhl in die Sitzgruppe hinter ihm. Das allein wäre nicht so schlimm gewesen, wenn nicht in diesem Augenblick eine Pelzmantel-Frau mit überladener Figur und üppig aufgetragenem Make-up und Wimperntusche ein etwas zu großes Stück Torte auf der zu kleinen Kuchengabel balanciert hätte, um damit ihren apricotfarbenen Pudel zu füttern.
Der schwungvoll umkippende Stuhl versetzte der Frau einen Stoß, sie erschrak und das Stück Torte krönte den mit rosa Schleifchen versehenen Fellschopf des Pudels mit einer klebrig-süßen Krone aus Zucker und Sahne.
Die Frau kreischte auf, und für einen Augenblick verstummte fast alles im Bistro. Der Schrei erschreckte meinen aufgesprungenen Tischnachbarn, er drehte sich mit wirbelndem Mantel um.
Natürlich befand sich daraufhin mit Schlagsahne verzierter Kaffee auf dem zart violetten Kostümrock der Dame mit Pudel. Mit vor Entsetzen entgleisten Gesichtszügen und hysterisch nach Luft japsend fuhr die Dame hoch, und der Pudel purzelte zu Boden. Laut knisternd und funkensprühend unterstrich der synthetische Kostümstoff jede ihrer Bewegungen. Im selben Moment war die sahnige Torten-Krone als Beute in der apricotfarbenen Hundeschnauze verschwunden.
Mit tief gesenktem Blick und verlegen um Worte ringend entschuldigte sich mein Tisch-Geselle bei der fassungslosen Frau für sein Malheur. Mit hilflos ungelenken Bewegungen versuchte er, die Sahne- und Kaffee-Flecken wegzuwischen. Der Reinigungserfolg war nicht einmal mäßig, dafür waren die Flecken jetzt großflächig verteilt.
Mit einem wutschnaubenden »Weg hier!« wischte die Pelzmantelfrau den mit Lappen und Handtuch herbeigeeilten Kellner zur Seite.
Mein Tischnachbar unterbrach abrupt seine entschuldigenden Gesten. Mit ungläubigem Blick starrte er die Dame an:
»… Nati …, Du? … Du bist es tatsächlich! … Daß wir uns so wiedertreffen würden …«
Weiter kam er nicht, zu gewaltig schüttelte ihn eine Lachsalve. Mehr zu sagen war aber auch gar nicht möglich, denn Pelzmantel und rosa Dutt wurden bereits von der bekleckerten Dame mit kurztaktigen Schritten zum Ausgang gestöckelt.
Der zuvor ungehalten weggewischte Kellner schickte sich an, mit der unbeglichenen Rechnung in der hocherhobenen Hand hinterher zu eilen, aber meine Tischbekanntschaft signalisierte, die offenen Kosten von Pudel mit Dame zu begleichen.
Die Situation hatte sich wieder beruhigt, und das zwischenzeitliche Raunen der Gespräche erreichte bald wieder die gewohnt lebhafte Lautstärke. Mein Tischnachbar hob den umgestoßenen Stuhl auf und setzte sich mit grinsenden Gesichtszügen wieder an den Tisch.
Ich sagte nichts, sondern schaute ihn nur fragend an.
Nach einer Weile begann er, anfangs zögerlich, zu erzählen:
»… meine Ex-Frau, … Renate, … sie wollte immer, dass ich sie Nati rufe, weil es so süß und reizend nach kleinem, zierlichen Mädchen klingt. Mich nannte sie ›Schandi‹ …«
»Schandi?« unterbrach ich meinen gerade in Redefluss gekommenen Tisch-Partner.
»Na, weil … oh Pardon, wie unhöflich von mir …, gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Mein Name ist Chandon, ich heiße Chandon Marôt, « entgegnete er und streckte mir über den Tisch seine Hand entgegen. Ich ergriff sie und stellte mich ebenfalls vor:
»Ich heiße Gottfried Joseph. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen.«
Chandon zog die Stirn ein wenig kraus und überlegte: »Gottfried …, ich kenne den Namen …, in Frankreich heißt es Geoffroi ...«
»Geoffroi,« dachte ich, »… ja, das klingt auch nicht schlecht, es klingt sogar richtig gut …«.
Chandons Händedruck war freundlich, fest und warm.
»Wir sagen Du?« fragte ich ihn.
»Aber ja, selbstverständlich ...,« antwortete er lächelnd.
Chandon erzählte mir seine Geschichte mit Renate.
Er hatte sich, einige Jahre vor unserer Begegnung im Les Colonnes wegen seelischer Grausamkeit von ihr scheiden lassen, und ausgerechnet der apricotfarbene Pudel habe ihm »buchstäblich sein Leben zurückgegeben«.
Renate flirtete und tüterte ständig mit diesem bis zur Dekadenz verwöhnten Pudel herum, dass es nicht mehr zu ertragen war. Aber nicht nur deswegen hatte sich Chandon immer wieder gefragt, wie er eigentlich und überhaupt in diese Ehe hineingeraten konnte.
Mehrere für Chandon ungünstige Faktoren bildeten im Zusammenhang eine knüppelharte Konstellation:
Renates Vater war ein roher, bulliger, noch dazu großer und humorloser Mann. Als Chandon vor dem Standesbeamten stand, spürte er, wie der gefährlich warme Atem seines künftigen Schwiegervaters stoßweise in seinem Nacken und Hemdkragen kondensierte.
Die Lage hinter Chandon war damit also geklärt. Die Beantwortung der Frage des Standesbeamten vor ihm jedoch noch nicht, bis Renate ihren spitzen Stöckelschuh-Absatz auf seinem Fuß fixierte. Sie bohrte gnadenlos, mit einer unbarmherzigen Druck- und Zielfestigkeit. Ihr Gewicht war nicht ohne, ihr Schuh noch dazu aus knallrotem Knautschlack.
Chandon beugte sich, vom physischen und optischen Druck traumatisiert.
»Es ist wirklich schwer vorstellbar, nicht wahr?« schob Chandon ein, als er meinen immer stärker zweifelnden Gesichtsausdruck registrierte. »Irgendwie kam ich aus dieser ganzen Nummer nicht mehr heraus ...,« beteuerte er.
Dann schaute er mich mit eindringlichem Blick an:
»Das war alles wie ein lähmender Albtraum, das kannst Du mir wirklich glauben. Es war ein verdammter Albtraum...«
Der Standesbeamte hatte ihm also die eine, alles entscheidende Frage gestellt und schaute ihn fragend und mit bohrenden Blicken an.
»Ja …«, preßte der gemarterte Bräutigam mit letzter Kraft heraus.
Der Druck auf seinem Fuß verpuffte schlagartig, der heiße Atem in seinem Nacken kühlte ab, und Chandon fiel erleichtert in sich zusammen.
Anschließend rammte Renate ihm bei der nachfolgenden Ringzeremonie mit robuster Zärtlichkeit den Ring bis zum Handflächen-Anschlag auf den Finger.
»Ich dachte einen Moment wirklich, meine Hand wäre bis zum Handgelenk aufgerissen«, erinnerte sich Chandon an die Tortur.
Unwillkürlich musste ich, trotz meines Mitgefühls, gleichzeitig grinsen. Laut Chandons Beschreibung war Nati ein weiblicher Schrecken mit roten Lippen, orangeroten Haaren, apricotfarbenem Pudel, rot lackierten Stöckelschuhen und einem Vater, mit dem man sich überall sicher fühlen konnte, wenn man auf der »Du-bist-mein-Freund-Seite« stand.
Zerknirscht und humpelnd folgte er ihr in die Ehe. Schuld daran waren das schlechte Wetter und eine Taxifahrt.
Er hatte ihr einen Platz im Taxi angeboten, weil es so stark regnete und Taxis deswegen nur schwer zu bekommen waren.
Und es war das einzige Mal in seinem Leben, daß Chandon es bitter und nachhaltig bereute, Kavalier gewesen zu sein.
Nach seinem Jawort ging es nur noch ums Überleben.
Die Ausheilung seines stilettierten Fußes schritt stetig voran und damit auch die Sehnsucht nach einer Rückkehr in die Freiheit. Und Chandon erkannte in dem Pudel nicht die einzige, aber dafür die beste Chance zur Wiedererlangung seines alten Lebens.
Renates Hingabe für diesen verwöhnten Pudel war extrem und nicht nur schwer, sondern eigentlich gar nicht auszuhalten.
Die nächsten Monate ließ sich Chandon als beleidigter, verstoßener und eifersüchtiger Ehegatte fast bis zur Selbstaufgabe gehen. Er flötete »Nati« zuckersüß und so lange, bis es irgendwann nicht mehr weitergehen konnte.
Mit blutunterlaufenen Augenrändern bis zum Mundwinkel, einer nach billigem Wein und Dosenbier übelriechenden Fahne, in schmuddeliger Kleidung, stellte er sie schließlich vor die Entscheidung:
»Entweder der Hund oder ich…«
Renate ließ von ihrem Pudel ab und blickte erschrocken auf. Solche Töne war sie von ihrem »Schandi« nicht gewohnt, und sie fand ihn auf einmal gar nicht mehr so putzig. Qualvolle Minuten spannungsgeladener Angst schlichen dahin.
»… der Pudel …«
Natis Stimme drang aus dem hallenden Jenseits zu ihm durch,
resigniert und gedemütigt drehte sich Chandon um und schlurfte mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern aus dem Zimmer. Er langte kraftlos nach seinem Mantel und schloss wie ein Verstoßener die Haustür hinter sich zu. Kaum vernahm er das zuschnappende Geräusch des Hauseingangs hinter seinem Rücken, riss er die Arme hoch und stieß einen stummen Jubelschrei aus.
»Geschafft! Endlich geschafft! ...«
Dann sank er mit dem Rücken an der Hauswand hinunter und weinte, von lautlosen Tränen geschüttelt. Gleichzeitig fühlte er, wie das Leben und das freie Atmen in ihn zurückkehrten. Die Rolle als gepeinigter Ehemann hatte alles Können von ihm abverlangt.
Die Ehe wurde geschieden.
Chandon und ich saßen nach diesem folgenschweren Ereignis noch lange Zeit zusammen am Tisch im kleinen Bistro in der Rue du Général Leclerc.
Als ich von ihm wissen wollte, warum er denn so unvermittelt aufgesprungen war, wodurch ja erst diese ganze Sahne-Verkettung gestartet wurde, erklärte er mir, dass er das geschäftige und rastlose Treiben auf der Straße beobachtet hatte und sich dabei vorzustellen versuchte, wie es wohl wäre, wenn sich die alte, mit Tragetaschen bepackte Frau oder der am Handstock gemächlich und gebückt dahin schlurfende Greis im normalen Tempo bewegen würden.
»Man würde die anderen Fußgänger, Radfahrer, Mopeds und Autos nur noch als Lichtblitze oder Lichtstrahlen wahrnehmen, … eine ungemein erschreckende Vorstellung, nicht wahr?« führte ich Chandons Gedanken zu Ende.
Chandon war seit mehreren Jahren wieder verheiratet.
»Sie ist meine große Liebe«, sagte er zu mir.
Ich freute mich für ihn.
Die Postkarte, die Chandon bei unserer ersten Begegnung in seinen Händen hielt, hatte ihm seine Frau zugesteckt.
Kurz bevor ich mich damals zu ihm an den Tisch setzte, hatte er sie in seiner Manteltasche entdeckt.
»Ich sitze hier und denke mir, wie gern wär ich bei Dir …, « stand darauf geschrieben.
Gelegentlich, wenn ich das Café Les Colonnes in Richtung Metro-Station verließ, gönnte ich mir einen kleinen Schlenker durch die nahegelegene Rue Marceau, um dem nahezu ununterbrochenen musikalischen Gewitter einer dort ansässigen Schlagzeugschule zu lauschen. Manchmal warf ich auch einen Blick durch die trüben Fenster dieser Hinterhof-Kaderschmiede für die trommelnden Talente aus ganz Frankreich und Europa.
So wurde ich einige Male Zeuge von beeindruckenden Demonstrationen der Kunst des Schlagzeugspielens. Etwa, wenn Gruppen von fünf oder sechs, vor Spielfreude nur so sprühenden Schlagzeugern sich gegenseitig zu Höchstleistungen antrieben. Sie spielten konzentriert und synchron ihre rhythmischen Übungen, oftmals in atemberaubendem Tempo, mit nicht minder atemberaubender Geschicklichkeit. Gerade diese spielerische Leichtigkeit erfrischte mich immer wieder aufs Neue.
Ein lautes Hupsignal riß mich aus meinen Gedanken und holte mich unsanft zurück in die Realität als Fahrgast auf der Flucht vor meiner haltlosen, von Liebeskummer durchtränkten Existenz.
Die einfahrende Metro bremste rumpelnd ihre Fahrt ab. Mit einem lauten Zischen flogen die Türen auf, und ich wurde in die gelb und blau gekachelten Katakomben der Pariser Unterwelt hinaus gespuckt.
Ich ließ mich in eine dieser lehnenlosen Kunststoff-Sitzschalen plumpsen, die auf gekachelten Betonsockeln an den Bahnsteigen vor den röhrenförmigen Fliesenwänden verschraubt waren.
Da saß ich nun und wartete auf gar nichts, nicht einmal auf die nächste Metro.
Meine innerliche Leere brachte nicht einmal mehr sogar keine Traurigkeit zustande und drohte in einem gierigen, alles schluckenden Grau zu verschwinden.
Chandon war so glücklich mit seiner neugefundenen Liebe wie ich unglücklich mit dem Verlust meiner war.
»Henri ist schuld!« lief es mir immer wieder durch den Kopf.
»... Blödsinn!«
Energisch versuchte ich, diesen sich ständig wiederholenden Satz aus meinen Gedanken zu blocken.
Vergeblich.
Ich stand auf, weil ich keine Lust hatte, weiterhin an Henri und seine Prophezeiung zu denken. Vielleicht blieben die Gedanken ja einfach in der Sitzschale liegen, wenn ich mich nur zügig genug entfernte.
Ziellos trieb ich durch das Tunnel-Labyrinth der Metro, aber Henri hatte sich hartnäckig in meine Gedanken geklettet.
Ich blieb vor einem Fahrplan stehen und suchte nach den Anschlüssen zu einer amerikanischen Kirchengemeinde, nahe dem Quai d’Orsay. Dort sollte an diesem Abend ein Konzert einer französischen Blues-Band stattfinden.
Der Weg dorthin war nicht allzu weit, dauerte aber lange genug, um die Gedanken an Henri frei laufen zu lassen und sie dann hoffentlich ein für alle Mal abzustellen.
Die U-Bahn raste heran und bremste mit einem scharfen Quietschen. Die Türen zischten auf und saugten mich in das Innere des Waggons.
Im nächsten Augenblick fiel ich in die typische »Metro-Reise-Apathie«, die alle Passagiere miteinander zu teilen schienen, sobald sich die Metro wieder in Bewegung setzte.
Mein Reisekoma trug meine Gedanken zu Henri.