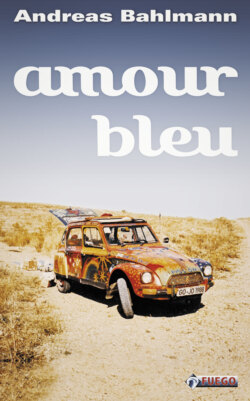Читать книгу Amour bleu - Andreas Bahlmann - Страница 5
ОглавлениеEs war schon lange her und gehörte zu einem anderen Leben, aber die Bilder waren geblieben und mir in jedes meiner Leben gefolgt:
Es war nicht mehr richtig Nacht, aber der Tag mochte auch noch nicht wirklich beginnen.
Es war »Blue Hour«.
Die Zeit zwischen Nacht und Tag, die Zeit der Zwischenwelt, in der alles zusammen fließt und sich vermischt, was sonst voneinander getrennt zu sein scheint oder nur getrennt wahrnehmbar ist.
Das Glück ist melancholisch, die Liebe tief erfüllend und schmerzhaft. Die »Blue Hour« klingt flüchtig, zärtlich, verletzlich, intensiv ... Sie ist einzigartig eigenartig.
Die Geräusche und das Schwarz der Nacht mischen sich in die Klänge und das Strahlen des Tages und zerfließen in eine graue Stille.
Die »Blue Hour« ist die Zeitzone der fiktiven Realität, in der Wirklichkeit und Traum ineinander zu realen Geschichten verschmelzen, um sich in der Fiktion zu verflüchtigen ... und sie besitzt eine mächtige Magie...
Isabelle und ich saßen in einem Frühlokal.
Fast alle der hier anwesenden Gäste waren Übriggebliebene der Nacht. Taxifahrer wie ich, Nachtschwärmer, Glücksspieler, Musiker, Zuhälter, Prostituierte, Dealer und andere Existenzen, die gemeinsam gut und gerne dreihundert Jahre Knast zusammenbrachten.
Henri saß uns gegenüber und trank, in sich versunken, seinen Kaffee.
Seine olivgrüne Parka-Jacke stauchte sich an ihm hoch und der halbgeöffnete Reißverschluss gab sein graues, bartloses Gesicht frei. Ich sah Henri nie ohne diese Jacke. Wahrscheinlich schlief und duschte er sogar in ihr.
Immer wieder fielen Henris Augen träge zu. Er war müde, aber eigentlich war er stets müde, und er sank immer wieder in sich zusammen.
Wenn er etwas sagte, was unerwartet und unregelmäßig vorkam, sprach er mit trägem und entrücktem Blick und wiederholt zufallenden Augenlidern.
Sein Frühstück stand vor ihm auf dem Tisch.
Es bestand aus zwei Brötchen, einem gekochten Ei, einem Glas-Schälchen mit Erdbeermarmelade, zwei Alu-Päckchen mit Butter und einer Scheibe Wurst. Henri döste tief in sich versunken vor sich hin.
Vor ihm dampfte aus einer dickwandigen Tasse sein Kaffee. Der weiße, blütenförmige Papierkranz auf der Untertasse war braunfleckig verfärbt.
Mein Frühstück stand ebenfalls unangetastet vor mir auf dem Tisch, was nur daran lag, dass ich meine Hände nicht zum Frühstücken frei bekam.
Ich war verliebt ... in Isabelle.
Frisch und unsterblich verliebt.
Eigentlich zum ersten Mal.
Und es fühlte sich wie die große Liebe an, trotz meiner bescheidenen Vergleichsmöglichkeiten.
Für Frisch-Verliebte ist es ein ungeschriebenes, aber unumstößliches Gesetz, – es gab hin und wieder, eigentlich mehr in der Vergangenheit, ein paar Freunde, die über die Liebe genau Bescheid wußten ... – daß man erstens mindestens unsterblich verliebt ist und zweitens Händchen halten muß.
Händchen halten nonstop … bis zum Hunger- oder Durst-Tod ... bis daß der Tod uns scheidet.
Also folgte ich diesem Gesetz der Liebe, hielt unsterblich verliebt Händchen und wartete glückselig lächelnd auf meinen Hungertod.
Ich verspürte schon Lust auf einen kleinen Schluck Kaffee.
Das ließ aber der Fahrplan der Liebe nicht zu.
Als nächstes das Küssen.
Das gehört zur Liebe dazu.
Die sinnvolle Ergänzung zum Händchen halten.
Anschließend das glückliche Aneinander-Lehnen der Köpfe.
Zwei Tische weiter brach zwischen zwei Nachtschwärmern ein lautstarker Streit aus. Ich hatte keine Ahnung, worum es ging, und der Grund war nicht aus der Situation heraus ersichtlich, es endete aber sehr schnell damit, dass sie mit den Fäusten auf einander losgingen und sich eine handfeste Prügelei lieferten.
Eigentlich ging es mich ja auch nichts an.
Wichtig war nur, die Konzentration fürs Tief-Verliebt-Sein hoch zu halten und die Sorge um meinen unberührt vor sich hin dampfenden Kaffee, dass er nicht verschüttet wurde, was aber angesichts des sich konstant vergrößernden Aktions-Radius der beiden Streithähne mehr als nur im Bereich des Möglichen lag.
Die Gastwirtin, eine dicke Frau mit schwarz gefärbten Haaren und schwarzer Hornbrille, schob erbost ihren mächtigen Hintern zwischen die beiden Prügelknaben und trieb sie, resolut und keinen Widerspruch duldend, durch den dunkelroten, schweren Samtvorhang zur Tür hinaus, auf die Straße.
Missmutig kehrte die resolute Wirtin an ihren Platz hinter der Theke zurück, um den übrigen friedlichen Gästen ihre Getränke zu zapfen oder einzuschenken.
Sie war chronisch wütend und eifersüchtig auf ihren Mann, ein charmanter Hallodri, der zu ihrem großen Missfallen auch dem eigenen Geschlecht nicht abgeneigt war und sie wegen seiner zahlreichen Affären mit anderen Männern in den Wahnsinn trieb.
Als Gast benahm man sich in ihrem Lokal besser nicht daneben, denn der Zorn auf ihren untreuen Gatten konnte gewaltig sein.
Ich hatte die Gunst des Zwischenfalls genutzt und ganz ohne Liebes-Verlust eine Hand frei bekommen. Als ich nach meiner Tasse langte, um endlich einen heißersehnten Schluck des mittlerweile lauwarmen Kaffees zu nehmen, öffnete Henri, wie von der Bewegung aufgeweckt, seine Augen weit und knurrte kurz und nur ein einziges Mal:
»Das wird nicht gut gehen mit Euch beiden! Mit Euren Sternzeichen wird das nicht klappen …«
Das saß!
Und ich wußte nicht einmal, warum überhaupt, aber es schnürte mir sofort die Kehle zu.
Sternzeichen …, niemals würde ich einen Astrologen oder ein Horoskop nach meiner Liebes-Tauglichkeit befragen, aber ausgerechnet Henris knappe Bemerkung hatte mich bis ins Mark getroffen.
Eine ganze Weile konnte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen, ich konnte an nichts anderes mehr denken als …
»Das wird nicht gut gehen mit Euch …«
Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, und legte meinen Arm ganz fest um Isabelle.
Ich spürte, wie ihr Herz pochte. Der Tod konnte einen jederzeit ereilen ..., aber sie auch?
Ich hätte vor Liebe zerplatzen können.
Isabelle erwiderte meine Umarmung, und aus dem diffusen Nichts einer Zwischenwelt heraus begann sich unaufhaltsam diese Eiseskälte der Angst und Einsamkeit zwischen unsere Hände zu drängen, gesteuert von vertraut lallenden Stimmen der Vergangenheit, ohne Chance zur Flucht.
»Henri ist nicht schuld,« dachte ich beim Aussteigen aus der Metro:
»... aber er hat leider Recht gehabt ...«
Zu meiner Erleichterung verabschiedeten sich allmählich die Gedanken an Henris Schuld.
Ich stieg die lange Treppe zum Ausgang hinauf, und kaum hatte ich die Unterwelt von Paris verlassen, schlug mir das prall gefüllte Leben der beginnenden Nacht entgegen.
Man kann sich dieser unglaublichen Lebenslust in der französischen Hauptstadt gar nicht entziehen oder verweigern. Wenn man strauchelt oder fällt, hat man eigentlich gar keine andere Wahl, als wieder aufzustehen.
Aber dennoch gibt es hier viel zu viele, die es nicht geschafft haben. Etliche von ihnen leben in den häßlichen Trabanten-Vororten, zusammengepfercht in hermetisch abgeriegelten Wohnsilos ohne Zukunft, regiert von Resignation und Gewalt, vor den Auffahrten des Péripherique, diesem chronisch verstopften Autobahn-Ring rund um den Stadtkern von Paris.
Und dann diejenigen, die es auch dort nicht geschafft haben:
Sie vegetieren, zu menschlichen Lebend-Hüllen mutiert, vom Mitgefühl der Menschlichkeit ausgeschlossen, auf Pappen gebettet oder vollkommen besitzlos, in den Katakomben der Pariser Unterwelt dahin. Lautlos anklagend, in den blank gefliesten Röhren der Metro, wo jegliche Zeit und das Leben für sie stehengeblieben zu sein scheinen, während die mit rastlos hetzenden Menschen vollgestopften U-Bahnen an ihnen vorbei rasen.
Diese Ärmsten der Armen haben es irgendwann nicht einmal mehr geschafft, diese eine, letzte Stufe zu nehmen, um im Leben zu bleiben. Zu groß ist der Sog des vom Tageslicht befreiten Röhren-Labyrinths, welches überall nach Urin riecht, aber wenigstens Wärme und Trockenheit spendet.
Für einen Moment verlor ich den Liebeskummer aus meinen Sinnen und schlenderte den Quai d’Orsay am Ufer der Seine entlang.
Träge und braun floss die Seine durch ihr mancherorts kunstvoll von Menschenhand bereitetes Flußbett. Das gemächliche Tuckern der Motoren der Bateaux Mouches, den Taxi-Booten mit den Glasdächern für Touristen, wiederkehrendes Hupen, Motorengeräusche von Autos, Motorrädern und Motorrollern, von Windbrisen getragene Akkordeon-Musik, Fußgänger-Getrappel und Stimmengewirr vermengten sich zu einer lautstarken Liebeserklärung an das Leben.
Wenig später erreichte ich das Gelände der Kirchengemeinde, und ein kleines Hinweis-Schild aus Pappe wies mir den Weg zum Konzert-Ort der Blues-Band. Ich durchquerte einen Innenhof, der wie ein Kloster-Atrium angelegt war, mit seinen überdachten und mit Blau-Basalt gepflasterten Wegen und den von kniehohen Buchsbaum-Hecken umsäumten Rasenfeldern, die im Sommer zum Im-Gras-liegen einluden, um die Sonne zu genießen.
Entlang der Wege standen zwischen Dachstützpfeilern einige Holzbänke mit Füßen aus massiv geschmiedetem Metall, und ich ließ mich nieder, um die Idylle dieses Atriums auf mich wirken zu lassen. Vom Straßenlärm war nichts mehr zu hören.
Nur fünfzig Meter entfernt befand ich mich in einer völlig anderen Welt der Stille und Ruhe.
Ich begann zu frieren und kämpfte gegen die aufsteigenden Tränen und die alles niederdrückende Schwermut an, indem ich aufstand und den Wegweisern aus Pappe folgte.
In einem Seitentrakt des kirchlichen Hauptgebäudes tauchte ich in den muffigen Geruch von Linoleum, Weihrauch und Bohnerwachs ein. Meine Schritte hallten, trotz der Turnschuhe, im langen und dämmerig beleuchteten Korridor. Ich entdeckte einen weiteren, mit rotem Filzstift auf Pappe geschriebenen Hinweis und betrat die breiten, abgewetzten, grauen Steinstufen einer mächtigen Treppe mit kunstvoll geschnitztem, dunkelbraun lasiertem Holzgeländer.
Der Konzertbesuch verlangte mir alpine Qualitäten ab, denn ich musste bis in den zweiten Stock hochsteigen. Mein seelischer und körperlicher Zustand in Kombination mit dem schweren, bedrückend muffigen Geruch hatte sich bereits beim Erreichen des ersten Stockwerks durch eine beängstigende Kurzatmigkeit deutlich verschlechtert. Schwer keuchend und nur mit Hilfe des Treppengeländers und seiner massiven Handläufe schaffte ich es, den Gipfel zu erklimmen. Oben knarrte ein altehrwürdiger Holzdielenboden unter meinen Schritten. Eine einseitig geöffnete, sehr hohe Holztür lud in die Konzertstätte ein. Die Ornamentverzierten Türgriffe befanden sich in Brusthöhe, im Türschloss steckte ein riesiger, handgeschmiedeter Schlüssel. Vor dem geschlossenen Türflügel saß hinter einer Schulbank eine junge, freundlich lächelnde Frau mit braunen, langen Haaren. Sie war anscheinend eine Studentin, aber bestimmt keine Französin, denn der Kragen ihres hochgeschlossenen, grünen Sweaters lag wie ein Keuschheitsgürtel um ihren Hals. Vor ihr auf der Schulbank stand eine geöffnete Geldkassette.
Ich bezahlte den Eintritt, und sie stempelte einen geflügelten Engel in meine Handinnenfläche. Dabei stützte sie mit ihrer Hand die meine und lächelte. Die zarten Hände der Hochgeschlossenen waren warm und streichelweich.
Mit einem amerikanischen Akzent wünschte sie mir viel Vergnügen beim Konzert.
Der Boden knarrte, als ich den spartanisch bestuhlten und spärlich beleuchteten Konzertraum betrat, der kaum größer als ein leergeräumtes Klassenzimmer war. Das Publikum verteilte sich übersichtlich, es herrschte eine gedämpfte, leicht gedrückte Flüster-Atmosphäre im Raum.
Die eingeschalteten Verstärker brummten im Ruhebetrieb vor sich hin, und ihre Kontroll-Lämpchen leuchteten rot und blau. Links und rechts markierten auf massive Boxen-Stative aufgebockte Gesangs-Lautsprecher die seitlichen Grenzen der ebenerdigen Bühne. Ein einsames Stativ mit Gesangs-Mikrophon bildete die Bühnen-Mitte. Dahinter, auf einem abgewetzten Perser-Teppich plaziert, stand ein schwarzes Schlagzeug mit geschundenen Fellen und Becken. Um den Hocker herum lagen einige abgespielte, an Schaft und Köpfen abgesplitterte Trommelstöcke wie überdimensionale Mikado-Stäbchen auf dem Boden.
Eine Tür öffnete sich, die Musiker näherten sich seitlich der Bühne und nahmen ihre Plätze ein. Der Begrüßungs-Applaus der anwesenden Gäste klang nicht geschlossen, es war mehr ein vereinzeltes Klatsch-Knallen. Irgend jemand pfiff sogar.
Das kam wohl aus der »Sehr-gute-Freunde-Ecke«.
Insgesamt schien sich eine eher deprimierende Veranstaltung anzubahnen. Angesichts meines ohnehin bescheidenen emotionalen Zustands belastete ich mich aber nicht mit Fluchtgedanken.
Die Blues-Band bestand aus vier Mitgliedern, in der Besetzung Gesang, Gitarre, Baß und Schlagzeug. Sie nannten sich The Red Rumbles, alles Franzosen um Anfang zwanzig. Sie waren nicht nur sichtlich nervös, sondern spielten auch gnadenlos schlecht. Die Jungs liebten den Blues, aber sie konnten ihn einfach nicht spielen, das war deutlich zu hören. Es lag nur an meinem angeschlagenen Gemüts-Zustand und an den bezwungenen zwei Stockwerken, daß ich wie in Schockstarre dieses instrumentale Gemetzel ohne mentale Gegenwehr über mich ergehen ließ.
Es war eine Veranstaltung einer Kirchengemeinde in Paris, und anscheinend half diese seligmachende Kraft und Frömmigkeit den übrigen Konzert-Gästen dabei, über das dargebotene musikalische Blues-Dilemma hinweg zu lächeln.
Diese unendliche Güte Gottes hätte ich auch gerne auf meiner Seite gehabt. Ich schaffte ein Set, dann erstarben mein Wille zur Güte und die Lust auf weiteren Konzert-Genuß.
Der Abstieg aus dem Obergeschoß war getragen von zielstrebiger Flucht-Leichtigkeit.
Ich durchquerte den Innenhof, verließ das Kirchengelände und trieb wieder hinaus, in die Nacht von Paris.
Ich stieg hinunter zum Seine-Ufer und setzte mich auf den Steg einer Haltestation der Bateaux Mouches. Das Wasser schlug plätschernd und glucksend gegen die Kaimauern, und ich dachte unwillkürlich an den Froschkönig.
Wie bitte?
»Ich bin nicht tatterig!« schoß es mir urplötzlich durch den Kopf. Was war das denn jetzt? Ich wunderte mich über meine eigenen, verwirrenden Gedanken und grinste. Das Licht der Uferlaternen, welches sich im trüben Wasser widerspiegelte, und das Glucksen und Plätschern bohrten mir hartnäckig den Froschkönig in den Sinn, und ich ließ meine Gedanken in die Seine einsinken:
»Ich bin nicht tatterig!« dachte der Froschkönig, als er aufwachte und sich den Schlaf aus den Tränensack-Augen rieb. Laut und mit einem langgezogenen Quaken gähnte er und hoffte auf einen guten Tag.
Nur hoffte er das jeden Tag aufs Neue.
Der Froschkönig Arno Rudolf Wenz-Desolatis entstammte einem alten Froschkönig-Geschlecht von reinster adeliger Abstammung. Arno und seine adeligen Vorfahren verband seit jeher die Hoffnung, entweder zum Prinzen geküßt oder an die Wand geklatscht zu werden... mit dem gleichen Ziel, sich in einen schönen Prinzen zu verwandeln.
Der zweite Weg der Hoffnung lag bisher immer näher, denn Arno war äußerst fett, wabbelig, warzig und von abschreckender, monströser Dummheit. Er war schon einigen Prinzessinnen begegnet, doch küssen wollte ihn keine, dafür hatte er schon viele Wände gesehen.
Arno war ein wunderschöner Prinz, das dachte er – nur die Prinzessinnen waren immer die falschen, das wußte er. Die falschen Prinzessinnen und die ungezählten Wände hatten letztlich zu einer zusätzlich degenerierten Optik seines Äußeren beigetragen, die nicht nur seine Krone arg verbeult hatten. Aber mit einer Prinzessin war er sogar mal verheiratet.
Sie hieß Lieselotte Wenz.
Lieselotte war eine Kröte, die keiner haben wollte. Nach einem günstigen Moment vorteilhafter Beleuchtung hatte sie den warzigen Arno an ihren Hacken. Er sah in ihr die Einlösung all seiner Hoffnungen, und sie war für ihn seine Prinzessin.
Sie küßten sich leidenschaftlich, aber Lieselotte war keine Prinzessin.
Sie küßten sich trotzdem noch einmal... – ohne Erfolg.
Sie machten einen Probewurf, aber Lieselotte warf daneben.
Sie war keine Kröte für nur eine Nacht, und sie heirateten. Fortan übten sie jeden Tag, aber schließlich trennte sie sich wieder von ihm, allerdings ohne jemals die Wand getroffen zu haben.
So saß er da und dachte wehmütig zurück an die Zeiten voller leidenschaftlicher Würfe und Wandverfehlungen mit Lieselotte. Jeder Tag mit ihr hatte ihn, Stückchen für Stückchen, näher ans ersehnte Ziel herangebracht, aber es sollte beim schicksalhaften »fast« geblieben sein.
Arno gähnte träge quakend und hoffte auf einen guten Tag...
»Was für ein Blödsinn! … was für eine Geschichte…« schüttelte ich, über meine eigenen Gedanken breit grinsend, den Kopf. Begann etwa meine Phantasie mit mir Amok zu laufen?
Ich erhob mich vom Steg und verließ das unmittelbare Seine-Ufer, allerdings nicht, ohne noch einmal einen Blick in die braune Fluß-Brühe zu werfen. »Ich bin nicht tatterig ...,« wiederholte ich lautstark zu mir selbst. Laut genug, um verwunderte Blicke eines Pärchens auf mich zu ziehen, welches einige Schritte von mir entfernt händchenhaltend am Ufer der Seine saß.
»Ist doch wahr – oder?« rief ich zu ihnen hinüber. Ihren irritierten Blicken nach zu schließen, zweifelten die beiden Liebenden nicht nur wahrscheinlich an meinem Verstand.
Mir war’s egal. Mir war wieder so richtig elend zumute, und eines wurde mir immer mehr klar:
Das einzige Große in unserer Liebe war die Wand, gegen die Isabelle und ich ungebremst geprallt waren.
Jeder von der anderen Seite. Ich von innen und Isabelle von außen.
Es gab keine Chance auf ein Durchkommen, aber es gab auch kein Zurück mehr, um vielleicht doch noch einen anderen Weg zu suchen und zueinander zu finden.
Ihre Augen waren so schön, doch reflektierten sie nur das Licht der Sonne, auch wenn diese Erkenntnis unerträglich weh tat.
Ihr Platz ist noch warm gewesen, aber hoffnungsleer.
Die Wärme ihres Platzes würde erst mit dem Nachlassen der Schmerzen meines glühenden Verlangens nach ihrer Sinnlichkeit erkalten.
Den jüngst erlebten musikalischen Bankrott in der Kirchengemeinde wollte ich dennoch nicht so stehen lassen.
Ich brauchte ganz dringend ein seelisches und musikalisches Fallnetz und blieb in meiner Suche nach einem gedanklichen Rettungsanker beim Caveau de la Huchette hängen. Bis dorthin lag zwar ein gutes Stück Wegstrecke vor mir, aber mir war überhaupt nicht nach dem Schlund der Pariser Metro zumute, also machte ich mich zu Fuß auf ins Quartier Latin.
Mein Weg führte mich weiter am Ufer der Seine entlang. Einige Stände der »Bouquinistes« hatten zu dieser später Stunde noch geöffnet, und ich blieb ab und zu stehen, um einen Blick auf die angebotenen Bücher oder auch kleinen Plakate und Bilder zu werfen. Ich mochte diese kleinen Bücherstände, die in großen, aufklappbaren Holzkisten auf den Mauern des Seine-Ufers, im Herzen der Stadt, angebracht waren und während der Schließungszeiten mit alten, verrosteten Vorhängeschlössern gesichert wurden.
Ich verließ das Seine-Ufer und überquerte die mehrspurige Straße.
Der Caveau de la Huchette, einer der ältesten Jazzkeller Europas, ist beheimatet mitten im Quartier Latin, diesem engen, lebhaften und geschäftigen Viertel in Paris, mit seinen nie versiegenden Touristenströmen. Unzählige Bistros, Bars, Restaurants, Läden aller Art, Mini-Imbisse, Kunstgalerien und Eisdielen säumen dicht an dicht die engen Gassen. Straßenkünstler, Maler, Clowns, Musiker, Bands, Tänzer, Akrobaten, Pantomimen, lebende Statuen, betrügerische Trickspieler und fliegende Händler mit ihren Schmuggelwaren nutzen jede noch so kleine Nische, die die Straßen, Bürgersteige und Plätze freigeben.
Ich durchstreifte die Rue St. André des Arts und blieb bei zwei Stepptänzern stehen, die sich ein atemberaubendes Tanz-Duell lieferten. Sie schlugen sich abwechselnd ab und trieben gegenseitig ihre schwitzenden, drahtigen und durchtrainierten Körper zu tänzerischen Höchstleistungen an. Dicke Schweißperlen tropften in Strömen von ihren strahlenden Gesichtern, und ihr unbändiger Spaß übertrug sich schnell auf die im Kreis um sie herum anwachsende, mitklatschende und lachende Zuschauermenge.
Das Finale steppten sie synchron. Rasant und mit höchster Präzision inszenierten die beiden Stepptänzer einen atemberaubenden Showdown, der mich für einen Moment alles andere vergessen ließ. Die Zuschauer waren begeistert, und der durch die Reihen gereichte Hut füllte sich schnell.
Beschwingt durch das »taggedidagdag, taggedidagdag…« zog ich mit federnden Schritten weiter.
Überall um mich herum ertönte in Fetzen Stimmengewirr. Trotz der nächtlichen Kühle saßen viele Menschen draußen an den Tischen der Restaurants, Bars und Cafés. Ihre Unterhaltungen übertönten und durchmengten sich mit dem Verkehrslärm und der allgegenwärtigen, französischen Akkordeon-Musik, die mit ihren virtuosen Melodien aus allen Richtungen zu wehen schien.
Schließlich stand ich vor dem unscheinbar in der Straßen-Szenerie liegenden Eingang zum Caveau de la Huchette.
Ich bezahlte an der Kasse, erhielt einen Verzehr-Bon und tauchte in die Höhlenwelt des Jazz ein, in der ich zunächst so gut wie nichts sah, weil der Weg in den Club durch einen schummrig beleuchteten, tiefschwarz gestrichenen Tunnel-Korridor führte.
Außer mir hielten sich vielleicht acht oder zehn weitere Gäste im Jazz-Keller auf, die Atmosphäre war gruselig und deprimierend.
Die Band bestand aus einem Schlagzeuger mit Hornbrille und Seitenscheitel, einem schlaksigen Kontrabassisten mit Mönchs-Glatze und blauen Pullunder, einem abgehärmt wirkenden Gitarristen mit mittelblonden, strähnigen langen Haaren, die im Nacken zu einem dünnen Pferdeschwanz zusammengebunden waren und einem Tenor-Saxophonisten mit Pomade-Frisur.
Ich bestellte mir an der Theke ein Bier und erfuhr, daß es sich um die Haus-Band handelte, die hier so explosiv aufspielte und die Zuschauermassen begeisterte.
»Wie viele Abende haben die wohl schon auf diese Art und Weise hinter sich gebracht«, dachte ich.
Im Vergleich dazu fühlte sich mein Liebeskummer gleich ein wenig besser an.
Um im Caveau de la Huchette zur Hausband zu gehören, mußten die Musiker in der Lage sein, wirklich jeden Musikwunsch der Gäste zu erfüllen.
Die Bühne sah aus wie ein überdimensionales Laufgitter, dessen abgeschabte Lauffläche sich etwa einen Meter aus dem schwarzen Estrichboden empor hob, umzäunt von einem Geländer aus Holz und Metall, wie bei einer Galerie.
Schüchtern näherte sich eine junge Frau mit mausbraunen Haaren dem Musiker-Laufgitter und gab dem Saxophonisten ein Zeichen. Dieser unterbrach kurz darauf sein Saxophonspiel, während die Band weiterspielte. Er beugte sich zu ihr hinunter und hielt ihr ein Ohr hin. Sein weit geöffnetes Hemd spannte abenteuerlich stramm und unterteilte seinen von vielen Longdrinks und billigem Essen aufgedunsenen Bauch in unförmige Wülste.
Die in ihrer unauffälligen Art und Weise sehr hübsche Frau flüsterte dem Saxophonisten etwas ins Ohr, und er nickte zustimmend. Als sie sich anschickte, wieder zu ihrem Platz zurückzukehren, tippte er ihr noch einmal von hinten auf die Schulter. Die Frau drehte sich um, er beugte sich erneut zu ihr hinunter, wobei er mit dem Zeigefinger auf seine von geplatzten Äderchen durchzogene, schwitzig-glänzende Wange deutete.
»Hey Lady, I’m gonna play it for you and you’ll give me a kiss …«
Dieser Mann ließ kein Klischee unberührt.
Die Frau schien überrumpelt und lächelte unsicher. Dann gab sie dem Saxophonisten einen flüchtigen Kuß auf seine feiste Wange und kehrte eiligst, eher fluchtartig, in die hinter einem Pfeiler vom Scheinwerferlicht unbeleuchtete, geborgene Sicherheit ihres Barhockers zurück.
Die Kommunikation auf der Bühne war kurz und geräuschlos knapp. Der Schlagzeuger tauschte einige Worte mit dem Kontrabassisten aus, dann zählte er die Band ein.
Aus dem Saxophon schmalzte die Melodie von ›You are the Sunshine of my Life‹, getragen von den träge-seichten Bossa-Rhythmen der Band.
Der schmierige Saxophonist beherrschte sein Instrument in einer bewundernswerten Art und Weise.
Er verschmolz regelrecht mit seinem Saxophon, alles an ihm zerfloß mit den sanften Tönen, die durch das Mundstück, dann durch den geschwungenen Hals tief in die Seele seines abgewetzt aussehenden Instruments hinab glitten, um dann aus dem nach oben gebogenen dunklen Trichter-Schlund heraus zu perlen.
Eine wunderbare Zartheit verzauberte den Raum.
Die mausbraune Frau nippte in ihrer Ecke, beinahe zärtlich und mit geschlossenen Augen, an ihrem Getränk.
Ich blendete den traurigen Anblick dieser abgehalfterten Band aus und schloß ebenfalls die Augen, um mein von Liebeskummer durchtränktes Herz diesen wunderbaren Klängen zu übergeben. Kaum hatte ich jedoch die Augen geschlossen, da zerstörten laut trampelnde, stampfende Schritte diesen kurzen Moment der Innigkeit.
Ein wissendes Grinsen ging durch die Reihen und Gesichter des Theken-Personals, aber auch der Band und einiger Gäste.
Eine imposante Frau tauchte mit schweren Schritten stampfend aus der Dunkelheit auf und baute sich, wie ein zu Fleisch gewordenes Monument, mitten auf der Tanzfläche auf.
Aus ihrem Schatten heraus trat eine mickrige Gestalt, die von der monumentalen Frau blitzartig, mit unfaßbarer Gewalt gepackt und wie eine Puppe vor sich geschleudert wurde. Dort landete das Männchen mit einem »Klick-Klick« der Schuh-Absätze und das Paar verharrte einander gegenüberstehend, wie in einer Tanzposition.
Die Frau war fast einen Meter und neunzig groß und trug einen weißen Petticoat mit roten Punkten.
Sie besaß die Statur eines Gewichthebers und die Arme und Hände eines Schwergewicht-Boxers.
Ihre widerspenstigen, zu einer roten Pferdeschwanz-Frisur gebündelten Haare gaben ihr dennoch etwas von einem kleinen, wilden, aber auch musikalisch empfindsamen Mädchen, welches die Natur mit Maßen ausgestattet hatte, die wohl nur den berühmten französischen Bildhauer Rodin uneingeschränkt beglückt hätten.
Ihr männlicher Begleiter war ein schmächtig ausgefallenes Geschöpf mit einer Körpergröße von wohlwollenden einem Meter und sechzig und schulterloser Statur.
An seinen Füßen trug er Schuhe mit hohen Plateau-Sohlen. Die Absätze waren mit Metallwinkeln beschlagen.
Der Mann wirkte auf eine rührende Art unproportioniert, und seine linkischen Bewegungen verliehen ihm den schüchternen Charme eines liebenswürdigen Trottels.
Seine Haare waren zu einer riesigen »Entenschwanz«-Haartolle zusammengekämmt, wie es die Halbstarken der fünfziger und sechziger Jahre zu tun pflegten. Nur entpuppte sich dieses Exemplar als wahres kunsthandwerkliches Meisterwerk:
Der Haaransatz des Mannes war bereits bis zur Kopfmitte zurückgewichen, und nur durch verwegenes Nach-Vorne-Frisieren, unterstützt durch brachialen Einsatz von Haarspray und Pomade, konnte diese imposante Tolle entstanden sein.
Der massive Einsatz von Plateau-Sohle und Haartollen-Turm brachten ihn größenmäßig noch nicht auf Augenhöhe, aber zumindest ein gutes Stück näher an seine Dame.
Ein markerschütternder »Rooock’n’Roool!«-Schrei brachte den Jazzkeller in seinen Fundamenten zum Erbeben.
Ihr linker Arm pumpte in rhythmischen Stoßbewegungen nach oben, ihre mächtige Hüfte schwang bebend und ihre Füße stampften dazu ungeduldig im Takt mit.
Elvis lebte – daran konnte es nun keinen Zweifel mehr geben!
Das Gesicht unter der Haartolle wirkte leicht nervös angespannt und dann passierte es endlich:
Der Schlagzeuger nahm grinsend das Tempo der stampfenden Füße und des pumpenden Arms auf, schlug seine hölzernen Schlagstöcke gegeneinander und zählte laut ein:
»... one … two … one - two - three - four...«
Mit dem ersten Ton landete der Saxophonist auf seinen Knien, blies sich zu Bill Haley’s Rock’n’Roll-Klassiker ›Rock around the Clock‹ die Seele aus dem Leib, und die Knöpfe schienen mit seinem Hemd verschweißt zu sein.
Die mächtige Frau explodierte regelrecht in eine leidenschaftlich getanzte Demonstration tief erfüllter Liebe zum Rock’n’-Roll, und die Haartolle kämpfte akrobatisch um ihr Leben.
Mit einer erstaunlichen tänzerischen Leichtigkeit entlud sich die Musik im Körper der riesigen Frau, nicht nur ihre ganze Kraft, sondern auch ihr Gewicht bahnte sich einen ungezügelten, rhythmischen Weg. Sie prallten ungebremst in den kleinen Mann. Das Paar tanzte hüpfend zur Musik, die Frau wirbelte den Mann über die Tanzfläche.
Immer im starken Griff ihrer Boxerhände zog sie ihn juchzend und mit kraftvollem Schwung zwischen ihren Beinen hindurch, ließ sich von ihm anspringen, und er vollendete mit tollkühnem Rückwärts-Salto, sicher auf den klickenden, eisenbeschlagenen Absätzen gestanden.
Die Band hatte sich binnen kürzester Zeit in einen musikalischen Vollrausch gespielt. Der Saxophonist gab auf dem Rücken liegend alles und presste mit angespannt auf und ab wippendem Becken wie bei eng aufeinanderfolgenden Geburtswehen hohe, heisere und vibrierende Töne aus seinem Instrument. Der Bassist lag slappend und kopfschüttelnd auf seinem Kontrabass, der Gitarrist trieb auf Knien den vor ihm liegenden Saxophonisten in ekstatische Höhen, und der Schlagzeuger hämmerte sich die Seele aus dem Leib.
Die Rock’n’Roll-Amazone wollte mit wildem Schwung ihren Mann wieder einmal zwischen ihren Beinen durchwerfen, dabei verlor sie ihn aus ihrem Griff. Er prallte zuerst ungebremst unter ihrem Petticoat zwischen ihre mächtigen Oberschenkel und anschließend mit voller Wucht auf die Tanzfläche, wo er schwer angezählt liegenblieb.
Die Band hatte in ihrem Rausch nichts von dem Unfall mitbekommen und spielte gnadenlos weiter. Die Frau beugte sich über den Gestrauchelten und riss ihn zu sich hoch. Das Männchen hielt sich nicht nur benommen torkelnd so gerade eben auf den Beinen, sondern bemühte sich auch noch um wippende Schritte...
Seine Haartolle war beim Eintauchen zwischen ihre Beine in einem Stück nach hinten geklappt und hing nun, formgefestigt wie der Haarknoten einer Nonne, an seinem Hinterkopf, während sich oben eine blanke Glatze präsentierte.
Angesichts des schadenfrohen Grinsens in den Gesichtern der Club-Gäste und der lärmend ausklingenden Rock’n’Roll-Schallwand der Hausband war es ein eher sinnloses Unterfangen, aber sichtlich bemühte sich der benommene Gestrauchelte um die Bewahrung seiner Würde. Mit stelzenden, mühsam die Balance haltenden Schritten schwankte er auf seine, in orgiastischer Ekstase zuckende Tanzpartnerin zu. Ohne Umschweife herzhaft zupackend nahm sie ihn erneut in ihren grifflichen Gewahrsam.
Die Band wechselte nahtlos aus der Rock’n’Roll-Lärmwand in die zackig akzentuierten Melodie-Linien eines Tangos.
Die gewaltige Frau reagierte mit einem verzückten Juchzer der Begeisterung. Der kleine Mann stöhnte kurz auf und bewies gleich darauf ungeahnte Qualitäten und ein Höchstmaß an Flexibilität.
Ihre monumentale Präsenz und ihre dominant-straffe Führung ließen ihm keine andere Wahl als die Beherrschung des gesamten Repertoires weiblicher Tango-Schritte. Seine Gelenkigkeit und Präzision waren trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands beeindruckend, ... eine zackige Drehung hier, eine abenteuerlich tiefe Rückenlage da... und seine Hingabe in die starken Arme dieser massigen Frau schien grenzenlos.
Das kurz zuvor noch schadenfrohe Grinsen in einigen Gesichtern wich einem anerkennenden Lächeln.
Trotz der grotesken Gesamtsituation war es ein Tango der puren Liebe und Leidenschaft.
Irgendwie begann ich, dieses seltsame Paar zu bewundern und auch ein wenig um ihr Glück zu beneiden.
Trotz aller Liebe und Leidenschaft litt die Seriosität dieser Tango-Darbietung dennoch unter der zum Nacken-Haardutt mutierten Haartolle, die gerade in der tiefen Rückenlage wie ein haariger Abschlepp-Haken an seinem Hinterkopf nach unten baumelte. Die Schluss-Akkorde des Tangos ertönten, händchenhaltend und sichtlich geschafft begleitete das Männchen seine Frau zur Theke.
Ich wartete ab, bis das ungleiche Paar an der Theke Platz genommen hatte und steuerte auf sie zu.
In unmittelbarer Nähe wirkte der kleine Mann noch mickriger, die Frau dagegen umso riesiger. Schwer schnaufend wuchtete sie ihren massigen, aber keineswegs fett erscheinenden Körper auf einen Barhocker, der die Last ihres Gewichts mit einem herzhaften Knirschen kommentierte.
Der Mann tauchte kurz ab in den Schutz einer unbeleuchteten Ecke, wo er sich mit Schwung die Haartolle auf den Kopf zurück holte.
Mit spitzen und routinierten Fingern nestelte er auf seinem Kopf zwischen Kopfhaut und der wiederhergestellten Haartolle herum, dann tauchte er wieder aus dem Lichtschatten hervor. Er tat etwas in einen Aschenbecher, und ich erkannte einen zusammengeknüllten Streifen doppelseitigen Klebebands.
Zum Grinsen blieb mir nicht viel Zeit, denn beim näheren Betrachten seines ramponierten Gesichts erschrak ich kurz. Die Nase war krumm, platt und schief wie die eines Boxers und seine Oberlippe leicht geschwollen. Außerdem zierten zahlreiche kleine und größere Narben, ältere und frische Kratzer und Hautabschürfungen sein Gesicht.
Als er sich auf den Barhocker neben seiner Herzensdame setzte, erwiderte er mit einem Lächeln meine Blicke:
»Ja, so ist das, wenn man seine Frau, die Musik und den Tanz über alles liebt…«. Seine Aussprache war undeutlich.
»Seine Frau also…«, dachte ich.
Er fuhr fort:
»Darf ich vorstellen? Mathilde, und mein Name ist Bernard. «
Trotz seiner Kleinwüchsigkeit wirkte er sehr in sich und mit der Welt verankert, ausgestattet mit einer Seele wie ein Fels. Vielleicht schreckte ihn in seinem bewegten Leben aber auch einfach nichts mehr ab.
Mathilde drehte sich mir zu, und der Barhocker knirschte abenteuerlich laut. Das übertönte sogar kurz die Musik der Band, die mittlerweile wieder in die instrumentale Lethargie zurückgekehrt war.
Mathilde schaute mich aus grünen Augen freundlich an. Ihre wilden, roten Haare umrahmten ihr lächelndes, breites Gesicht. Das Lächeln dieser eben noch vibrierenden Frau war bezaubernd, und mein wundes Herz folgte bereitwillig diesem Sog ihrer Augen.
»Ja, ...ich liebe dieses Lächeln, aber auch diese ganze Menge Frau…«, raunte mir Bernard zu, als ob er meine Gedanken erraten hätte.
»Geoffroi«, stellte ich mich den beiden vor.
Aus einem gedanklichen Reflex heraus hatte ich das erste Mal die französische Übersetzung meines Namens benutzt ... und es gefiel mir.
Dieses ungewöhnliche Paar irritierte mich auf eine eigenwillige, aber schöne Art und Weise.
Bernards Lächeln war charmant, jedoch im Schneidezahn-Bereich weitgehend zahnlos. Und wieder schien er meine gedanklichen Beobachtungen erkannt zu haben und sagte nur: »Rock’n’Roll«.
Ich verstand sofort die Ursache seiner Zahnlosigkeit und seiner undeutlichen Artikulation.
Mathilde war das pralle Leben.
Bernard nahm alles ohne Kompromisse hin. Er ertrug nicht nur sein persönliches Schicksal, sondern er liebte seine Mathilde so wie sie war.
Angesichts dieser Kraft der Liebe der beiden holte mich aber die grausame Unbarmherzigkeit meines liebeszerrissenen Herzens ein.
Ich musste schnell raus.
Ich verließ den Caveau de la Huchette, jedoch nicht, ohne mich noch einmal nach der mausbraunen und so unscheinbar hübschen Frau umzusehen.
Sie saß immer noch im Halbdunkel ihrer Ecke. Ihr Getränk stand vor ihr auf der Theke, und sie lauschte der Musik.
Für einen kurzen Moment erwiderte sie meine Blicke mit einem versonnenen Lächeln.
Ich stockte kurz, ging dann aber trotzdem.