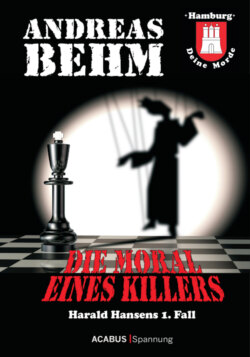Читать книгу Hamburg - Deine Morde. Die Moral eines Killers - Andreas Behm - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1
ОглавлениеDr. Martin Brüggemann verlebte seinen letzten Tag, als wäre er wie jeder andere Wochentag. Er war als Schönheitschirurg einer der Besten seiner Zunft in Norddeutschland. Nach erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung hatte er schnell gemerkt, dass man mit der künstlichen Verjüngung von Menschen weit mehr Geld verdienen konnte als im Krankenhaus. Er besaß das Talent für die feinen Schnitte und das Auge für die richtigen Korrekturen. Hinzu kamen Zielstrebigkeit und Geldgier. Der Erfolg stellte sich so fast zwangsläufig ein.
Sein Erscheinungsbild stand im Gegensatz zu seinen Künsten. Dr. Brüggemann schleppte ein paar Kilo zuviel mit sich herum, denn er liebte gutes Essen sehr. Die meisten seiner Haare hatten schon vor Jahren beschlossen, die ihnen zugedachte Kopfhaut zu verlassen. Der kahle Kopf, das rundliche Gesicht ohne markante Konturen und die Sonderpreisbrille sorgten für das Aussehen eines Mannes, der den fünfzigsten Geburtstag schon lange hinter sich hat, obwohl er erst Mitte vierzig war.
Dr. Brüggemann saß in seinem Büro am Schreibtisch und sprach zu einem Patienten, der ihm gegenübersaß. Das Büro – es gab kein Sprechzimmer im herkömmlichen Sinne – war modern und spartanisch eingerichtet. Neben dem gläsernen Schreibtisch standen ein Bücherregal aus Buche voller Fachbücher und ein geschlossener Schrank, ebenfalls aus Buchenholz. Zwei dunkelrote Sessel mit einem kleinen Tisch und eine Stehlampe aus Messing ergänzten die Einrichtung. Ein etwa zwei Meter hoher Spiegel an der Wand, der von Halogenstrahlern gut beleuchtet wurde, war noch das Auffälligste in diesem Zimmer.
Der Doktor hielt eine elegante Einrichtung nicht für wichtig, wie er sich auch sonst nichts aus Statussymbolen machte. Reichhaltiges Essen und hübsche Zahlen auf seinen verschiedenen Bankkonten machten ihn glücklich. Er gehörte zu den Leuten, denen das Reichsein an sich Befriedigung verschaffte.
Die Praxis war zu dieser Zeit schon geschlossen. Dr. Brüggemann hatte den Termin mit dem Patienten bewusst auf eine späte Stunde gelegt. Es war besser, wenn seine Angestellten nicht alles mitbekamen. Es gab ihm ein gutes Gefühl, dass jeder Euro, den er von diesem Patienten bekam, ohne Abzüge auf einem seiner Konten landete.
Der Patient, dessen Gesicht von einem Hut mit breiter Krempe verdeckt wurde, zeigte sich nicht sehr redselig. Dr. Brüggemann erklärte ihm, auf was er bei der Nachsorge seiner inzwischen fast verheilten Narben achten und wie er die zwei vor ihm liegenden Salben anwenden sollte. Der Patient nickte nur ab und zu in den Redeschwall des Arztes hinein. Schließlich steckte er die Salben ein, stand auf und ging zu dem großen Spiegel an der Wand. Während er den Hut zurechtrückte, um scheinbar sein neues Gesicht zu betrachten, und dabei dem Arzt den Rücken zukehrte, glitt seine rechte Hand unter sein Sweatshirt und zog eine Pistole hervor. Es war eine Walther P5 Compact mit 7,65 mm Parabellum Munition. Eigentlich bevorzugte er im Nahkampf die SIG-Sauer P229 mit .357 SIG Munition, doch die wäre wegen ihrer Größe und ihres Gewichts heute unpraktisch gewesen. Die Walther hatte zwar keine allzu große Durchschlagskraft, aber es war eine kleine Waffe, die man gut verstecken konnte und für diesen Fall völlig ausreichend. Mit der linken Hand griff er in seine Hosentasche, nahm den speziell angefertigten Schalldämpfer heraus und schraubte ihn auf den Pistolenlauf. Mit seinem Körper deckte er diese Handlung so ab, dass der Arzt nichts sehen konnte. Während er die Waffe entsicherte und durchlud, hüstelte er laut.
Der Doktor beendete seine Ausführungen und kam nun zu dem für ihn wichtigsten Punkt: »Es wäre schön, wenn Sie dann in den nächsten Tagen die letzte Rate auf mein Konto …«
Der Patient drehte sich um, den rechten Arm ausgestreckt mit der Waffe in der vollkommen ruhigen Hand, und drückte ab. Die Kugel bahnte sich ihren Weg mitten durch das Gehirn des Doktors und ließ ihm keine Zeit, den Satz zu vollenden. Sie trat am Hinterkopf wieder aus und durchschlug dann einen hinter ihm auf der Fensterbank stehenden Blumentopf, um schließlich in der Wurzel einer Yuccapalme stecken zu bleiben. Der Schuss war dank des Schalldämpfers außerhalb des Raumes kaum zu hören.
Dr. Brüggemann saß noch immer aufrecht in seinem Stuhl, das Gesicht drückte Erstaunen aus, der Mund stand halb offen. Nach ein paar Sekunden siegte die Schwerkraft und der Oberkörper fiel auf den Schreibtisch. Der Patient schmunzelte. ›Konto‹ war Brüggemanns letztes Wort.
Das passt zu diesem Mann, dachte er.
Der Patient zog jetzt Handschuhe an, suchte den Teppich ab und hob die Patronenhülse auf. Er ging um den Schreibtisch herum und schob den toten Doktor etwas beiseite, um besser an den Computer zu kommen. Er nahm eine CD aus der Jackentasche, legte sie in das Laufwerk und gab einige Befehle auf der Tastatur ein. Schließlich holte er die CD wieder heraus und sorgte am Ende dafür, dass die gesamte Festplatte des Computers neu formatiert wurde.
Er schob den Doktor samt Stuhl auf seine Position zurück und zog aus der Hosentasche des Toten ein Schlüsselbund, öffnete den großen Schrank und entnahm nach kurzer Suche eine Mappe. Mit einem Baumwolltaschentuch wischte er alle Stellen ab, die er heute Abend berührt hatte. Er ging zur Tür und sah sich noch einmal um. Nein, er hatte nichts vergessen. Jetzt war es an der Zeit, eine gute Mahlzeit einzunehmen.
Der Mann von der Gebäudereinigung Sachs schaute aus einem der Behandlungszimmer auf den Flur der Praxis. Er konnte gerade noch sehen, wie ein Mann mit einem beigefarbenen Hut die Praxistür öffnete und verschwand. Der Doktor arbeitet heute aber wieder lange, dachte er.
Dann machte er sich wieder an die Arbeit, ohne zu ahnen, wie nah er seinem eigenen Tod gewesen war.
Das Taxi hielt vor einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus mit den für diesen Stadtteil typischen Rotklinkermauern. Viele der hier stehenden Häuser hatten wie dieses drei bis vier Stockwerke und bargen in der Regel 8 bis 12 Wohnungen. Die Mieten waren noch relativ niedrig und so wohnten in Barmbek hauptsächlich Menschen mit geringem Einkommen. Es war aber trotzdem kein Problembezirk. Die sozialen Brennpunkte fanden sich eher am Rande der Stadt in den Trabantensiedlungen, die in den sechziger und siebziger Jahren mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus entstanden waren. Ein Mann mit einem breitkrempigen, beigefarbenen Hut entstieg dem Taxi und ging zügigen Schrittes zum Eingang des Hauses. Die Straße war nur schwach beleuchtet und es nieselte schon wieder. Der Mann schloss eine Tür im Erdgeschoß auf und betrat seine Wohnung. Er warf die Tür zu und sicherte sie mit den drei massiven Schlössern. Dann gab er ein erleichtertes Seufzen von sich. Er befand sich jetzt in seiner Festung, hier konnte er sich entspannen.
Paul Hartfeld (ein neues Gesicht verlangte einen neuen Namen) hängte seinen Mantel an die Garderobe, warf mit einem eleganten Schwung seinen Hut auf die Ablage der Garderobe und ging in das kleine Wohnzimmer. Auf der Anrichte standen mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken zur Verfügung. Er zögerte kurz und wählte dann den 12 Jahre alten schottischen Whisky. Das schwere Bleikristallglas goss er halbvoll und nahm einen kräftigen Schluck. Nun spürte er sich wieder.
Das zu deftige Abendessen lag schwer in seinem Magen. Vielleicht half der Whisky. Gegen das Andere, das schwer in ihm lag, konnte der Whisky nicht helfen. Auch wenn der Chirurg kein sympathischer Mensch gewesen war, tat es Hartfeld leid, ihn getötet zu haben. Der Mann hatte gute Arbeit an seinem Gesicht geleistet. Doch Hartfeld konnte es sich nicht leisten, irgendwelche Brücken zu seinem alten Leben zu hinterlassen. Martin Schmidtbauer ist tot, es lebe Paul Hartfeld!
Er räkelte sich auf der Couch, doch etwas drückte gegen seinen Bauch. Die Walther steckte noch immer in seinem Hosenbund. Er stand auf, zog die Waffe heraus und legte sie neben die Whiskyflasche auf die Anrichte. Er nahm sich vor, sie später zu reinigen, was ungewöhnlich für ihn war. Die Flasche nahm er mit zum Wohnzimmertisch und schenkte nach.
Das Ziel war fast erreicht. Er hatte eine neue Identität, ein neues Gesicht und eine neue Wohnung. Ein Auftrag noch, dann würde er für immer aus Deutschland verschwinden. Die Vorbereitungen hatten ihn Monate gekostet. Diverse Operationen und viele Schmerzen lagen hinter ihm. Die Nerven seiner Unterlippe erholten sich nur langsam von der Operation an seinem Unterkiefer und dem Kinn. Manchmal fühlte es sich an, als ob ihm jemand ein Nadelkissen auf die Haut drückte. Am Anfang lief ihm oft Speichel aus dem Mundwinkel, ohne dass er es merkte. Auch das Trinken war schwierig, so als hätte er gerade eine Betäubungsspritze beim Zahnarzt bekommen. Inzwischen funktionierte alles schon viel besser.
Die neuen Papiere schienen perfekt zu sein. Der Fälscher, der sie erstellt hatte, arbeitete schon seit Jahren für ihn. Hartfeld hatte kurz überlegt, ob er Johnny auch töten müsste, sich dann aber dagegen entschieden. Dieser Mann war absolut verschwiegen und ein alter Hase in seinem Geschäft. Man konnte sich auf ihn verlassen, was man von dem Chirurgen in Bezug auf ein mögliches Verhör sicher nicht behaupten konnte. Seine Personendaten hatte Paul Hartfeld von einem Obdachlosen mit Leberzirrhose und sehr geringer Lebenserwartung. Der streunte nun mit viel Geld (falls es nicht schon versoffen war) und einem Pass auf den Namen Martin Schmidtbauer durch Hamburg. Hartfeld hatte sich mit ihm, dem originalen Hartfeld, eine Stunde lang unterhalten, um dann festzustellen, dass nicht nur die Leber, sondern auch das Gehirn des Mannes dem Alkoholgenuss nicht mehr standhalten konnte. Sein Spitzname unter den Tippelbrüdern war aus unerfindlichen Gründen ›Toni‹, und das war so ziemlich alles, was in Tonis Gehirn von seiner Person übrig geblieben war. Selbst wenn irgendein eifriger Polizist Toni finden sollte, bevor er das Zeitliche segnete, würde diese Spur bei Martin Schmidtbauer enden. Wahrscheinlicher war jedoch, dass Schmidtbauer bald ein staatlich finanziertes Begräbnis bekäme. Zum ersten Mal seit Jahren machte sich in Paul Hartfeld ein Gefühl von Vorfreude breit, Vorfreude auf ein Leben ohne Verfolgungsängste.
Hauptkommissar Hansen betrat den Tatort schlecht gelaunt, wie fast immer. Manche Kollegen nannten ihn hinter seinem Rücken nur noch ›Stinkstiefel‹.
»N’Abend«, grüsste der Gerichtsmediziner Peters, ein kleiner schlanker Mann mit Glatze, und schaute dabei Hansen über seine randlose Brille hinweg an.
»Mmmh«, antwortete Hansen. »Was haben wir denn heute Schönes?«
»Einen sauberen Kopfschuss. Profiarbeit, wenn du mich fragst.«
»Wen sollte ich sonst fragen, siehst du noch jemanden in diesem Raum?«
Peters zog die Augenbrauen hoch.
»Du hast ja heute wieder eine tolle Laune, Harald!«
Harald Hansen mochte seinen Vornamen nicht. Wer ihn duzen durfte, wurde verpflichtet, ihn mit ›Harry‹ anzusprechen.
»Nenn mich nicht Harald!«, rief er zickig.
Peters konnte sich das herausnehmen. Er kannte Hansen seit vielen Jahren und nahm die Launen des Kommissars nicht mehr ernst. Aber es machte ihm Spaß, seinen Freund ab und an zu piesacken.
»Kommen wir zur Sache«, lenkte Hansen ein. »Kannst du mir schon was sagen?«
»Ich habe zwar gerade erst angefangen, aber soviel kann ich schon sagen: Die Leiche ist ganz frisch, der Tod trat etwa vor einer Stunde ein. Die Ursache dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach der Schuss in den Kopf gewesen sein. Die Kugel ist am Hinterkopf wieder ausgetreten. Der Mann war innerhalb einer Sekunde tot oder zumindest hirntot, weitere Verletzungen konnte ich nicht finden. Endgültige Aussagen nach der Obduktion – du kennst das ja«, referierte Peters in der ihm eigenen sachlichknappen Art.
»Ist die Leiche bewegt worden oder starb er hier?«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass er genau in diesem Stuhl erschossen wurde. Die Spurensicherung ist noch nicht da, aber schau dir mal das Loch im Blumentopf auf der Fensterbank an, das könnte ein Einschussloch sein.«
Hansen ging vorsichtig um den Leichnam herum zur Fensterbank und besah sich den Blumentopf.
»Du hast immer noch den Blick für das Wesentliche, Heinrich. Die Kugel muss da drin stecken geblieben sein, sonst wäre die Fensterscheibe kaputt. Das ist doch schon mal ein Ansatzpunkt.«
»Der Tote ist übrigens Dr. Martin Brüggemann, ihm gehört diese Praxis. Der Mann von der Reinigungsfirma hat ihn vor einer halben Stunde entdeckt. Er sitzt im Wartezimmer.«
»Danke, Heinrich, wir sprechen uns morgen, wenn du mit der Obduktion fertig bist.«
Der Kommissar verabschiedete sich. Peters murmelte einen Gruß und wandte sich wieder seiner Leiche zu. Hansen schlurfte gemächlich hinüber ins Wartezimmer. Schnelligkeit und Dynamik waren Worte, die einem im Zusammenhang mit Hansen nicht einfielen, Sturheit und Beharrlichkeit dafür umso eher. Seine Kleidung passte zum Charakter ihres Trägers. Die Jeans hing locker über dem Hintern und die Lederjacke hatte auch keine Lust mehr, gut auszusehen. Seine leicht angegrauten Haare lagen zottelig und schon wieder viel zu lang auf seinem Kopf. Auf dem Flur traf Hansen die soeben eingetroffenen Leute von der Spurensicherung. Ohne einen Gruß rief er ihnen im Vorbeigehen zu: »Die Kugel steckt in der Yuccapalme. Und nehmt den Computer des Doktors mit.«
Der erste der beiden Spusi-Leute zeigte ein gequältes Grinsen und murmelte seinem Kollegen zu: »Glaubt der eigentlich, dass wir Anfänger sind?«
Der zweite Mann zuckte nur mit den Schultern und antwortete: »Hör nicht hin, du kennst ihn doch.«
Der Zeuge, ein junger Mann mit kurzen, schwarzen Haaren und Stoppelbart, saß auf einem Stuhl und wippte nervös mit dem rechten Fuß. Das Zittern seiner Hände versuchte er zu verbergen, indem er sie auf seine Schenkel presste. Neben der Tür stand ein uniformierter Polizist. Mit einer unfreundlichen Handbewegung bedeutete Hansen dem Streifenpolizisten, dass er den Raum verlassen möge, nachdem er dessen Aufzeichnungen an sich genommen hatte.
»Hauptkommissar Hansen«, stellte er sich vor, »Sie haben also den Toten gefunden?«
»Ja, ich wollte das Zimmer saubermachen und dann sah ich ihn …«
Er stand auf und streckte Hansen die Hand entgegen. Sie war unangenehm feucht.
»Entschuldigung, ich heiße Erhan Özdemir.«
Hansen nickte nur. »Wann war denn das?«
»So gegen acht, oder kurz danach. Ich habe dann sofort 110 angerufen.«
Hansen las im Protokoll des uniformierten Polizisten.
»Der Notruf ging um 20.05 Uhr ein, das kommt ja hin. Haben Sie den Toten angefasst oder irgendwas in dem Zimmer verändert?«
Özdemir schüttelte den Kopf. Seine Gesichtsfarbe war etwas bleich, trotz des dunklen Teints.
»Ich habe nur nach seinem Puls gefühlt, um zu sehen, ob er noch lebt.«
Nun wippte der Fuß auch im Stehen. Es war an der Zeit, den Mann durch Smalltalk ein wenig zu beruhigen.
»Sie sind Türke?«, fragte Hansen ohne echtes Interesse.
»Deutscher und Türke«, kam die überraschende Antwort. »Meine Eltern sind Türken, aber ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Ich spreche besser deutsch als türkisch.«
Hansen bemerkte den leicht gedehnten Hamburger Dialekt des Zeugen.
»Den Putzjob mache ich nur nebenbei, hauptsächlich studiere ich an der Uni«, erläuterte Özdemir.
»Was studieren Sie denn?«
Das Ablenkungsmanöver schien zu helfen. Das Blut kehrte langsam in Özdemirs Gesicht zurück.
»Medizin«, antwortete Özdemir. Seine Stimme wurde nun lebhafter. »Und ich werde bestimmt ein besserer Arzt als Dr. Brüggemann, dieser geldgeile Typ! Ermordet zu werden, das hat er nicht verdient, aber der Doktor hat ohne schlechtes Gewissen alles gemacht, was Geld bringt. Er hatte keine Skrupel, auch völlig unnötige Operationen zu machen. Hauptsache, die Kasse stimmte!«
Komischer Typ, dachte Hansen, zittert wie Espenlaub und macht gleichzeitig einen auf Moralprediger. Während er mit der linken Hand durch seine kurzen, grauen Barthaare strich, überlegte der Kommissar, wie er wieder auf das Thema Mord zurückkommen konnte.
»Das ist kein Verbrechen, solange die Patienten es so wollen, aber …«
Der junge Mann unterbrach ihn. »Glauben Sie bloß nicht, dass hier alles mit rechten Dingen zu geht. Lassen Sie doch mal seine Bücher prüfen, da werden ein paar Operationen fehlen. Fragen Sie mal den Mann, der heute Abend so spät die Praxis verlassen hat.«
Hansen wurde jetzt ungeduldig, das moralische Gerede nervte ihn.
»Das mag ja alles richtig sein … Was haben Sie gerade gesagt?«
»Na, dass Sie mal den Typen befragen sollen, der vorhin die Praxis verlassen hat.« Özdemir war so sehr mit seiner moralischen Empörung beschäftigt, dass er die Wichtigkeit seiner Beobachtung gar nicht erfasste.
Hansen holte kurz Luft, um dann mit Nachdruck zu fragen: »Sie haben also heute Abend, bevor Sie die Leiche entdeckten, jemanden in der Praxis gesehen?«
»Sag’ ich doch«, antwortete Özdemir und begriff noch immer nicht. Die Aufregung vernebelte seinen Verstand.
»Wann war das und wie sah der Mann aus?«
»Also, das muss so gegen halb acht gewesen sein. Ich hatte gerade den zweiten OP-Raum fertig geputzt und hörte ein Geräusch auf dem Gang. Als ich um die Ecke schaute, öffnete ein Mann die Eingangstür und ging. Ich hab’ ihn nur ganz kurz gesehen, er war ja schon halb draußen. Außerdem trug er einen Hut, sodass ich sein Gesicht nicht sehen konnte.«
Hansen war nun voll konzentriert. »Wie sah der Hut aus?«
»Das war so einer mit breitem Rand und die Farbe war hell, so ein Beige. Ich glaube, man nennt die Dinger Panama-Hut. Wussten Sie, dass die gar nicht in Panama, sondern in Ecuador hergestellt werden?«
Hansen ging auf den Exkurs in Sachen Hutmode nicht ein, er war genervt von diesem Klugscheißer.
»Die Kleidung?«
»Ähm, ein dunkler Mantel, aber an mehr kann ich mich nicht erinnern.«
»Größe und Figur?«
»Naja, dick war er nicht, Durchschnitt würde ich sagen und er war etwas größer als Sie.«
Hansen maß 1,72 Meter, dann musste der Mann cirka 1,80 Meter groß sein. Oder auch nicht, denn durch den Hut wirkte er sicher größer als er war.
»Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, das wichtig sein könnte?«
Der Zeuge schüttelte nur stumm den Kopf. Ihm ging langsam ein Licht auf. »Meinen Sie, das war der Mörder des Doktors?«
»Gut möglich. Wenn der Typ Sie gesehen hätte …«
Erhan Özdemir schaute ihn an. Es dauerte drei Sekunden, dann war sein Gesicht wieder so blutleer wie am Anfang des Gesprächs.
Als Kommissar Hansen den Tatort verließ, blieb er vor der Haustür stehen, zündete sich eine Zigarette an, legte den Kopf leicht in den Nacken und blies den Rauch in den Nieselregen. Er dachte über das Geschehen nach und plötzlich zeigte sich auf seinem Gesicht ein Lächeln. Das war an sich schon ein seltenes Ereignis, aber dieses spezielle Lächeln war ein besonderes, es war sein Siegerlächeln. Dieser Tag würde ihm zum Durchbruch verhelfen. Er glaubte fest daran, den Täter zu kennen und ihn in der Falle zu haben.
Paul Hartfeld wachte mit einem Brummschädel auf. Die roten Ziffern seines Weckers zeigten ›8.16‹ an. In der Nacht hatte er sich unruhig hin und her gewälzt, in seinem Kopf erschienen immer wieder Augen, entsetzte und erstaunte Augen, das Unvermeidliche erkennende Augen und stumpfe Augen ohne Erwiderung. Sie alle blickten mitten in ihn hinein und in ihren Pupillen spiegelte er sich wider. Er kannte diese Nächte zur Genüge. Nach einem erledigten Auftrag schlief er nie gut, aber die letzte Nacht zeigte sich von der besonders schlimmen Sorte, gerade weil es diesmal gar kein Auftrag war. Vielleicht hatte er auch nur am Abend zuviel von dem Maltwhisky genossen.
Er zwang sich aufzustehen. Eine Dusche und ein starker Kaffee würden ihn wieder klarer werden lassen. Er ging ins Bad und schaute in den Spiegel. Eine Minute lang blickte er nur in sein Gesicht. Es war das erste Mal, dass er so intensiv sein neues Aussehen betrachtete. Da schaute ihn jemand aus dem Spiegel an, den er so gut kannte und doch kannte er ihn nicht. Ein merkwürdiges Gefühl. Als würde einem die eigene Seele aus einem fremden Körper ins Innere sehen.
Mit beiden Handflächen strich er vorsichtig über seine Wangen und das Kinn. Mit Daumen und Zeigefinger kniff er in die Haut. Er machte Grimassen und probierte aus, wie es wirkte, wenn er lächelte. Dann versuchte er es mit einem ärgerlichen und schließlich wütenden Ausdruck. Es sah albern aus. Das lag aber nicht an dem Gesicht. Er fand sogar, dass er sich mit dem neuen ›Outfit‹ verbessert hatte. Seine Gesichtszüge waren markanter geworden und ganz nebenbei hatte er jetzt ein paar Falten weniger. Er nahm seinen Rasierapparat in die Hand, schaute ihn an und legte ihn wieder weg. Er beschloss, sich einen Bart wachsen zu lassen.
Nachdem er sich geduscht und angezogen hatte, schluckte er eine Schmerztablette und ging mit seinem Frühstück ins Wohnzimmer. Sein Blick fiel im Vorübergehen auf die Anrichte. Dort lag noch immer die gestern benutzte Walther.
Ich werde nachlässig! Das wäre mir früher nie passiert, ärgerte er sich.
Sofort nach dem Frühstück nahm er sich die Waffe, reinigte sie sehr gründlich und kniete sich dann in eine Ecke neben dem Fernseher. Dort hob er zwei Bohlenstücke des Holzfußbodens an und versteckte die Waffe in dem Hohlraum darunter, in dem noch andere Dinge lagerten.
Er schenkte sich einen zweiten Kaffee ein, setzte sich in einen Sessel, legte den Kopf auf die Lehne und starrte an die Decke. Er versuchte, an die nächsten notwendigen Schritte zu denken. Es gelang ihm nicht.
Bald würde er in seinem Holzhaus in Schweden wohnen, mit einem kleinen See direkt an seinem Grundstück und viel Wald um das Haus herum. Einfach nur den Geräuschen der Natur lauschen, ohne den ständigen Lärm von Autos, Stimmen und Flugzeugen, ohne Zeitdruck und ohne Pläne zu schmieden für den nächsten Job. Ohne Angst vor einer Spezialeinheit der Polizei, die seine Wohnungstür aufbrach oder vor einem Auftraggeber, der ihn als Sicherheitsrisiko einstufte.
Er könnte sich einen Hund anschaffen. Wenn du einen Hund gut behandelst, ist er ein treu ergebener Gefährte, der dir nie in den Rücken fällt. Und man wäre da draußen nicht ganz allein. Das wäre mal etwas Neues, wenn nicht vielleicht sogar Maria …
Hartfeld lebte seit mehr als zwanzig Jahren allein. Es gab keinen Freundeskreis, keine gemeinsamen Geburtstagsfeiern, kein Familienfest zu Weihnachten, keine Einladungen. Wenn sein Geburtstag nahte, kaufte er sich ein paar Tage vorher ein Geschenk, packte es hübsch in Geschenkpapier ein und versteckte es vor sich selbst im Kleiderschrank hinter den Pullovern. Am Abend vor dem Tag deckte er sich einen schönen Frühstückstisch mit dem guten Geschirr, einigen Kerzen und Tischsets. Es gab dann morgens ein besonderes Frühstück mit frischen Brötchen, gekochtem Ei und edlem Aufschnitt. Danach holte er das Geschenk aus dem Versteck und packte es langsam und sorgfältig aus. Schließlich gönnte er sich noch ein Glas Sekt, prostete sich zu und wünschte sich alles Gute.
Zu Weihnachten gab es ein anderes Ritual. Rituale waren wichtig, um die innere Ordnung aufrechtzuerhalten. Am Heiligabend kaufte er vormittags mit sehr viel Sorgfalt ein, dann bereitete er in Ruhe alles für ein mehrgängiges Menü vor. Im letzten Jahr gab es als Vorspeise eine Bär-lauchcremesuppe, danach gegrillte Forelle mit provenzalischen Kräutern und zum Nachtisch Zitrone-Mascarponecreme. Er kochte nicht oft, aber dann mit Leidenschaft. Nach dem Essen gönnte er sich einen schweren Portwein. Er bestellte sich ein Taxi und ließ sich in die Innenstadt fahren. Dann suchte er in verschiedenen Bars und Clubs nach weiblichen Wesen, die dort – ebenso einsam wie er – versuchten, diesen Abend ohne einen Absturz in Selbstmitleid zu Ende zu bringen. Oft wurde er in den Bars erstklassiger Hotels fündig. Die Nächte mit diesen Frauen waren nur selten tolle Erlebnisse, aber immerhin lag ein warmer, lebendiger Körper neben ihm und manchmal passierte es, dass zwei Menschen, ohne sich zu kennen, miteinander für ein paar Stunden harmonierten. Das war mehr, als man erwarten konnte. Und es gab später keine Probleme. Er nahm die Frauen nie mit nach Hause, er nannte einen falschen Namen und schlich sich davon, während sie noch schliefen. Keine Probleme.
Am ersten Weihnachtstag war die Ordnung wieder hergestellt. Er saß allein in seiner Wohnung und beschäftigte sich mit Irgendwas, oder mit gar nichts. Es war erbärmlich. Wenn er es genau betrachtete, war es die logische Fortsetzung seiner Kindheit. Hartfeld kannte das Gefühl eines Familienlebens mit Liebe, Geborgenheit und Verständnis nicht. Er hatte immer nur versucht, es sich vorzustellen. Gab es so etwas wirklich?
Seine Eltern waren beide voll berufstätig. Die Mutter arbeitete als Lehrerin, der Vater war ein hoher Beamter im Innenministerium. Man gehörte zu den Besserverdienenden, obgleich es diesen Begriff am Anfang der sechziger Jahre noch nicht gab. In den ersten Jahren seines Lebens wurde Hartfeld von einer Haushälterin erzogen, später war er meist auf sich allein gestellt. Die Eltern legten viel Wert darauf, dass er schon früh in der Lage war, sich selbst zu versorgen. Sie verfolgten ihr Ziel mit viel Disziplin und unnachgiebiger Strenge. Prügelstrafen waren nicht tabu und Hartfelds Hinterteil machte mehr als einmal Bekanntschaft mit dem Kochlöffel aus Holz, obwohl er eher zu der Sorte Kind gehörte, die wenig Unsinn anstellte. Er versuchte oft, sich an Situationen zu erinnern, in denen er von seinen Eltern getröstet und gestreichelt worden war, aber es gelang ihm nicht. Er glaubte inzwischen fest daran, dass seine Zeugung nur ein Versehen der Eltern war.
Probleme existierten für seine Eltern grundsätzlich nicht, sie wurden von den dicken Teppichen in der Wohnung einfach verschluckt. Da half auch kein Schreien, sein Zuhause wirkte wie ein schalltoter Raum. Wenn man ein Problem einfach ignorierte, gab es kein Problem. Ein verschwiegener Konflikt wurde als nicht existent betrachtet. Als Jugendlicher hatte er einmal zaghaft versucht, seinen Eltern von seiner großen, unerfüllten Liebe zu einer Klassenkameradin zu erzählen. Sie würgten das Gespräch gnadenlos ab. Beide sprachen übergangslos von etwas anderem, als hätte er soeben kein einziges Wort gesagt.
»Darüber spricht man nicht.« So lautete der Lieblingssatz seines Vaters.
Seine Familie kam ihm vor wie eine Walnuss. Irgendwo hinter der harten Schale musste es doch etwas geben, das es wert war, entdeckt zu werden, dachte er. Aber der kleine Junge hatte viel zu wenig Kraft, um die Schale zu knacken. Wahrscheinlich hätte er im Inneren nur eine verfaulte Frucht vorgefunden.
Vater und Mutter verstarben vor mehr als zehn Jahren. Die Beerdigungen stellten schwere Prüfungen für ihn dar. Nicht, weil er so sehr litt, dass der unvermeidliche Tod seine Eltern ereilt hatte. In ihm herrschte eher das Gefühl, befreit zu sein. Es fiel ihm ungeheuer schwer, vor der versammelten und völlig unbedeutsamen Verwandtschaft eine Trauer zu heucheln, die er nicht empfand. Bei der Beisetzung seines Vaters hätte er gern am offenen Grab den Mittelfinger gezeigt und ›ich lebe noch‹ gebrüllt. Er tat es nicht.
Zu der Zeit hatte er schon acht erfolgreiche Aufträge hinter sich, und doch brachte er es nicht fertig, einer Trauergemeinde von rund dreißig Menschen seine wahren Gefühle zu zeigen und gegen die allgemein gültigen Konventionen zu verstoßen. Ständig kamen Leute zu ihm, die ihr Mitleid bekundeten und erwarteten, dass er sie erkannte und entsprechend reagierte. Doch bei den meisten hatte er nicht den blassesten Schimmer, wer diese Menschen waren.
Und am Ende der Leichenschmaus. Onkel Willi war, wie bei allen großen Familienfeiern, schon nach kurzer Zeit sturzbetrunken und erzählte jedem, der es hören oder nicht hören wollte, von seinen geschäftlichen Glanztaten, von denen alle Anwesenden wussten, dass es sie nie gegeben hatte. Tante Helga bekam einen Weinkrampf nach dem anderen, obwohl sie mit ihrem Bruder seit drei Jahren kein einziges Wort gewechselt hatte. Die pubertierenden Cousinen zweiten Grades plapperten über irgendeinen Popstar und quietschten dabei wie junge Ferkel. Und als zu späterer Stunde schon mehr als genug Alkohol geflossen war, diskutierten alle über die bevorstehende Testamentseröffnung. Ein Rudel Wölfe hatte eine höhere soziale Kompetenz als diese Familien-Bande. Am Ende der Veranstaltung wollte Hartfeld zum ersten Mal in seinem Leben aus einem Gefühl heraus töten.
Hauptkommissar Hansen war trotz seiner Nachtschicht schon am nächsten Morgen um 10 Uhr wieder im Büro. Sein erster Anruf galt dem gerichtsmedizinischen Institut. Überraschenderweise meldete sich Doktor Peters am Telefon.
»Morgen, Heinrich, hier ist Harry. Bist du schon wieder im Dienst?«
»Und was ist mit dir, Harry? Schiebst du eine Doppelschicht?«
»Nee, ich habe nur schlecht geschlafen. Hast du was für mich?«
»Ich bekam Druck von oben. Ich gehe aber gleich nach Hause. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe was für dich. Der Doktor hatte Übergewicht, schlechte Leberwerte und einen zu hohen Cholesterinspiegel. Ärzte! Sie sollten eigentlich am Besten wissen, wie man seine Gesundheit erhält, aber sie leben nur selten danach. Naja, das hat ihn nicht umgebracht, hätte es aber vielleicht später einmal. Brüggemann starb eindeutig durch den Schuss in den Kopf. Der Schusskanal verlief in einem Winkel von etwas weniger als 30 Grad von oben nach unten. An der Eintrittswunde habe ich keine Schmauchspuren gefunden. Es war also kein aufgesetzter Schuss. Der Schütze hat nach meinen Berechnungen an der gegenüberliegenden Wand vor dem Spiegel gestanden. Es fanden sich keine weiteren Merkmale von Gewaltanwendung, keine Hämatome oder Spuren von Fesseln. Das Opfer ist arglos gewesen und hat deshalb auch keine Ausweichbewegung gemacht. Der Todeszeitpunkt liegt ziemlich genau bei 19.30 Uhr. Sonst noch was?«
»Nee, danke, das sind doch schon klare Ergebnisse. Geh nach Hause und schlaf dich aus.«
»Das mache ich. Tschüss Harry, bis bald.«
Hansen drückte kurz auf die Hörertaste und wählte sofort die Nummer der Spurensicherung. Dort hatte man aber noch keine Ergebnisse. Er musste geduldig sein. So nah vor dem ersehnten Ziel fiel ihm das schwer. Das Jagdfieber hatte ihn endlich wieder gepackt. Deshalb war in den letzten Stunden an Schlaf auch nicht zu denken gewesen. Wenn er mit seiner Vermutung Recht hatte, würde er bald den größten Erfolg seiner Laufbahn feiern können, allerdings nur ganz still für sich allein. Denn die Öffentlichkeit oder seine Vorgesetzten durften von den Hintergründen nichts erfahren. Diese Geschichte würde sein ganz persönlicher Triumph werden, und er nahm sich vor, ihn in vollen Zügen genießen.
Der einzige Mensch, der in Hartfelds Leben eine gewisse Bedeutung hatte, war Maria, die Hure. Er lernte sie in einer Kneipe auf St. Pauli kennen. Er erinnerte sich noch ganz genau, wie er auf einem Hocker am Tresen saß und sein drittes oder viertes Bier trank. Er wollte nur austrinken und dann mit einem Taxi nach Hause fahren. Vor zwei Stunden hatte er einen Auftrag erledigt. Er hatte saubere Arbeit geleistet, keine Probleme. Alles lief genau so, wie er es geplant hatte. Der Mann war im Sessel vor dem Fernseher eingeschlafen, das machte es noch leichter. Da Hartfeld einen nachgemachten Schlüssel für die Wohnungstür hatte, war das Eindringen ein Kinderspiel. Im Fernsehen lief eine Reportage, der Fernseher übertönte den schallgedämpften Schuss. Der Mann starb im Schlaf. Alles bestens.
Dann fiel sein Blick auf ein Foto, das in der Regalwand stand und sein Opfer an einem Strand zeigte, daneben eine dunkelhaarige Frau und zwei Kinder. Alle vier lachten glücklich in die Kamera. Die Kinder schienen zwischen vier und sechs Jahre alt zu sein. Sie würden nun ohne ihren Vater aufwachsen. So war das eben. Ihr Vater hatte betrogen. Er hatte Leute betrogen, die so etwas sehr übel nahmen. Er hatte Leute betrogen, die über Leben und Tod bestimmen konnten.
Es ist nicht meine Schuld, beruhigte sich Hartfeld halbherzig.
Maria betrat die Kneipe, sah sich kurz um, traf eine Entscheidung und setzte sich auf den Hocker neben ihm. Sie sah ihn an. Er sah sie an. Sie bestellte einen Cola-Bacardi, zündete sich eine Zigarette an, wandte sich ihm zu und sagte: »Ich werde jetzt diesen Scheißtag ersaufen. Machen Sie mit?«
Einige Sekunden lang schwiegen beide. Sie sah ihn immer noch an, mit klaren blauen Augen.
»Eine gute Idee«, antwortete er schließlich.
Der Abend wurde lang, früh am Morgen verließ er mit Maria die Kneipe. Beide waren sehr betrunken. Trotzdem erinnerte er sich an alles, was geschehen war. Es war unmöglich, auch nur das kleinste Detail zu vergessen. Er erinnerte sich sogar an die Sonnenstrahlen, die sie wärmten, als sie das Lokal verließen, an die Stimmen der Vögel, an den Geruch der Straße. Und an ihren Geruch, den er einsog, als wäre es ein Heilmittel gegen alle Krankheiten der Welt. Vor allem gegen seine spezielle Krankheit.
Sie nahm ihn mit zu sich nach Hause. Sie lebte damals in einer kleinen Zweizimmerwohnung in Altona. Die Wohnung war mit viel Geschmack und einem sicheren Gefühl für Farben eingerichtet worden. Sie strahlte Wärme und Geborgenheit aus. Es gab keine Unordnung und alles wirkte sauber. Das gefiel Hartfeld. Er neigte nicht nur in seinem Beruf zur Pedanterie.
Maria zog die Vorhänge im Schlafzimmer zu. Die Morgensonne erzeugte mit ihrem Versuch, die Vorhänge zu durchdringen, ein eigentümliches, diffuses Licht. Sie zog ihre Kleider aus. Sie zog ihn aus. Er stand da, bewegungslos, ließ es geschehen, sah ihren nackten Körper an, versuchte, sich alles einzuprägen, als würde er ein Foto von ihr in seinem Gehirn abspeichern. Er wollte diesen Moment unbedingt unvergänglich konservieren.
Sie küsste ihn. Er öffnete bereitwillig seinen Mund für ihre Zunge. Noch immer reagierte er nur. Sie führte ihn. Sie nahm sein Glied in ihre Hand und massierte es gekonnt. Er schloss die Augen und wollte nur noch fühlen, nichts mehr denken. Dann führte sie seine Hand mit sanftem Druck zwischen ihre Beine. Seine Finger streichelten sie und spürten die aufkeimende Feuchtigkeit. Die Küsse wurden heftiger, fast brutal. Sie ließ sich auf das Bett sinken und zog ihn mit. Er legte sich auf den Rücken, breitete die Arme aus und sie setzte sich auf ihn. Es musste ein Traum sein, die Realität sah anders aus. Hatte sie ihm Drogen eingeflößt? Er spürte die Mauern fallen.
Als sie sein Glied in sich einführte, löste sich alles auf. In seinem Kopf existierte das erste Mal in seinem Leben nichts anderes als fühlen, riechen, schmecken, genießen. Die Vergangenheit wurde unwichtig, es zählte nur das Jetzt.
Acht Jahre waren seitdem vergangen. Nach dem plötzlichen, gewaltsamen Tod ihres Zuhälters arbeitete Maria auf eigene Rechnung in einem solide geführten Bordell. Sie war zufrieden mit ihrem Leben und froh, nicht mehr der Brutalität eines Mannes ausgesetzt zu sein, der sie als sein Eigentum betrachtete. Mit den Jahren hatte sie zwar ein paar Kilo angesetzt, sah aber trotz ihrer fünfunddreißig Jahre mit den blondgelockten Haaren, dem ebenen Gesicht und ihren das Licht reflektierenden hellblauen Augen sehr attraktiv aus. Ihr Erfolg bei den Freiern beruhte aber hauptsächlich auf ihrer offenen und herzlichen Art. Sie verstand es, den Männern das Gefühl zu geben, sie wären bei einer Freundin. Von ihren Stammkunden verlangte sie keinen bestimmten Obolus, sie bat die Männer, einen ihnen angemessen erscheinenden Betrag in einen Briefumschlag zu legen und ihr diesen zu geben. So bekamen die Freier das Gefühl, freiwillig zu zahlen, es war eher ein Geschenk an eine Freundin als eine Zahlung für eine Dienstleistung, wie ein Kleidungsstück oder ein Schmuckstück, das man seiner Geliebten schenkt. Es nahm dem Ganzen den Geschmack der Anrüchigkeit. Und die Summe fiel meist höher aus als nötig.
Maria war der einzige Mensch, mit dem Hartfeld ein freundschaftliches Verhältnis pflegte. Sie trafen sich regelmäßig und die Leidenschaft lebte weiter. Keiner von beiden stellte Ansprüche an ihre Beziehung. Sie verhielten sich zueinander wie zwei befreundete Staaten. Jeder achtete die Souveränität und das Territorium des Anderen. Man hatte gemeinsame Interessen und eher gemeinsame Feinde als gemeinsame Freunde. In der Not war man füreinander da. Außerdem betätigte sich Maria als einer von Hartfelds Satelliten. Die Satelliten waren so etwas wie freie Mitarbeiter für Hartfeld. Sie arbeiteten im Milieu oder hatten gute Kontakte dorthin.
Sie bildeten seine zusätzlichen Augen, Ohren und Nasen auf einem sehr sensiblen und von ständigen Machtverschiebungen geprägten Terrain. Für Hartfeld war es lebenswichtig, über alle Veränderungen auf diesem Gebiet Bescheid zu wissen. Wer hatte wo seine Interessen? Wer koalierte mit wem? Welche Figuren erschienen neu auf dem Spielfeld? Die Satelliten versorgten ihn stetig mit allem, was ihnen an Informationen zugetragen wurde. Es handelte sich um Barkeeper, Taxifahrer, Türsteher, Huren und andere Personen, die ständig im Milieu arbeiteten. Die meisten hatte er natürlich in Hamburg, aber auch in Frankfurt, Berlin, München und einigen anderen europäischen Städten gab es Informanten. Es hatte Jahre gebraucht, dieses Netzwerk aufzubauen. Mancher tat es für das Geld, das Hartfeld für die Informationen zahlte, aber es gab auch Leute, denen er mal aus der Klemme geholfen hatte und die damit ihre Schuld bezahlten. Dabei ging es nicht immer darum, jemanden aus dem Weg zu räumen. So hatte er zum Beispiel einmal einem Kosovo-Albaner geholfen, eine Taxilizenz zu erhalten, indem er ihm bei den umfangreichen Formalitäten half. Der Mann erwies sich später als äußerst wertvoll, weil er viele Kontakte zu seinen Landsleuten hatte, auch zu den kriminellen. Er selbst hatte sich nie kriminell betätigt. Die Satelliten hatten noch eine weitere Funktion. Sie bildeten das Bindeglied zwischen ihm und seinen Auftraggebern. Soweit es möglich war, vermied Hartfeld den direkten Kontakt zu denen, für die er seine Aufträge ausführte. Das hatte zwei Gründe:
Erstens lernten ihn die Auftraggeber nicht persönlich kennen. Sie konnten also auch nichts über ihn ausplaudern und ihn nur schwer finden, falls es ihnen einfiel, sein Wissen als Bedrohung zu empfinden.
Zweitens erhöhte diese Vorgehensweise ihre eigene Sicherheit. Falls Hartfeld doch einmal von der Polizei erwischt werden sollte, hatten sie nie Kontakt zu ihm gehabt und eine Verbindung ließ sich wesentlich schwerer nachweisen.
Die Satelliten kannten Hartfeld meistens nicht in seiner normalen Erscheinung. Wenn er überhaupt persönlichen Kontakt zu ihnen aufnahm, dann nur in einer seiner zahlreichen Verkleidungen. Vor vielen Jahren, als er sich noch am Beginn seiner Karriere befand, belegte er einen mehrwöchigen Maskenbildnerkurs, um alles zu lernen, was seiner äußeren Tarnung dienlich sein konnte. Aber die meisten Kontakte liefen inzwischen über Telefon und Internet. Mehrere Prepaid-Handys und eine leere Wohnung mit Internet- und Telefonanschluss waren dabei sehr nützlich. Nur wenige vertrauenswürdige Satelliten kannten sein wirkliches, sein früheres Aussehen vor der Operation. Sein neues Antlitz kannte nur Maria und dabei sollte es auch bleiben. Niemand kam so nah an ihn heran wie Maria.
Harry Hansen arbeitete mehr als zwei Stunden konzentriert und allein in seinem Büro, bevor er merkte, dass sein Körper nach dem weggelassenen Frühstück dringend Nahrung brauchte. Sorgfältig legte er alle auf dem Schreibtisch ausgebreiteten Akten wieder auf einen Haufen und packte sie zurück an ihren Platz in der untersten Schublade, die er immer verschlossen hielt. Es waren die Kopien von Akten mehrerer ungeklärter Fälle. Keiner seiner Kollegen wusste von diesen Kopien.
Er freute sich, dieses kleine Einzelbüro zu haben. Wenigstens etwas, nachdem man ihm den Posten ›Erster Kriminalhauptkommissar‹ und damit Vertreter des Dienststellenleiters trotz seiner vielen Dienstjahre verweigert und ihm einen wesentlich jüngeren, studierten Schnösel vor die Nase gesetzt hatte. Inzwischen hatte er sich damit abgefunden, und manchmal, wenn er die Sache objektiv zu betrachten versuchte, musste er zugeben, dass die Vorgesetzten richtig entschieden hatten. Nicht unbedingt mit der Person – Michael Thorwald war in Hansens Augen ein instinktloser Technokrat – aber schon mit der Entscheidung, Hansen nicht zu nehmen. Denn Harry Hansen war alles andere als ein Teamplayer, wie man neudeutsch sagte, und insofern gänzlich ungeeignet, eine Abteilung auch nur vertretungsweise zu leiten. Außerdem hasste er die seiner Meinung nach völlig unnützen, ständig sich vermehrenden Sitzungen über Maßnahmen zur Steigerung der Effektivität, zur Kostenreduzierung und die immer neuen Verwaltungsstrukturreformen.
Es ging bei seiner Arbeit doch um Verbrechensbekämpfung und nicht um die Beschäftigung mit dem hauseigenen Apparat. Würde man das Geld und die Zeit, die in der Verwaltung verschwendet wurden, in gute Aufklärungsarbeit investieren, wäre die Quote der nicht aufgeklärten Fälle deutlich geringer, dessen war sich Hansen sicher.
Gerade, als er sich erheben wollte, um in die Kantine zu gehen, ging die Bürotür auf und Michael Thorwald betrat den Raum. Thorwald war Anfang vierzig, schlank, durchtrainiert, glatt rasiert, elegant gekleidet und perfekt frisiert, also das genaue Gegenteil von Hansen. Als er vor anderthalb Jahren das erste Mal im Polizeipräsidium auftauchte, blickten ihm alle Augen der weiblichen Kollegen sehnsüchtig hinterher. Doch schon bald machte sich Enttäuschung breit, als sich herumsprach, dass er verheiratet sei und zwei Kinder habe.
»Mahlzeit, Herr Hansen«, grüsste Thorwald und setzte sich auf den einzigen Besucherstuhl gegenüber von Hansen.
Das hat mir gerade noch gefehlt, dachte Hansen. Er setzte sein bestes künstliches Lächeln auf und grüßte zurück.
»Sie sind ja früh wieder im Dienst nach Ihrer Nachtschicht. Gut, dass Sie so engagiert an den Fall Brüggemann gehen, das gefällt mir. Und es ist auch dringend nötig.«
Hansen sagte nichts.
»Haben Sie schon einen Verdächtigen?«
»Nun mal langsam mit den jungen Pferden, Herr Thorwald. Der Mord ist erst vor …«, er blickte auf die Uhr an der Wand, »… 16 Stunden passiert und ich bin zwar ein guter Polizist, aber kein Zauberkünstler.«
Hansen klang leicht gereizt. Thorwald hob beschwichtigend die Hände.
»Das war nur eine Frage und sollte keine Kritik sein. Es ist nur so, wir kriegen da ziemlich viel Druck von oben, der Fall wird in der Öffentlichkeit einiges an Staub aufwirbeln. Da Kriminaloberrat Jobst wohl noch einige Zeit wegen seiner Krankheit fehlen wird, bleibt der ganze Mist nun an mir hängen.«
Hansen verstand überhaupt nicht, worauf Thorwald hinaus wollte und das konnte man ihm auch ansehen. Thorwald beugte sich vor und stützte seine verschränkten Arme auf Hansens Schreibtisch.
»Das Opfer, dieser Dr. Brüggemann, war nicht irgendein Arzt. Er hatte sehr viele prominente Leute unter seinen Patienten.« Thorwald sprach leiser. »Und die möchten verständlicherweise sicher sein, dass die Unterlagen des Doktors mit einer gewissen Diskretion bearbeitet werden. Diese Leute wären nicht sehr glücklich darüber, wenn in den nächsten Tagen in der Boulevardpresse zu lesen wäre, welche Makel von Herrn Brüggemann bei wem beseitigt wurden. Sie verstehen, was ich meine?«
»Glauben Sie etwa, ich würde Einzelheiten einer laufenden Untersuchung an die Presse weitergeben?«
»Nein, natürlich nicht. Ich meinte nur, es ist erforderlich, die Untersuchung mit etwas Fingerspitzengefühl durchzuführen. Und dafür sind Sie nicht unbedingt berühmt, sorry«, fügte er mit einem Lächeln hinzu.
Hansens Blutdruck, der aufgrund von wenig Schlaf und wenig Essen eben noch in den unteren Bereichen vor sich hin gedümpelt hatte, erreichte nun blitzschnell sein Tageshoch.
»Soll das etwa heißen, dass Sie mir den Fall entziehen wollen, weil ich nicht feinfühlig genug ermittle?«
Hansens Tonfall hatte eine Schärfe, die gegenüber einem Vorgesetzten unpassend war, doch Thorwald ignorierte es und antwortete mit ruhiger Stimme.
»Davon kann keine Rede sein, Hansen. Es geht nur darum, dass ich denke, Sie könnten etwas Unterstützung brauchen, vor allem im Kontakt mit den Journalisten, die schon bald wie die Heuschrecken über uns herfallen werden.«
Hansen guckte erwartungsvoll. Thorwald fuhr fort.
»Deshalb möchte ich Sie bitten, entgegen Ihrer Gewohnheit diesen Fall zusammen mit dem Kollegen Bernstein zu bearbeiten. Er kann Ihnen einige Routinearbeiten abnehmen und den nötigen Kontakt zur Presse halten.«
Normalerweise arbeiten in der Mordkommission sechs Bereitschaften, die jeweils aus vier Sachbearbeitern und einem Hauptkommissar bestehen. Hansen genoss bisher in der Mordkommission das Privileg, seine Fälle allein bearbeiten zu dürfen und nur im Bedarfsfall Unterstützung zu bekommen, wenn er darum bat. Er war zwar auf die Mitarbeit anderer Kollegen angewiesen, weil kein Kommissar einen Mordfall allein bearbeiten kann, aber er hatte kein festes Team. Es war eine Art Anerkennung für seine Erfolge und gleichzeitig die Resignation seiner Vorgesetzten vor seiner Einsiedlermentalität.
Hansen setzte sich kerzengerade auf, um seinen Protest gegen Thorwalds Vorschlag zu formulieren. Es passte nicht in sein Konzept, einem Kollegen Einblick in die Ermittlungen im Fall Brüggemann zu geben. Er schaute in Thorwalds gebräuntes Gesicht und schlagartig wurde ihm klar, dass dessen Bitte keine Ablehnungsoption enthielt.
»Na schön«, brummte er. »Wenn Sie meinen …«
»Fein!« Thorwald wirkte erleichtert, er hatte mit mehr Widerstand gerechnet. »Dann schicke ich den Kollegen gleich zu Ihnen.«
»Ich wollte eigentlich jetzt essen gehen«, maulte Hansen.
»Okay, dann kommt Herr Bernstein eben danach zu Ihnen.«
Thorwald schaute auf seine Armbanduhr.
»So gegen eins?«, fragte er freundlich.
»Ja, das passt.«
Thorwald verschwand mit dynamischen Bewegungen aus dem Büro und ließ einen grübelnden Hansen zurück.
Thomas Bernstein war erst seit zwei Monaten bei der Mordkommission, trotzdem hatte der junge Kriminalkommissar sich innerhalb der Abteilung schon Anerkennung erarbeitet. Der sehr schlanke, rothaarige, groß gewachsene Mann mit der langen Nase wurde von seinen Vorgesetzten als zuverlässig, zielstrebig und intelligent geschätzt. Seine freundliche und hilfsbereite Art machte ihn bei den Kollegen beliebt. Er hatte das gesunde Selbstbewusstsein eines Menschen, der weiß, was er kann. Doch nun stand er vor der verschlossenen Bürotür von Hansen und kratzte sich nervös die Kopfhaut. Bisher hatte er kaum mit Hansen zu tun gehabt, aber die Kollegen hatten ihm einiges über den Charakter des Hauptkommissars erzählt. Die Zusammenarbeit mit ihm dürfte nicht leicht werden.
Bernstein schaute auf seine Uhr: drei Minuten nach eins. Sollte er nun hier warten oder lieber wieder an seinen Arbeitsplatz gehen?
Während er noch darüber nachdachte, sah er Hansen auf den langen Flur einbiegen. Diese Frage war also geklärt.
Hansen hatte bei Bratkartoffeln mit Spiegeleiern in der Kantine das ›Problem Bernstein‹ analysiert und war zu dem Schluss gekommen, es mit einer für ihn völlig neuen Taktik zu versuchen, mit Freundlichkeit. Ein zweigleisiges Vorgehen war vonnöten. Er würde dem jungen Kollegen das Gefühl geben, vollwertig an den Ermittlungen beteiligt zu sein, ihm aber gleichzeitig gewisse Informationen vorenthalten. Hansen kannte Bernsteins Ruf als Arbeitstier, also musste er ihn ausreichend mit scheinbar wichtigen Dingen beschäftigen.
Hansen näherte sich, streckte die Hand aus, lächelte und sagte:
»Hallo Herr Bernstein, schön, dass Sie schon da sind. Dann will ich Sie gleich mal in den Stand der Ermittlungen einweihen. Kommen Sie rein.«
Hansen öffnete die Bürotür und ließ Bernstein den Vortritt.
Der war so verblüfft über die freundliche Begrüßung, dass er zunächst gar nichts sagte. Dann brachte er aber doch ein »Guten Tag, Herr Hansen« über die Lippen.
Beide setzten sich an den Schreibtisch und Hansen erklärte Bernstein den Sachverhalt. Die wenigen vorliegenden Fakten waren schnell aufgezählt. Hansen erwähnte auch den Druck von oben, und den Vorschlag von Thorwald, dass Bernstein sich zusammen mit der Abteilung für Presseund Öffentlichkeitsarbeit um die Stellungnahmen für die Presse kümmern sollte. Der Kommissar nickte dazu nur.
»Und wie soll es jetzt weitergehen?«, fragte er schließlich.
»Sie sollten sich mal die Patientenakten des Doktors vornehmen. Vielleicht finden Sie dort Hinweise auf Kunstfehler oder unzufriedene Patienten. Eine irreparabel verunglückte Operation wäre immerhin ein nachzuvollziehendes Tatmotiv. Außerdem könnten Sie bei der Spusi anfragen, ob da erste Ergebnisse vorliegen. Übrigens haben wir auch den Computer des Doktors beschlagnahmt. Fragen Sie mal nach, ob darauf etwas Brauchbares zu finden war. Oder noch besser, schauen Sie sich das Ding selbst an. Ich habe gehört, Sie kennen sich mit der Materie ganz gut aus.«
»Das stimmt, Computer sind mein Hobby.«
»Gut, dann ist ja alles klar, ran an die Arbeit!«
»Geht klar, Herr Hauptkommissar«, sagte Bernstein mit Elan.
»Das mit dem Hauptkommissar lassen Sie mal, Bernstein. Ein einfaches ›Chef‹ genügt.«
»Jawohl, Chef. Und was werden Sie heute tun, wenn ich fragen darf?«
»Dürfen Sie eigentlich nicht, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Ich werde mich mit den Angestellten der Praxis unterhalten. Irgendjemand muss ja bei den Operationen assistiert haben, die der Doktor nebenbei gemacht hat. Außerdem will ich noch mal den Putzmann befragen. Ich habe das Gefühl, der weiß mehr über die Geschäftspraktiken des ehrenwerten Herrn Doktors, als er bisher gesagt hat.«
Bernstein verließ das Büro und war erleichtert. So angenehm hatte er sich den Einstieg in die Zusammenarbeit mit dem Hauptkommissar nicht vorgestellt. Ein fast euphorisches Gefühl überkam ihn. Die Arbeit an diesem Fall konnte sehr spannend werden. Wie spannend es wirklich werden sollte, ahnte er nicht.
Als Hansen vor die Tür des Polizeipräsidiums trat, zündete er sich sofort eine Zigarette an und sog den Rauch in seine Lungen. Schon seit längerer Zeit war das Rauchen in allen Ämtern der Hansestadt verboten. Das gefiel ihm zwar nicht, aber er hielt sich daran. Vor allem die Zigarette nach dem Essen und zum Kaffee vermisste er sehr.
Der norddeutsche Herbstwind blähte seine Jacke auf und ließ ihn frösteln, aber wenigstens regnete es nicht. Während er zu seinem Wagen ging, schaute er auf seinen Notizblock mit den Adressen der Angestellten von Dr. Brüggemann. Er beschloss, mit der Leiterin des Praxisteams, Frau Waldheim, zu beginnen. Vielleicht konnte er sich danach die Gespräche mit den anderen Mitarbeiterinnen sparen oder sie dem Bernstein aufs Auge drücken.
Die Adresse in Niendorf fand er ohne Probleme. Es war ein kleines, gepflegtes Siedlerhaus aus den sechziger Jahren mit einem üppig bepflanzten Garten, der von einer hohen Hecke umrahmt wurde. Einige Sekunden nach seinem Klingeln wurde die Tür geöffnet. Frau Waldheim trug eine geblümte Bluse unter einer blassgrünen Strickjacke und einen grauen Faltenrock. Ihre dauergewellte Frisur passte zu der unauffälligen, etwas altmodischen Kleidung. Aus den Personalakten wusste Hansen, dass sie zweiundfünfzig Jahre alt war, geschätzt hätte er sie auf Anfang sechzig.
Nachdem er sich vorgestellt und seinen Ausweis gezeigt hatte, bat Frau Waldheim ihn in das Wohnzimmer. Die Einrichtung schien mindestens zwanzig Jahre alt zu sein, aber alles wirkte sehr gepflegt. Auf den Fensterbänken und in den Regalen der mächtigen Schrankwand war allerlei bunter Nippes ausgestellt. Hansen hatte nie begriffen, was Frauen an diesem unnützen Kitsch faszinierte. Den angebotenen Tee lehnte Hansen dankend ab, dann begann er die Befragung.
»Frau Waldheim, Sie wissen natürlich, warum ich hier bin.«
»Ja natürlich, Herr Kommissar, das ist wirklich eine ganz schreckliche Geschichte mit dem guten Doktor Brüggemann. So ein Ende hat niemand verdient. Wie soll es denn jetzt bloß weitergehen? Der Doktor hat ja niemanden, der die Praxis weiterführen könnte. Das trifft ja nun auch die Angestellten hart. Ich bin ja nun auch schon über fünfzig, da findet man nicht mehr so leicht was Neues.«
»Frau Wald…«
»Naja, mein Mann verdient ja nun auch nicht schlecht, also, wir würden schon irgendwie über die Runden kommen. Aber unsere Auszubildende, was soll die denn jetzt machen? Heute will doch kaum noch einer die jungen Leute ausbilden.«
»Frau …«
»Und dann erst die Nadja, also die Frau Kunze meine ich, die ist ja nun allein erziehend, hat eine fünfjährige Tochter, Mareike heißt sie, ein süßes Ding ist das, sage ich Ihnen. Ach Gott, das ist wirklich eine schreckliche Sache.«
Kurze Pause, zu kurz für Hansen.
»Also, wenn Sie mich fragen, ich glaube ja, dass einer der Patienten der Mörder ist. Vielleicht war ja einer unzufrieden mit seinem neuen Aussehen. Nicht, dass der Doktor gepfuscht hätte, nein, der war eine Kapazität! Aber Wunder konnte er ja nun auch nicht vollbringen, obwohl manche das erwarteten. Wie ist das nun eigentlich mit unserem Lohn, wird der weitergezahlt, oder wie läuft das?«
Hansen bekam Ohrenrauschen.
»Das weiß ich leider nicht, Frau Waldheim«, antwortete er. »Könnten Sie mir jetzt ein paar Fragen beantworten?«
»Aber gern, Herr Kommissar.«
Frau Waldheim gefiel offensichtlich die Rolle der wichtigen Zeugin.
»Zunächst interessiert mich, wer üblicherweise bei den Operationen assistiert hat.«
»Ja nun, meistens war ich als OP-Schwester dabei, manchmal hat das auch Frau Kunze übernommen. Und dann gab es noch den Anästhesisten, Doktor Stein. Der ist aber seit einer Woche im Urlaub. Seine Vertretung hat immer Frau Doktor Berthold gemacht.«
»Ich habe gehört, dass Doktor Brüggemann manchmal besondere Termine für besondere Leute gemacht hat. Wissen Sie darüber etwas?«
Frau Waldheim rutschte unruhig mit ihrem Hinterteil auf dem Plüschsofa hin und her.
»Ähm, also, ja nun … man soll ja den Toten nichts Schlechtes nachsagen, aber …«
»Frau Waldheim, es geht hier um Mord! Sie müssen mir alles sagen, was Sie wissen!«
»Also direkt Wissen kann man das nicht nennen. Ich habe da so Gerüchte aufgeschnappt und mir einiges zusammengereimt.«
»Und was haben Sie sich zusammengereimt?«
Hansen beschloss, sich ein blutdrucksenkendes Mittel zu besorgen, wenn er noch mehr solche Gespräche führen musste.
»Es gab immer wieder mal Operationen zu komischen Zeiten. Einmal habe ich den Doktor darauf angesprochen. Er hat mich ziemlich unfreundlich zurechtgewiesen, das ginge mich nichts an und er müsse die Privatsphäre seiner prominenten Patienten schützen. Naja, ehrlich gesagt, ein netter Chef war er ja nun nie. Und dann hat sich eines Abends die Nadja Kunze verplappert. Wir hatten uns über die ständig steigenden Preise aufgeregt, und darüber, dass der Euro ja nun alles teurer gemacht hat. Und als ich dann über den Geiz von unserem Chef meckerte, meinte sie, dass er aber die Extradienste ganz gut bezahlen würde. Ich hab’ sie ganz erstaunt angeguckt, weil ich nicht wusste, was sie meinte. Ich glaub’, sie war erschrocken und dann hat sie das Ganze als Scherz abgetan und ist weggegangen. Also, merkwürdig war das schon.«
»Eine Frage noch, Frau Waldheim. Wann haben Sie gestern die Praxis verlassen?«
»Gestern bin ich früh gegangen, so gegen 14 Uhr, ich hatte ja nun nachmittags einen Zahnarzttermin.«
»Ist Ihnen am Vormittag etwas Außergewöhnliches aufgefallen? Oder an den Tagen davor?«
Frau Waldheim überlegte einen Moment, dann verneinte sie die Frage.
Hansen beendete das Gespräch und verabschiedete sich. Für den Fall, dass Frau Waldheim noch etwas einfiele, hinterließ er seine Visitenkarte. Auf dem Weg zu seinem Auto zündete er sich eine Zigarette an.
Ja nun, dann wollen wir mal der Frau Kunze ein wenig auf den Zahn fühlen, dachte er, irgendeine Spur muss ich dem Thorwald präsentieren können, damit er mich in Ruhe weitermachen lässt.
Paul Hartfeld verbrachte den Vormittag damit, seine Wohnung zu putzen. Ein unvoreingenommener Betrachter hätte es nicht für nötig gehalten. Es war eine Form der Entspannung und es brachte Normalität in sein Leben.
Nach dem Mittagessen legte er sich auf die Couch und ließ die Gedanken schweifen. Damit konnte er Stunden verbringen. Und es war für ihn eine Form der Therapie. Ein Mann mit seinem Beruf hatte nicht die Möglichkeit, seine Probleme einem Psychotherapeuten anzuvertrauen. Auch die Schweigepflicht eines Therapeuten hatte ihre Grenzen. Er musste schon selbst für seine seelische Gesundheit sorgen.
Hartfeld sah sich als einen Mann mit besonderen Fähigkeiten, der eine außergewöhnliche Dienstleistung anbot und sich dafür gut bezahlen ließ. Er war kein Psychopath, der Vergnügen beim Töten empfand. Er war auch kein Soziopath ohne die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden. Er war ebenso wenig eine roboterhafte Tötungsmaschine. Er verwirklichte nur die dunklen Träume anderer Menschen.
Wenn man die Dinge wertfrei, abstrakt und dialektisch betrachtete, gab es immer eine Rechtfertigung für einen Mord. Der Verstand konnte logische Erklärungen für jede Tat finden. Anhänger extremer Ideologien bewerteten ihre grausamen Handlungen aus der Grundlage der eigenen Sichtweise heraus als moralisch einwandfrei. Kaum ein Mensch kann ohne diese sich selbst erteilte Legitimation einen anderen töten, ohne eine Schuld zu empfinden. Von den Kreuzrittern über die Nationalsozialisten bis zu den radikalen Islamisten: Alle gaben sich selbst die Legitimation für ihr Handeln durch die eigene Ideologie. Es war die simple Logik, nach der jemand, der nicht mein Freund ist, mein Feind sein muss.
Hartfeld war zu klug, um sich selbst auf diese Weise zu täuschen. Trotzdem suchte sein Verstand einen Ausweg aus dem moralischen Dilemma. Nicht er war es, der ein Todesurteil aussprach. Er führte nur aus, was andere verlangten. Die Auftraggeber waren die Mörder, er diente nur als Waffe, eine sehr zuverlässige und präzise Waffe. Viele Jahre hatte er sich damit beruhigt und doch hatte es nicht wirklich funktioniert. Er konnte sich nicht freisprechen. Es gab einen ständig wiederkehrenden Traum, einen merkwürdigen Albtraum, den er nicht zu deuten wusste.
Ein Strand, der Blick auf das Meer, kaum Wellen, zwischen den nackten Zehen spürte er die Sandkörner. Das Tageslicht zog sich zurück, ein kühler Wind verursachte eine Gänsehaut. Das war kein Urlaubsparadies in der Südsee, eher die dänische Ostseeküste. Seine Augen suchten den Horizont ab, als wäre er ein Schiffbrüchiger, der verzweifelt nach dem Hoffnungsschimmer einer Schiffssilhouette Ausschau hält. Aber er war nicht allein.
Knirschende Schritte im Sand, die sich von hinten näherten, langsam, leise und irgendwie bedrohlich. Ängstlich drehte er sich um. Ein Mann kam auf ihn zu, hatte ihn schon fast erreicht, ein riesiger Kerl, über zwei Meter lang und so breit wie ein Sumo-Ringer, ohne dabei fett zu sein. Er breitete seine muskelbepackten Arme aus und machte einen weiteren Schritt auf Hartfeld zu, der nun Panik bekam und weglaufen wollte. Doch er konnte seine Füße nicht aus dem Sand heben, der plötzlich zu zähem Honig geworden war. Trotz aller Anstrengung konnte er keinen einzigen Schritt machen. Der Hüne hatte merkwürdigerweise keine Mühe, voranzukommen.
Er erreichte Hartfeld nach zwei ausholenden Schritten. Er legte seine baumstammdicken Arme um ihn und lachte mit weit geöffnetem Mund. Hartfeld blickte in den Schlund und sah keinen einzigen Zahn, nur eine pelzige, blutrote Zunge. Das Lachen des Hünen klang wie das Grollen einer Gerölllawine. Seine um Hartfelds Oberkörper geschlungenen Arme zogen ihn zu sich heran, dann hob er ihn hoch, als sei Hartfeld ein leichter Block aus Styropor. Der Druck der Arme erhöhte sich stetig, dabei lachte der Kerl immer noch. Hartfeld versuchte verzweifelt, sich aus dem brutalen Griff zu befreien, er wand sich, er stemmte sich mit beiden Händen gegen die Brust des Hünen, er zappelte mit den Beinen in der Luft – es half alles nichts.
Der Druck nahm ihm die Luft, die Rippen knackten und der Schmerz im Rücken wurde unerträglich. Das Monster würde ihm das Rückgrat brechen und ihn zerquetschen wie ein Autoreifen, der einen Igel überfährt. Er spürte, wie seine Muskeln im Kampf erlahmten. Kleine sternförmige Punkte im Dunklen der geschlossenen Augen, der Brustkorb wie in einem Schraubstock, das Schwinden der Sinne. Kämpf weiter! Es geht nicht, ich schaffe es nicht. Zählen Sie jetzt rückwärts von zehn bis null. Bei sechs verlässt mich mein Geist. Aus, Ende, alles vorbei. Das Erwachen im schweißnassen Bett brachte keine Erleichterung.
Hartfeld wusste genau, dass es so nicht weitergehen konnte. Wenn er sein Leben nicht radikal änderte, würde er in nicht allzu ferner Zukunft durchdrehen, der innere Druck war kaum noch auszuhalten. Oder er würde einen entscheidenden Fehler machen und den Rest seines Lebens hinter schwedischen Gardinen verbringen, wie der Knast so schön umschrieben wurde. Warum nannte man das eigentlich ›schwedische Gardinen‹? Er wollte ja tatsächlich hinter schwedischen Gardinen leben, allerdings im ursprünglichen Sinn. Er spürte, wie seine Nackenhaare feucht von Schweiß wurden und beendete abrupt die Gedankenspiele. Ablenkung tat Not!
Ein feistes, ungesundes Essen mit viel Fleisch beim Griechen ein paar Straßen weiter und dazu etwas zu viel Ouzo, das würde ihm heute Abend gut tun.
Als Nadja Kunze die Tür öffnete, sah Hansen eine schlanke, modisch gekleidete Frau mit halblangen, blonden Haaren, großen blauen Augen mit langen Wimpern und einer Nase. Was für eine Nase! Hansen merkte, dass sein Blick nur noch auf diese Nase gerichtet war und es war ihm augenblicklich peinlich. Aber man konnte unmöglich daran vorbeischauen. Sie war sehr lang und schmal. Etwa in der Mitte hatte der Nasenrücken einen Höcker wie bei einem Dromedar. Dann machte er wieder einen Schwung nach unten, um danach kräftig nach oben zu streben und sich im scharfen Kontrast zur Schmalheit an der Spitze in zwei große Knollen zu verbreitern. Die darunter liegenden feinen Lippen verstärkten die Dominanz der Nasenspitze zusätzlich.
Hansen merkte, wie er darauf schielte. Dann schaffte er es doch, sich loszureißen und in Nadja Kunzes Augen zu blicken, in denen man deutlich lesen konnte, dass Frau Kunze ähnliche Situationen schon öfter erlebt hatte.
»Hauptkommissar Hansen«, stellte er sich bemüht sachlich vor, »ich habe ein paar Fragen bezüglich des Todes von Doktor Brüggemann an Sie.«
»Natürlich, kommen Sie rein.«
Frau Kunze ging voran und Hansen folgte ihr in das sehr modern und unpersönlich eingerichtete Wohnzimmer.
»Ich wüsste allerdings nicht, wie ich Ihnen helfen könnte. Ich hatte wenig Kontakt zum Doktor, außer bei der Arbeit natürlich«, ging sie sofort in die Verteidigung.
Harry Hansen war lange genug bei der Kripo tätig, um sofort zu wissen, dass die Kunze etwas verbergen wollte. Der häufigste Fehler von Leuten, die etwas nicht sagen wollten, war, genau das indirekt schon zu Beginn eines Gespräches klar zu machen, indem sie behaupteten, Antworten nicht zu kennen, für die man noch gar keine Fragen gestellt hatte. Hier war er richtig, und die Taktik konnte nur der direkte Angriff sein.
»Für den Anfang würde es reichen, wenn Sie mir sagen, wie viel Ihr Chef denn für die Extradienste so springen ließ«, antwortete Hansen mit leicht aggressivem Unterton.
»Äh, ich verstehe nicht, was Sie damit meinen.«
»Was ich meine? Ich meine damit die zahlreichen Operationen zu später Stunde, die mit Sicherheit nie in den offiziellen Geschäftsunterlagen auftauchten und die unter der Hand gezahlten Löhne für Ihre Hilfe, von denen das Finanzamt kaum etwas weiß. Oder irre ich mich da?«
Frau Kunzes Körpersprache war so eindeutig, auch für den dümmsten Psychologiestudenten wäre es ein Leichtes gewesen, sie zu durchschauen. Ihre Finger nestelten nervös an ihrem Rocksaum, während ihre Unterlippe zitterte, als ob sie halbnackt bei minus zwanzig Grad in der Wildnis stehen würde. Aber sie schwieg.
»Frau Kunze, wir reden hier nicht über einen Ladendiebstahl oder Trunkenheit am Steuer. Ich untersuche einen Mord und noch dazu einen sehr kaltblütigen und professionell ausgeführten Mord. Reden Sie! Schon um Ihrer eigenen Sicherheit willen.«
Frau Kunzes Abwehrwall bestand nur aus Pergamentpapier.
»Ich hab’ doch nur, ähm, also der Doktor … Ich hatte doch keine Wahl! Er hat mich erpresst!«
Nadja Kunze war offensichtlich mit ihren Nerven am Ende und von der Situation überfordert. Sie hatte Angst, das war mehr als deutlich zu spüren. Hansen wechselte den Tonfall, sprach nun ganz ruhig.
»Keine Sorge, Frau Kunze, es passiert Ihnen nichts. Jetzt erzählen Sie erst mal, was Sie wissen, dann kann ich Ihnen auch helfen.«
Sie ging zu einer aus Metall und Glas gefertigten Regalwand, nahm sich ein Papiertaschentuch und schnäuzte sich die Nase. Dann setzte sie sich in einen dieser modernen Sessel mit U-förmiger Lehne, die nur für schlanke Menschen konstruiert wurden. Hansen blieb lieber stehen.
»Wie hat Doktor Brüggemann Sie erpresst?«, fragte er.
Sie tupfte mit dem Taschentuch ihre Augen ab, knüllte das Tuch in ihrer Hand zusammen und sah ihn an. Dann machte sie den Rücken gerade, holte Luft und es sprudelte aus ihr heraus wie aus einem Überdruckventil.
»Erpresst ist vielleicht zu hart gesagt, aber er hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder helfe ich ihm bei den Operationen nach Feierabend oder er findet einen Grund, mich zu entlassen. Er wusste von den Problemen mit meiner Tochter. Sie müssen wissen, meine Tochter Mareike ist lernbehindert. Sie ist ein ganz tolles, liebes Mädchen, aber sie braucht eben etwas länger als andere Kinder, um etwas Neues zu lernen. Ich möchte nicht, dass sie in eine Schule für geistig Behinderte kommt, da gehört sie nicht hin. Damit sie nächstes Jahr auf einer normalen Schule anfangen kann, braucht sie spezielle Förderung. Und diese Förderkurse kosten Geld. Ohne den Zusatzverdienst von den Operationen könnte ich mir die Kurse nicht leisten. Und ohne Job erst recht nicht! Brüggemann hat auf mich eingeredet. So könnte ich doch meiner Tochter helfen, ich würde ja nichts Schlimmes tun und dass er mir vertrauen würde. Aber wenn ich mich weigern würde, hätte er kein Vertrauen mehr zu mir, dann müsste ich mir eben was anderes suchen. Was sollte ich denn machen?«
Hansen sah sie an, und er merkte, wie sich Mitleid in ihm regte. Und da war noch etwas anderes. Er ging zu ihr und legte ganz leicht seine Hand auf ihre Schulter.
»Frau Kunze, was Sie getan haben, war zwar ein bisschen illegal, aber ich bin ja kein Finanzbeamter. Ihr Nebenverdienst interessiert mich eigentlich nicht, ich muss einen Mörder finden. Und für Ihr Motiv habe ich viel Verständnis. Machen Sie sich wegen der Steuern keine Gedanken, ich muss das in meinem Bericht nicht erwähnen. Was können Sie mir über den gestrigen Tag erzählen?«
Sie drehte sich zu ihm um und blickte offen in seine Augen. Ein kleiner Stromstoß durchzuckte ihn.
»Ja, da ist noch was, das ich Ihnen sagen muss. Deshalb bin ich auch ziemlich nervös. Ich machte so gegen sieben Feierabend. Dann ging ich runter in den Keller, um mein Fahrrad zu holen. Als ich mit dem Fahrrad die Treppe hoch wollte, kam ein Mann in das Treppenhaus. Ich glaube, das war der Mörder! Ich hab’ ihn in der schlechten Beleuchtung nicht gut sehen können. Außerdem trug er so einen komischen Hut mit breiter Krempe, der sein Gesicht verdeckte. Trotzdem meine ich, ihn von irgendwoher zu kennen. Und oben in der Praxis war zu der Zeit außer dem Doktor niemand mehr.«
»Hat er Sie auch gesehen?«
»Das weiß ich nicht.« Ihre Stimme klang ein wenig ängstlich. »Aber es könnte sein.«
»Wissen Sie noch, welche Farbe der Hut hatte?«
»Es war eine helle Farbe, weiß oder cremefarben.«
Hansen überlegte. Die Geschichte wurde langsam wasserdicht. Eine Zeugin sah den Mann mit dem Panamahut kurz vor dem Mord zur Praxis gehen, ein anderer Zeuge sah höchstwahrscheinlich denselben Mann kurz nach dem Mord aus der Praxis verschwinden. Leider hatten beide das Gesicht nicht richtig sehen können.
»Warum glauben Sie, die Person zu kennen?«
Nadja Kunze dachte nach. »So genau kann ich das nicht sagen. Aber etwas an ihm kam mir bekannt vor. Möglicherweise habe ich ihn mal kurz in der Praxis gesehen, kann aber auch woanders gewesen sein. Das klingt alles ziemlich vage, nicht wahr?«
»Würden Sie den Mann bei einer Gegenüberstellung wieder erkennen?«
»Vielleicht … ich kann das nicht mit Sicherheit sagen.«
»Nun gut, wenn Ihnen einfallen sollte, wieso er Ihnen bekannt vorkam, sollten Sie mich sofort informieren. Und zwar ausschließlich mich, reden Sie bitte mit keinem anderen darüber«, sagte Hansen eindringlich und gab ihr seine Karte.
»Gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Bin ich in Gefahr?«
»Ehrlich gesagt, es ist möglich. Wir wissen ja nicht, ob der Mann Sie auch gesehen hat. Ich halte es deshalb für besser, wenn Sie mit Ihrer Tochter für ein paar Tage woanders wohnen, nur, um ganz sicher zu gehen. Wo ist Ihre Tochter eigentlich?«
»Bei einer Freundin zum Spielen.« Kunze schaute auf ihre Armbanduhr.
»Oh, ich muss los, um sie abzuholen.«
»Wenn Sie wollen, kann ich Sie hinbringen«, bot Hansen an.
»Nein, das ist nicht nötig, vielen Dank«, lehnte sie freundlich ab. »Es ist nur ein paar Schritte entfernt, ich kann zu Fuß gehen.«
Schade, dachte er. »Na gut, wissen Sie denn, wo Sie die nächsten Tage unterkommen können?«
»Meine Schwester lebt in Bielefeld, da könnten wir eine Weile bleiben.«
»Dann machen Sie das. Packen Sie ein paar Sachen und bleiben Sie einige Tage dort. Ich brauche die Adresse und Telefonnummer, damit ich Sie erreichen kann.«
Frau Kunze schrieb sie ihm auf und brachte ihn zur Tür. Er nahm ihre Hand zum Abschied und hielt sie länger fest als nötig. Er wandte sich zum Gehen, drehte nach zwei Schritten wieder um und kam zurück.
»Eine Frage habe ich doch noch.«
Schweigen und der Blick in ihre faszinierenden Augen. Die Nase nahm er gar nicht mehr wahr. Sie sah ihn gespannt an.
»Mir ist in Ihrer Wohnung ein …«, er suchte nach dem richtigen Wort, »… eine Diskrepanz aufgefallen. Die Einrichtung wirkt sehr modern und kühl, ich finde, das passt nicht zu Ihnen. Außerdem, ich bin zwar kein Fachmann, aber ich denke, dass diese Designermöbel ziemlich teuer sind. Wieso brauchen Sie Geld für die Förderung Ihrer Tochter und geben gleichzeitig viel Geld für die Einrichtung Ihrer Wohnung aus?«
Sie lächelte. »Sie sind ein sehr genauer Beobachter. Und ich fasse Ihre Äußerung als Kompliment auf, denn Sie haben Recht. Die Wohnungseinrichtung passt wirklich nicht zu mir, ich mag sie auch nicht. Das meiste hat mein verstorbener Mann gekauft. Er starb vor zwei Jahren bei einem Verkehrsunfall. Ich hab’ ihm immer gesagt, dass er zu dicht auffährt. Als sein Wagen unter das Heck von dem LKW rutschte, hatte er keine Chance mehr. Naja, das ist Vergangenheit. Statussymbole wie diese Möbel waren ihm wichtig. Leider hatte ich bis jetzt kein Geld übrig, um mir Sachen zu kaufen, die ich mag.«
Ihre Stimme bekam einen wütenden Unterton. »Hätte er nur einen Teil des Geldes in eine Lebensversicherung eingezahlt, würde es Mareike und mir heute besser gehen. Ich wollte diese supertollen Möbel verkaufen, aber keiner wollte mehr als ein paar lächerliche Euro dafür zahlen. Also habe ich sie erstmal behalten.«
Nadja Kunze versprach Hansen, sich aus Bielefeld zu melden und sie verabschiedeten sich. Er ging nicht die Treppen aus dem zweiten Stock hinunter, er hüpfte gut gelaunt hinab. Bis er merkte, dass sein wohlgenährter Bauch in schlingernde Bewegungen verfiel. Das sah bestimmt nicht vorteilhaft aus. Also nahm er wieder seinen üblichen gemächlichen Gang auf und summte dabei leise vor sich hin. Auf dem Weg zu seinem Wagen fragte er sich, woher die gute Laune kam. Er fand keine einleuchtende Erklärung und beließ es vorerst dabei. Nun war es Zeit, zurück ins Präsidium zu fahren und mit Bernstein zu reden.