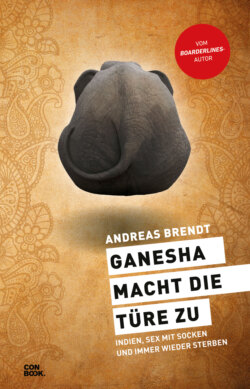Читать книгу Ganesha macht die Türe zu - Andreas Brendt - Страница 7
ARAMBOL UND DIEVERRÜCKTEN
ОглавлениеAlles ist schwarz.
Eine tiefe Dunkelheit füllt den Raum. Meine Augen könnten geöffnet sein oder geschlossen, das macht keinen Unterschied. Ich sehe Nichts. Wunderschönes, weites Nichts. Ich treibe, schwebe, bin leicht und schwerelos. Umgeben von Unendlichkeit.
Alles ist still.
Jeder Ton, jede Vibration, jede Bewegung ist verschwunden in den wundersamen Weiten der Finsternis. Frieden, Behaglichkeit, Leere. Ich fühle mich geheimnisvoll geborgen und gleite durch ein Meer aus Dunkelheit. Ohne Aufgabe, ohne Erinnerung, ohne Zeit …
Aber dann.
Plötzlich.
Und.
Ohne.
Vorwarnung!
Ein Vorschlaghammer aus Stahl kracht mit brutaler Wucht auf meine Stirn. Zertrümmert meinen Schädel, vernichtet jede Ruhe und reißt mich mit einem grellen, silbernen Blitz aus der zarten Trance heraus in furchtbaren Schmerz. Ich kauere auf allen Vieren, mein Kopf klebt auf den vergilbten Badezimmerfliesen. Die Atmung scheucht mit kurzen, schnellen Stößen durch meine Brust. Was zur Höll…?
Mit letzter Kraft hebe ich mein Haupt ein paar Zentimeter an. Meine verklebten Augen versuchen etwas zu erkennen und sehen Blut. Mein Blut.
Ich stütze den rechten Arm auf, ächze, wische mit dem linken Unterarm über meine Stirn und glotze auf das in den Härchen verschmierte Rot. Scheiße! Unendliche Erschöpfung drückt mich zurück zu Boden, ein Sack aus Blei liegt auf meinen Schultern, ich will einfach liegen bleiben. Zurück in die Dunkelheit.
Erinnerungen blitzen auf, Zusammenhänge, Fragen, Unverständnis. Der Schädelschmerz ist überwältigend. Das kann alles nicht wahr sein. Ich liege irgendwo in Indien auf dem Fußboden, bin mit der Stirn knallhart auf den Fliesenboden gekracht. Habe vielleicht den Kopf gebrochen. Kacke. Meine Kniescheiben pochen, denn die sind zuerst aufgeschlagen, als der Körper zusammengesackt ist, und mein Schädel schreit um Hilfe. Aber hier ist niemand.
Eine dicke Kakerlake flitzt die matten Fugen entlang, bleibt stehen, ihre Fühler wackeln, sie krabbelt weiter und verschwindet im Abfluss in der Ecke.
Vor ein paar Stunden stand alles im Zeichen der wunderbaren letzten Nacht des Jahres. Goa-Wahnsinn, Vollmondparty, Elektro-sound und Silvesterliebe. Dann wurde es komisch. Elend. Übelkeit drang in meinen Leib, und Böses erwachte. Innerhalb von Minuten wich das Leben aus meinem Körper. Hinsetzen, anlehnen, zusammensacken, die Kehle eng, die Augenlider schwer wie Blei. Mir wurde schlecht. Und schlechter. Also aufrappeln, bevor es zu spät war, bevor der heilige Gral (das Bett) unerreichbar würde. Der Weg zurück nahm kein Ende. Als ich den zitternden Schlüssel ins Schloss bugsiert und die Tür aufgestoßen hatte, hing ich direkt über der Schüssel. Gerade noch rechtzeitig. Um mir nicht nur die Eingeweide, sondern auch den letzten Rest meiner geschwächten Seele aus dem Leib zu reihern.
Dann meldete sich mein Darm. Und wie! Das Brodeln im Magen mutierte urplötzlich zu einem Überdruck, zu einem prall aufgeblasenen Luftballon im gesamten Unterleib, um dann in einer Spritzkacke-Explosion die komplette Schüssel zu verwüsten. Die totale Entleerung. Mein gedemütigter Leib hing reglos auf den Oberschenkeln.
Als ich mich völlig erledigt und zitternd aufrichtete, wurde alles seltsam schwarz.
Und – für eine kleine Unendlichkeit – erlösend schön.
Bis es krachte.
Ich lege mich auf die Seite, bette den dröhnenden Kopf auf den Oberarm, betrachte die rissigen Fugen zwischen den Fliesen und bin dankbar, dass es vorüber ist.
Ich schließe die Augen. Liegen. Einfach nur liegen. Für immer. Trotzdem will ich nicht blutverschmiert zu Füßen einer dreckigen Toilette verrecken. Ich öffne die Augen, krieche auf allen Vieren zu meinem Bett, ziehe mich hoch, stöhne, verdränge die kurz aufkeimende sinnlose Idee, lebensgefährlich verletzt zu sein, und zwinge mich, obwohl die Wasserflasche zehn Kilo wiegt, zu einer Kopfschmerztablette. Ich sinke mit einem verzweifelten Gedanken auf das Kopfkissen:
Der 1. Januar 2015.
Das Jahr kann nur besser werden.
Meine Augen öffnen sich. Ich atme aus, betrachte den Raum. Sonnenstrahlen schimmern in der Luft, ich spüre das Meer in nicht allzu großer Ferne. Auf dem Kopfkissen kleben Blutflecken. Ole schlummert im Bett neben mir, er ist also zurück. Der Schädelschmerz pocht leise vor sich hin, aber kein Brechreiz bahnt sich an. Nicht mal Übelkeit, und das ist wichtig, denn Übelkeit ist das klassische Symptom der Gehirnerschütterung. Ohne ist ein Schädelbasisbruch unwahrscheinlich. Hoffnung. Ich seufze und spreche ein Gebet zum Universum, denn mit etwas Glück ist der gestrige Überfall auf meinen Verdauungstrakt bereits Geschichte. Alles raus. Mit voller Wucht auch die letzten Scheißmikroorganismen aus dem System katapultiert.
Das wäre so schön!
Ich trinke einen Schluck Wasser. Mein Körper ist einverstanden, akzeptiert die rettende Flüssigkeit. Wie wenig es doch braucht. An manchen Tagen reicht es aus, wenn dir nicht kotzübel ist. Dann ist alles tippitoppi und die Welt der reinste Sonnenschein. Ich lese eine halbe Seite in meinem Buch, schlucke noch eine Schmerztablette und schlafe wieder ein.
Wir marschieren den kleinen, mit Palmen bewachsenen Hügel hinunter. Meine Beine zittern, schlagen sich aber ganz gut, denn Zucker und Koffein des eben eingenommen Notfallmedikaments stützen mich. Ich kenne kein wirksameres Mittel bei Kreislaufproblemen und Übelkeit, bin keinem Zaubertrank dankbarer. Ein flüssiges Gift, das den halben Planeten verführt und mit dem man Toiletten putzen kann, ist an manchen Tagen ein Geschenk des Himmels, um den angeschlagenen Menschen auf Trab zu bringen. Mein Kandidat für den Medizin-Nobelpreis: Coca-Cola.
Nach einer kurzen Weile betreten wir Oles Lieblingsrestaurant, und ich falle auf einen Stuhl an einem Tisch mit Blick auf den himmelblauen Ozean. Keine Wände, alles offen, ein paar Plastiktische unter einem Dach auf vier Säulen. Zarte Brise und Raum zum Atmen.
Einige Hundert Meter weiter das Meer entlang, um den kleinen Hügel herum, beginnt Arambol. Vielleicht der verrückteste Ort im vielleicht verrücktesten Bundesstaat (Goa) des vielleicht verrücktesten Lands (Indien) der Erde. Na gut, ob es wirklich so ist, kann ich nicht wissen. Es wäre aber schön. Und das herauszufinden, mag der Sinn dieser Reise sein. Die Durchschlagskraft der hiesigen Bakterien ist in jedem Fall verrückt. Ein Anfang.
»Äppi nu year, mei frrend! Ju enjoiih a gud night party?«, grinst Riski, während er die Speisekarten überreicht.
»Happy new year«, sagt Ole mit rauchiger Stimme und: »Yes, it was wonderful«, weil er sich wie zu Hause fühlt, obwohl er erst seit fünf Tagen hier ist. Immerhin viermal so lange wie ich.
»Woot häppen?«, fragt Riski in meine Richtung.
»I failed.«
Der kleine Kellner nickt. ›I fainted‹ wollte ich sagen, ›failed‹ passt aber genauso gut. Vielleicht sogar noch besser.
»And happy new year«, murmele ich.
»Thank you, mistar«, antwortet er, »I kom back in a no taim«, und wandert in die Küche zurück.
Ich lasse den Blick über das Wasser gleiten, als Riskis Worte wieder auftauchen: ›I come back in no time.‹ Klar, in Indien spricht sogar der Kellner weise Worte und erwähnt die Illusion der Zeit, bevor er davonspaziert, um die Spiegeleier zu wenden.
Ole studiert die Speisekarte und strahlt mehr Glück aus als zwei Lausbuben, die einen Sommer sturmfrei haben. Alles ist richtig, alles ist gut, der Lauf der Dinge auf unserer Seite.
Ein paar Schleierwolken schleppen sich über den Horizont. Mein Kopf wiegt eine Tonne.
Riski kehrt zurück, platziert Servietten, Besteck und eine kleine lila Blume auf unserem Tisch. Ich bestelle Brot, eine Banane und Tee. Riski schaukelt mit dem Kopf. Unfassbar, dass sich nach der demütigenden Dünnschisskotzerei vor ein paar Stunden so etwas wie Appetit einstellt. Bedenkt man allerdings die Intensität, mit der die Körperentleerung vonstattenging, ist es höchste Zeit etwas zu essen, bevor ich mich in Luft auflöse.
Wir reden über die letzte Nacht, die Partys am Strand, die nicht richtig in Schwung kommen wollten, und wie uns das Schicksal dann den Jackpot zugespielt hat. Zunächst nicht mehr als ein Gerücht. Eine grobe Richtung, eine Ungewissheit – aber ist es nicht da, wo meist das Glück zu finden ist?
Ein kleiner Weg schlängelte sich durch dunkle Bäume, irgendwo Lichter, dann Musik und plötzlich tätowierte Wilde, halbnackte Elfen, die Tanzwütigen voll im Flow. Ein Spektakel aus überschäumender Kraft und zarten Gefühlen, und wir auf einmal mittendrin. Umgeben von verliebten Schatten und durchdrungen von Raketen-Beats, die durch die klare Luft direkt in unsere Eingeweide wummsten. Schwarze Haare flogen durch die Nacht, Arme zum Himmel, Hüften taumelten in ausgefransten Jeanshotpants hin und her. Geschlossene Augen, die in ferne Sphären blickten, mit Mandalas bemalte Haut, schwebende Hände mit grünen, roten, blauen, gelben Fingernägeln, nackte Füße auf gesundem Waldboden. Der Rhythmus rauschte wie unsichtbare Energie in unsere Körper. Pochen, hüpfen, springen, springen, springen. Um uns zuckten Gestalten in ewiger Ekstase, alle in Trance, der Tanz frei und losgelöst. Meine ersten Stunden im gelobten Land.
Wie gut die Menschen waren. Das Zusammensein, die Lebendigkeit, die Musik, die Lichtblitze, die Fackeln und die Feuerstellen. Alkohol, Frieden, Joints, die ganze Suppe aus euphorischen Empfindungen und glücklichen Individuen, die sich an der richtigen Stelle versammelt haben, um gemeinsam zu diesem hemmungslosen Ereignis zu werden. Um das neue Jahr zu feiern. Und die Existenz.
»Ein schönes Fest.«
»Ja, so schön, so besonders. Bis um drei Uhr …«
»Ich habe noch nach dir geschaut.«
»Als hätte mir jemand den Stecker gezogen.«
»Als du dich auf den Boden gelegt hast, sahst du noch passabel aus. Ich dachte: Jetlag, das wird gleich wieder.«
Tee und Kaffee werden auf einem silbernen Tablett serviert. Riski ist total konzentriert, quasi ›Zen und die Kunst des Tee-Servierens‹, und guckt dabei so süß.
»Ja, fast.« Ich trinke einen Schluck Tee.
»Als ich heute Morgen den Blutfleck in der Toilette entdeckt habe, kamen Fragen auf.«
Ole schmunzelt, hält inne, schaut mich an und ist begeistert:
»Alter, noch keine zwei Tage in Indien, und schon das dritte Auge geöffnet.« Er gießt sich einen Schluck Milch aus dem silbernen Kännchen in den Kaffee.
Das dritte Auge ist das Tor zur Weisheit. Die Blutkruste auf meiner Stirn sitzt haargenau dort, wo der gemeine Inder seinen roten Farbklecks platziert, das Bindi. Damit wird dem Universum Hingabe signalisiert: bereit für die Erleuchtung. Rote Farbe? Lächerlich! Es muss Blut sein. Mindestens.
»Lasd night gud ixstatik party?«
Der Rest der Bestellung wird von Shorti geliefert. Er trägt wie Riski ein rotes Hemd und lange Stoffhosen. Sein Oberlippenbart ist stolz, der glänzende Scheitel auf seinem Haupt versprüht ordentliche Gelassenheit. Das Beste an ihm ist dieser nach innen gerichtete Blick. Jedes Mal huscht, eine Sekunde bevor er etwas sagt, ein Schmunzeln über sein Gesicht. Eine freudige Erwartung dessen, was als nächstes geschieht, welche Wirkung seine Worte haben, welche Wendung sich das Leben ausdenkt. Jetzt gerade ist es die Neugierde auf die Ereignisse der letzten Nacht.
»Ooohh.« Seine großen Kulleraugen blicken auf mein drittes Auge.
Ole lacht und nickt mit vollem Mund.
Ich winke ab: »I got sick.«
Shorti versteht.
Wir fühlen uns gut aufgehoben bei diesen beiden jungen Indern. Shorti und Riski haben ihre Bestimmung gefunden. Es ist mehr, als hungrige Mäuler zu stopfen und den Lebensunterhalt zu erwirtschaften. In ihrem Schuppen treffen sie die Menschen aus der Welt. Sie hören Geschichten, begleiten den Besuch in ihrem Land, schließen Freundschaften. Sie wissen, wie sehr wir sie vergöttern, auch wenn sie nicht verstehen, weshalb, und wir das nicht erklären können. Ist aber auch nicht nötig. Es ist, wie sie ihren Laden schmeißen, und das Vergnügen in den freundlichen Gesichtern, diese Zufriedenheit. Es ist das Einverstandensein mit dem, was ist. Vielleicht sind die beiden Heilige. Oder wir sind endlich offen, sind so neugierig, wie man meistens nur auf Reisen ist, dass wir das Besondere erkennen und das Gute sehen – egal mit welchem Auge.
Ole erzählt von der Party im Wald, Shorti freut sich, weil sein Land die Menschen begeistert. Dann schlendert er wieder in die Küche. Mein Schädel brummt, der Magen rumort.
»Das wird ein g.u.t.e.s Jahr!«
Ole ist so was von in seiner Mitte, stopft Ei und Schinken in seinen Rachen.
»Es kann nur besser werden.« Für mehr Optimismus fehlt mir die Kraft.
»Es passiert immer so viel. Und das geht jetzt alles erst richtig los. Alter, wir sind in Indien!«
»Stimmt, vorgestern bin ich noch durch den Schnee in Köln gestapft, gestern Wahnsinnsparty, Spirit total, um im Gegenzug dann Shiva kennenzulernen.«
»Der Gott der Zerstörung, der Bereiter eines jeden Neuanfangs.« Oles Freude über meinen Zusammenbruch tanzt in jeder Zelle.
»Den Jahreswechsel hätte ich auch ohne Magen-Darm-Erlösung hingekriegt.«
»Vielleicht ist so eine Darmreinigung ja gesund.« Ole grinst. »Da brauchst du keinen Einlauf mehr.«
Stimmt, aber noch bin ich nicht überzeugt von meinem Riesenglück.
»Die ganzen Gifte und der alte Dreck sind raus, der abgelagerte Morast ist entfernt, das System bereit für neue Taten.«
Gesundheitsfördernde Maßnahmen fühlen sich normalerweise anders an. Und: Man wird gefragt. Eine kleine Gemeinheit in meinem Hirn erinnert mich daran, Ole an seine Weisheiten zu erinnern, sollte es ihn erwischen.
»Und vergiss nicht deine magische Trance in der ewigen Dunkelheit.« Ole ist entzückt, der Kreislaufkollaps ein wichtiger Schritt hin zur Erleuchtung.
»Du meinst die Ohnmacht? Das war toll, nach offiziellen Schätzungen aber nur zwei oder drei Sekunden lang. Quasi im Sturzflug.«
»Zeit spielt keine Rolle. Die Intensität der Erfahrung ist das, was zählt.«
Genug davon, wir ordern die Rechnung, weil wir um den Hügel herum zum Strand wollen, um das neue Jahr mit einem Sonnenbad zu beginnen. Ich korrigiere, denn wir waren uns einig: um das neue Jahr mit einer Sonnenmeditation zu beginnen. Vermutlich gibt es keinen Unterschied, aber wir sind Spielkinder am Neujahrstag, und das ist schließlich Indien hier.
Während wir auf die Rechnung warten, zückt Ole sein Handy und versinkt darin. »Unfassbar …«
»Was?«
»… mit der Stirn, einem sechs Millimeter dünnen Knochen, im freien Fall aus 1,70 Metern Höhe auf den Fliesen eingeschlagen – und nicht tot.«
»Gut gemacht, ne?«
»Ich hab’s immer gesagt, wusste aber nicht, dass dir das mal das Leben rettet: Du bist ein Dickkopf.«
Ich lege mich noch mal hin. Eine Stunde später wandern wir den kleinen Pfad um die Klippe herum, schlängeln uns an den Shops und Verkaufsständen vorbei, die luftige, lange Stoffhosen, CDs, Tücher, Holzschnitzereien und alle möglichen Souvenirs anbieten. Räucherstäbchen verströmen ihren Duft, sanfte Sitar-Klänge schwirren aus kleinen Lautsprechern.
»Today, I am the manager«, sagt ein zehnjähriger Junge zu mir. Seine dunklen Augen leuchten. Er übernimmt heute die Schicht, weil seine Eltern zu einer kranken Tante fahren mussten.
Er hockt auf einen Schemel, springt auf, verschiebt einen Stapel T-Shirts, flitzt zurück. Er strahlt. Ich kaufe einen Sarong für drei Euro. Wir verabschieden uns mit »Namaste«. Gerne würde ich ihn drücken, aber kleine Manager drückt man nicht.
Die Großen in der Heimat leider auch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Gutes Gefühl, so weit davon entfernt zu sein. Vom Trott.
Eine Verkäuferin mit nur zwei Zähnen lächelt, ihre Bewegungen sind bedacht, Zufriedenheit umgibt ihr Wesen. Indien. Das Haar ist schwarz, die Menschen tragen Gewänder in allen Farben und einen roten Punkt auf der Stirn. Sie sind irgendwie wie Kinder. Aber auch wie stille Weise. Und hier an dieser Klippe gibt es weniger Verkaufsdrang, so ist Augenkontakt möglich, sogar ein unverbindlicher Blick auf die Waren, und immer wieder wünschen wir ein frohes neues Jahr und erhalten selige Glückwünsche.
Nach zehn Minuten endet der kleine Weg um die Klippe herum, und wir hüpfen in den Sand. Er ist fest, ein guter Untergrund, man sinkt kaum ein. Zu unserer Rechten das Meer. Vor uns liegt ein gigantischer, fast hundert Meter breiter Strand, der immer weiterläuft, vermutlich bis zum Nirwana. Gleichzeitig beginnt links von uns der legendäre Ort Arambol, das Auffangbecken für die Hippies, die sich in den Sechzigern durch den Nahen Osten in ihr gelobtes Land geschlagen haben.
Wir wandern das Meer entlang, bleiben nach einer kurzen Weile stehen, breiten die Handtücher aus. Kleine kristallblaue Wellen rollen heran. Sie verzaubern mich sofort. Seit über zwanzig Jahren reise ich kreuz und quer über den Planeten, weil die Liebe zu den Ozeanen zu meiner lebensbestimmenden Leidenschaft geworden ist. Surfen ist ein wunderbares Hobby. Nicht nur weil es mir die schönsten Momente im Wasser geschenkt hat, sondern auch weil ich auf der Suche nach der perfekten Welle durch so viele Länder und Kulturen streunen darf. Dabei kommt es zu Begegnung und Momenten, in denen alles stimmt. Wertvolle Sekunden, in denen das Subtile überwältigend ist. Magie. Es gibt nichts Schöneres, und es gibt nichts, was mir mehr Zuversicht schenkt.
Und jetzt Indien. Ein Kontinent, der die Wellenreiter nicht in Wallung bringt, und meine erste Reise seit zwanzig Jahren ohne Surfbretter. Neuland.
Aber Indien war immer klar. Vielleicht schon, seit ich mit 16 Jahren mein erstes Buch über Taoismus und Wu wei, die Kunst des Nichtstuns, gelesen habe. Die Impulse der fernöstlichen Philosophie haben mich bewegt und wurden zu einer zweiten treibenden Faszination. Sie nährten meinen Lebenshunger. Zunächst vorsichtig und dann mitten rein.
Genau wie beim Reisen: Pauschaltourist zu Schulzeiten, trieb es mich später in den vergessenen Dschungel einer entlegenen Insel. Oder beim Surfen: erst mit den kleinen Wellen spielen, und plötzlich Monster-Freakset auf die Fresse. Der Augenblick, wenn sich eine große Welle vor mir auftürmt, eine haushohe Wand aus Wasser in der nächsten Sekunde über mir zusammenbricht, mich unter Wasser drückt und durch die Gegend schleudert, bleibt für immer. Danach zittern die Knie, aber im Rückblick schmunzeln die Augen immer so schön. Es ist die Intensität, die mich aufwühlt. So ging es mit dem Reisen, so ging es mit dem Surfen, so geht es mit dem Blick nach innen. Von Büchern zu Workshops und Seminaren, zu stiller Meditation und wilder, zum Besuch bei Gurus und großen Lehrern, zu einzigartigen Momenten und natürlich gemeingefährlichen Rückschlägen.
Indien ist das Epizentrum. Hier tummeln sich die Weisen oder endgültig Verrückten. Buddha, Osho und Asketen. Yoga, Tantra, Hinduismus. Hängengebliebene Hippies, Erleuchtete, Propheten, Großmeister der Einbildung, Zufriedene mit kleinem Glück. Ein Subkontinent, der von Suche und Offenheit durchdrungen ist. Vielleicht nicht nur ein Subkontinent – vielleicht ein Energiefeld. Eine Kraft. Sicher ein Ort, an dem viele bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, sich Ungewöhnlichem zu stellen, neue Wege zu beschreiten, um etwas zu finden, von dem sie noch nichts wissen. Ein Schatz im Inneren. Es ist die aufopferungsvolle Suche nach etwas, das es vielleicht gar nicht gibt. Dazu braucht es Sehnsucht. Und einen Mount Everest an Vertrauen.
Trust!
Und die Menschen hier lachen viel. Das erinnert mich: Ich bin nach Indien gekommen, um etwas zu erleben, aber auch um etwas mitzunehmen. Etwas, das in mir wohnt, etwas, das mich aufrüttelt, weil mein Leben zu Hause farblos geworden ist. Absehbar und ohne Witz.
Ich lege mich hin und betrachte den Himmel. Ole ergreift die Wasserflasche, trinkt einen Schluck, bietet sie mir an, haut sich zurück aufs Handtuch. Minuten vergehen. In Rückenlage, der Planet Erde unter und Mama India über uns. Meeresrauschen in meinen Ohren, sanfte Brise auf meiner Haut. Der ewige Horizont über dem Ozean auf der einen und das gelobte Land auf der anderen Seite. Wir erheben uns gleichzeitig, setzen uns hin und richten die Wirbelsäulen auf. Wir grinsen, weil wir wie ein altes Ehepaar sind.
Jetzt wird meditiert. Ich verabschiede die Traumstrandkulisse, schließe die Augen, beobachte. Körperempfindungen: ein Kribbeln, Anspannung oder Bewegungsdrang. Mein Kopf brummt, der Magen ist mit dem Wiederaufbau beschäftigt. In den Handflächen ist immer was. Leere, Raum, Ausdehnung. Einbildung? Ich betrachte den Atem. Ein – aus – ein – aus – eher flach, kein Grund für Korrektur. Ich frage mich, ob die Wellen hier auch größer werden. Das sind meine Gedanken, denn die sind niemals still. Sie sind ein Teil von mir. Einfach vorbeiziehen lassen wie weiße Wolken. Einfach.
Nach den zehn Tagen Vipassana im Schweigekloster und den zwölf Stunden Meditation täglich dauerte die Gedankenlosigkeit Minuten lang. Meisterlich. Leider habe ich zwei Monate später mit dem Meditieren aufgehört und alles verlernt. Es ist also wieder mal der Kopf, der das Zepter in meinem Wesen in den Händen hält.
Ein alter Bekannter meldete sich mit guten Fragen: ›Was bringen die spirituellen Übungen?‹
Die Meditation, die Disziplin, die Stille, die wilden Sachen, das Öffnen der Gefühlsventile.
Ich weiß es nicht.
Aber es ist schön, den Schutzpanzer abzustreifen. Das Herz zu öffnen. Neues zu erfahren. Für mich! Es ist ein Hobby. Mehr aber auch nicht. In den westlichen Leistungsgesellschaften hat man den Fokus auf Rationalität gelegt. Auf Verstand, Kontrolle, Sicherheit, Funktionieren. Auf Angestelltengehorsam und Gesellschaftskonformität. Und auf das Außen, auf materielle Dinge wie Wohlstand und Beruf. Auf Gemütlichkeit. Auch hier kann Wärmendes geschehen. Tiefe Freundschaften, ein behagliches Zuhause, Kinder und Familie zum Beispiel. Irgendwie geht es doch immer nur um Liebe.
Na gut, manchmal geht es auch um Benzinpreise, Umsatzsteuer und schlechtes Wetter.
Aber in mir schlummert ebenso die Sehnsucht, unter den Tellerrand zu gucken. Der Blick nach innen ist so abenteuerlich wie Reisen oder Surfen. Wenn man Lust drauf hat. Wer Angst, Traurigkeit, Wut, Scham und anderen Gefühlen begegnen möchte, für den wird es kunterbunt.
Und Indien ist in. Ein Trend. Wer unlösbare Probleme hat, der wird spirituell, der muss nach Indien. Wer keine hat, der findet sie. Es ist ein Spiel mit dem Feuer oder eine Humormutprobe.
Ich will ehrlich suchen, mich der Tiefe öffnen, aber auch staunen und den Kopf schütteln dürfen. Ich bin gespannt, welche Magie mir in diesem Land begegnen wird. Was es mit mir macht.
Mein Magen rumort, das Herz klopft, denn das wird alles kein Spaziergang. Alles ist möglich und am Ende hoffentlich gut. Also auch zu Hause, denn ich möchte mit einer Veränderung zurückkehren.
In den letzten paar Tausend Jahren wurden unfassbare Methoden entwickelt. Übungen mit Vulkankraft, Atemtechniken, die den Menschen in animalischen Wahnsinn katapultieren. Diese Übungen, allein, mit Partner, in Gruppen sind abgefahren. Manchmal schwierig oder verstörend. Aber es ist befreiend, wenn die Tränen fließen dürfen oder die Fäuste geballt werden, um loszubrüllen. Manchmal wird man mit Trance belohnt, dem Drogenrausch ohne Substanzen, manchmal mit wohltuender Leere.
Und wieder: Was soll das bringen?
UND: Was ist Einbildung und was real?
Zwei Fragen, die mich im Idealfall so sehr interessieren wie weiße Wolken. Manchmal muss man die Zweifel Zweifel sein lassen und trotzdem weiter gehen.
Ich höre das Meer rauschen, die Vögel zwitschern.
Vielleicht kann Indien mir eine Antwort schenken. Vielleicht wird dies eine spirituelle Rei…
»Du fragst dich doch die ganze Zeit, ob du hier noch surfen kannst!«
Ich öffne die Augen. Ole setzt eine Sonnenbrille auf. Er hat mich voll ertappt, der verdammte Gedankenleser.
»Was ist denn das für ein mieser Diss? Ich kontempliere!«
Meditatives Denken. Zuweilen bemerkenswert, weil Intuition und Bauchgefühl mit kühnen Vorschlägen überraschen. Jetzt eine gute Ausrede fürs Abgelenktsein, denn er hat mich erwischt.
»Okay«, beschließt Ole, »ich habe auch keinen Bock mehr zu meditieren. Lass uns ein bisschen durch den Ort spazieren.«
Wir verlassen den Strand und laufen an winzigen Läden, baufälligen Gebäuden, kleinen Geschäften, einem verstaubten Kopierladen und dubiosen Agenten vorbei.
Es gibt kleine Hotels und Restaurants sowie dreckige Hütten mit Plastiktischen und Speisekarten. Dazwischen Wohnhäuser aus Beton, selbsternannte Hostels, Internetcafés, eine Arztpraxis. Ich versuche, mich zu orientieren. Die Hauptstraße besteht aus festem Lehmboden und verläuft parallel zum Meer. Die meisten Gebäude trennen den Strand vom Inland und haben auf der Rückseite die Sonnenliegen für die russischen Pauschaltouristen, eine Strandbar für die Althippies oder Esstische mit Meerblick. Kein Elend, kein Leid, Indien zeigt sich hier in Arambol im leichten Gewand. Ich gehe weiter, blicke in die Shops, laufe an Männern mit hüftlangen Rastalocken vorbei, Pärchen mit Yogamatten unterm Arm und jungen, lauten, testosterongeschwängerten Israelis, denen ich auf der ganzen Welt begegne. Sie wollen nach dem Militärdienst die Welt entdecken und wieder leben. Und sich die Hörner abstoßen.
An einer gigantischen Laterne bleibe ich stehen. Mein Blick folgt ein paar schwarzen Kabeln in die Höhe und trifft auf einen gordischen Knoten von epischem Ausmaß. Das schwarze Knäuel, das sich dort über die Jahrzehnte entwickelt hat, müsste eigentlich auf der Stelle zu Boden krachen und die halbe Häuserwand mitreißen. Alles ist Hunderte Male über- und unter- und umeinander gewickelt. Dutzende Leitungen fliegen in alle Himmelsrichtungen, gehen auf die andere Straßenseite, andere kommen von dort, verschwinden in dem riesigen Wirrwarr, hängen an einem rostigen Nagel oder bieten weiterem Kabelsalat eine Tasse Tee und die Chance, mit dabei zu sein. Ein Unterhemd hat sich darin verfangen, baumelt vor sich hin, und ein Turnschuh hängt an einem Schnürsenkel, vermutlich um den Flugverkehr umzulenken. Das sieht so übertrieben und gleichzeitig nach unendlicher Freiheit aus. Ein Bild für das Bauordnungsamt, weil es vollkommen unmöglich ist, herauszufinden, wer hier wem den Strom klaut, welches Kabel welchen Ursprung hat oder wohin die ganze Sache führt. Wie das Leben.
»Ist das ein Fluxkompensator?«, fragt Ole.
»Möglich. Oder die CIA, denn hier laufen alle Strippen der Welt zusammen.«
Ole schießt ein Foto. Ich bin begeistert, denke wieder, wie wenig es manchmal braucht, während mein Blick die Laterne herabwandert und auf eine dort angeklebte, ähnliche konfuse Zettelwirtschaft trifft. Papierfetzen mit krakeligen Telefonnummern oder verblichene, laminierte Karten, die Angebote anpreisen: Massage, Ayurveda, Tantric Infusion, Geistheilung, Free to Die, Path of Love und immer wieder Yoga. Hatha, Yin, Vinyasa, Jivamukti, Kundalini, Ashtanga.
SUP-Yoga ist nicht dabei. Vielleicht ja eine Marktlücke.
»Das werden wir alles ausprobieren.«
»Singing Bowl Wisdom?« Klangschalen, die uns Weisheit in die Ohren flüstern?
»Ja. Und warte, es kommt noch mehr.«
›Es kommt noch mehr.‹ New Age und Esoterik. Welt der Wunder, Wahnsinn, Religionen. Yoga hat die Massen erobert. Hausfrauen, Manager, Jung und Alt stehen auf einem Bein, auf dem Kopf oder zerren an der verspannten Muskulatur. Was ist Yoga? Ursprünglich war Yoga ein Weg zur Erleuchtung durch innere Einkehr, und die Asanas, die Übungen, kamen erst später hinzu, um die intensiven Meditationen körperlich zu verkraften. Und heute? Entspannungsturnen oder eine hochspirituelle Angelegenheit. »Up to you, my friend«, sagte ein weiser Indonesier einmal zu mir. Die Yogakurse in den Städten könnten unterschiedlicher nicht sein. In manchen wird meditiert, das heilige Om gesungen, in anderen Sport getrieben. Ole war eine Weile bei einem Yogalehrer in Köln, der längere philosophische Exkurse hielt und immer neue Ideen mitbrachte. Irgendwann war es eine Magenreinigung, für die man eine Mullbinde Stück für Stück runterschlucken sollte, bis nur noch ein Zipfel aus dem Mund baumelte. Dann die ganze Sauerei wieder rausziehen. Ole hat es probiert …
Die extremen Yogis schneiden sich das Zungenbändchen durch, um mit der Zunge von innen die Nase zu penetrieren, und in den alten Schriften finden sich Abschnitte, die, um die Endlichkeit des Körpers zu begreifen, den Verzehr von Leichenteilen empfehlen. Ich bleib dann mal beim Sonnengruß.
Und sonst: malen nach Zahlen, hyperventilieren, tanzen. Singen heißt jetzt Chanten. Fasten, schlafen auf dem Nagelbrett, ausflippen, einen Baum umarmen oder in Gebeten die Götter um ihre Gunst bemühen. Die ganze Welt ist unterwegs. Auf der Suche nach dem Glück. Mehr ist es ja nicht. Das verbindet uns, und es ist schön, dass die Wege so verschieden sind. Was heilig ist und was totaler Quatsch, ist eine persönliche Angelegenheit, denn eine Wahrheit gibt es nicht. Natürlich außer meiner, denn naturgegeben halte ich meine Perspektive häufig für die richtige. Dümmer kann ich gar nicht sein, aber es ist schwer, sich das abzugewöhnen. Mystik hilft mir dabei. Etwas, das sich nicht erklären lässt, kann eine schöne Demut schaffen, weil ich eigentlich gar nichts weiß. Nicht eigentlich. Deshalb soll Indien mich verzaubern. Mir Eindrücke verschaffen und Weltbilder zeigen, bis mir nichts mehr bleibt, als über mich zu lachen.
Wir ziehen weiter, Ole zeigt mir, wo es leckeres Curry gibt und wo den besten Obstsalat. Ich beäuge die Etablissements heute kritisch. Natürlich will ich nicht die halbe Welt verteufeln, wegen einer schlechten Erfahrung alles grau sehen und die Krankheitserreger in jeder Ecke – aber ich kann nicht anders.
Das Hirn warnt zu viel.
Vermutlich waren es die Eiswürfel in den Drinks am Strand. Wir hofften, dass der Alkohol die Mikroben zerstört, oder befanden uns in einer überheblichen Phase der Unverwundbarkeit, aber Vorsicht ist die Mutter von solidem Stuhlgang. Besonders in Indien. Der ungeübte westliche Körper steht den Monstern in den ersten Tagen mit weißer Flagge und freundlichen Friedensangeboten gegenüber. Die Biester haben ihren Spaß. Das Immunsystem wird überrannt, das menschliche Mutterschiff hat nix zu lachen. Wieso dreht sich heute alles nur ums Kacken?
Am Ende der Hauptstraße führt eine geteerte Straße aus dem Ort heraus.
»Da lang geht es zu den Geldautomaten.«
Aufgrund der leichten Steigung nicke ich nur und bin für weiter geradeaus.
Es wird waldiger. Wir wandern durch ein kurzes Stück mit Palmen und Bäumen, die uns Schatten schenken.
Auch hier sind die Restaurants ausgestattet mit Sofas, Hängematten, Decks zum Yogamachen oder Barfußtanzen, für Meditation und was immer hier geschieht. Der Secret Garden, das Ecstatic Dance, The Old Tree, Yoga Delight, das Eden.
Dahinter wählt Ole den Weg zurück zum Strand, wo noch vereinzelt Bars und Restaurants zu finden sind. Das Highlight von Arambol steht bevor. Auf einer kleinen Anhebung im Sand thront ein großes Grundstück in der Mittagsglut. Drumherum ein hoher Zaun aus Bambus.
»Da sind wir.« Die Sonne blendet, aber Oles Augen leuchten heller.
»Das Love Center???«
»Love T-E-M-P-L-E!«, korrigiert Ole.
»Love Center ist lustiger. Eine Eso-Shopping-Mall und für jeden was dabei, in jedem siebten Ei.«
Ole verdreht die Augen: diese Respektlosigkeit. Dann grinst er. »Love Center klingt nach Puff.«
»Auch gut. Dürfen wir da jetzt einfach reingehen?«
»Natürlich.«
Ole schreitet voran. Ein paar Holzstufen im Sand führen zu einem überdachten Bereich mit sofaähnlichen Sitzgelegenheiten zum Chillen, mit Tischen und Stühlen und zwei großen Kreidetafeln. Darauf das Programm. Heute ging es um sechs Uhr morgens los mit der dynamischen Meditation. Am Strand.
Die Dynamische Meditation wurde vom indischen Mystiker Osho entwickelt, um im Organismus unterdrückte Gefühle und innere Anspannung zu lösen.
Erste Phase: Chaotische Atemstöße, so schnell, heftig und unregelmäßig wie möglich.
Zweite Phase: Katharsis. Ausleben der geweckten Gefühle durch Schreien, Kreischen, Heulen, Lachen, Schütteln, Toben.
Dritte Phase: Mit erhobenen Armen bis zur totalen Erschöpfung auf der Stelle springen und tief aus dem Bauch »Huh Huh Huh« rufen.
Vierte Phase: Stopp! Verharren in der Stellung, in der man sich befindet, und nicht mehr bewegen.
Fünfte Phase: Integration der Erfahrungen und Ausklang der Meditation.
Kurz gesagt: Ausflippen 3000. In einem schalldichten, abgedunkelten Raum mit geschlossenen Augen beim ersten Mal sicher eine Überwindung. Hier am Strand im Sonnenaufgang … oh Mann!
Es folgen bis in den frühen Abend jede Menge Kurse. Yoga, Om Chanting, holotropes Atmen, Rebirthing. Von manchem habe ich gehört, anderes sagt mir nichts, aber jeden Tag die freie Wahl und mit fünf Euro pro Kurseinheit supergünstig.
Ole schaut auf die Uhr:
»Gerade läuft Dark Silence.«
Wir gehen auf das Gelände.
Außen herum stehen kleine Hütten auf Stelzen im Sand. Die Wände sind aus Bambusmatten, die ein wenig Durchlüftung in der prallen Sonne bieten, aber nur bedingt Privatsphäre.
Dafür ist man mittendrin im Hexenkessel. Im Zentrum des Geländes wurden zwei etwa 200 Quadratmeter große Hallen errichtet, mit Holzböden und ähnlich luftigen Wandkonstruktionen, damit die Hitze ertragbar ist. Wir laufen um die erste Halle herum, die leer zu sein scheint. In der zweiten hören wir Stöhnen, Seufzen, wilde Atemstöße. Dark Silence ist eine Massenorgie.
»Haben die sich im Programm geirrt?«
Wie auf Kommando wird drinnen alles still.
»Hauptsache, es funktioniert«, flüstert Ole.
Wir drehen um und gehen zum Eingang zurück, wo Leute stehen, die sich miteinander unterhalten und Tee trinken. Eine kleine Gruppe hält sich bei den Händen, alle lachen, schauen sich an, summen, bevor sie sich kitzeln und umarmen. Vor meinem geistigen Auge blitzt eine Gewaltfantasie auf. Ich sehe Köpfe, die zusammen klatschen, mehr Komödie als Splatter, aber dieses esoterische Theater kann einem auch auf die Eier gehen. Gut, dass hier keiner Gedanken lesen kann. Also hoffentlich.
Ich werfe einen Blick auf die Tafeln mit den Gruppen und Übungen. Rechts davon hängt ein Flyer: Tantra-Festival. In zwei Tagen …
Ich zucke zusammen, denn eine Sekten-Hand streichelt über meine Schulter.
»It is going to be a-b-s-o-l-u-t-e-l-y amaaaaaaazing!!! Very deep! And life changing …«
Eine Frau mit Blumen im Haar, riesigen Ohrringen, einer Unmenge Halsketten und großen Augen verfällt in eine theatralische Pose, nickt, dreht sich mit einer Pirouette um und verschwindet mit klimpernden Schritten, bevor ich irgendetwas sagen kann. Ich blicke ihr hinterher.
»Wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt hier!« Ole weiß natürlich schon Bescheid. »Vier Tage lang finden statt dem Tagesprogramm Sessions bei den großen Gurus statt. Das Who’s who der Tantra-Szene ist angereist, und wir sind so was von dabei.« Er ist im siebten Himmel.
Ich hoffe, ich bin bis dahin wieder fit.
»Was machen wir jetzt?«, fragt Ole. Er hat bis acht Uhr morgens getanzt und ist kein bisschen müde.
»Ich muss zurück. Bin superplatt.«
Als ich aufwache, höre ich das Meer rauschen. Ole schläft. Ich setze mich auf die kleine Terrasse. Mein Körper fühlt sich gut. Gesund. Das Blau des Ozeans schimmert durch die Palmen, die Ruhe des frühen Morgens trägt mich durch die Augenblicke. Ich lese ein paar Seiten, muss aber ständig den Blick von dieser Terrasse auf die Palmen und das Umland schweifen lassen. Also stehe ich auf, schleiche zwei Schritte, um dann einen Stuhl ›aus Versehen‹ so geräuschvoll zu verrücken, dass Ole aufwachen muss. Er dreht sich widerwillig zur Seite und öffnet die Augen. Er lächelt, und obwohl sein Körper schlummern möchte, vertreibt die Gelegenheit, etwas zu erleben, die Schläfrigkeit aus seinen Gliedern. Wir sind in Indien! Ole der Frühaufsteher. Es stimmt: Dieses Land hat Zauberkraft.
Wir wandern um die Klippe herum. Vereinzelte Gestalten laufen den Strand entlang, machen Yoga oder lassen sich vom Tagesbeginn verzaubern. Wir meditieren. Gemütliche Stille. Danach werfe ich alle Pläne über den Haufen, laufe zu einem Laden, den ich gestern entdeckt habe, und leihe mir ein Surfbrett aus. Meine erste Reise ohne Surfbretter – einen Tag lang. Die Wellen sind nur hüfthoch, aber wunderschön. Die ersten Paddelzüge aufs Meer hinaus sind voller Leichtigkeit, weil das lange Brett wie ein Ozeandampfer über das Wasser gleitet. Alles ist so mühelos. Diese großen Planken schweben ganz von selbst. Ich setze mich weiter draußen aufs Longboard und warte. Das volle tropische Grün schmiegt sich an den Strand, der weiter vorne im Wasser verschwindet, der Ozean ist tiefblau, außer mir ist weit und breit kein Surfer zu sehen. Dann kommt eine süße Welle auf mich zu. Sie erhebt sich langsam, ich bringe mich in Position, sie schiebt mich an, ich hüpfe auf die Füße. Das Brett gleitet behände los, ich steuere es an die steileren Stellen der kleinen Wasserwand und nehme Fahrt auf. Zscchhhh. Sanfter Wind rauscht um meine Ohren, ich fliege über das Wasser. Mein Körper lacht, ich laufe ein paar Schritte nach vorne, drehe mich um die eigene Achse, das Longboard wird zum Tanzparkett. Dann verliere ich das Gleichgewicht und plumpse ins Wasser. Ich hebe den Kopf aus dem kühlen Nass, und Freude schwimmt durch mein Gemüt. Ich summe ein Lied, während ich mich auf das Brett hinaufziehe und wieder nach draußen paddele.
An jedem anderen Strand der Welt wäre das nichts Besonderes. Und jetzt: Euphorie, Herzrasen und der Wunsch nach Meer. In hüfthohen Wellen! Natürlich schön clean und mit etwas Druck, aber alles andere als Superwahnsinn. Keine massive, steile Wasserwand und nicht das, wofür ich seit über zwei Jahrzehnten all die Reisestrapazen auf mich nehme. Trotzdem ist heute alles perfekt, und ich weiß, dass das nicht an Indien liegt, sondern an mir. So entspannt, so erfrischend, so federleicht. Im Line-up angekommen, baut sich schon die nächste Welle auf. Ich paddele los, spüre das Gleiten, kann das alles nicht glauben und schieße davon.
Ich surfe eine gute Stunde und freue mich darauf, wenn ich im hohen Alter endlich Longboarder werde. Eine der schönsten Sessions, die ich je erlebt habe. Ausgerechnet in Miniwellen!
Nach dem Mittagessen gehe ich zu einer Yogastunde, die auf einem der zerknitterten Zettel angepriesen wurde, während Ole den Tag im Love Center verbringt (»Love Temple!!!«) und uns für das Tantra-Festival anmeldet. Anmelden ist einfach, Mitmachen dann die Krux.
Am späten Nachmittag treffen wir uns in unserer Hütte, um etwas später zurück nach Arambol zu latschen.
Der Sonnenuntergang steht bevor.
Der Strand sprüht vor Leben. Die Sonne senkt sich hinab zum Ozean, Lagerfeuer brennen, Funken hüpfen, tanzen, und Rauchschwaden klettern in die Luft.
Die russischen Pauschaltouristen gehören, so wie wir, zu den Zuschauern. Sie haben sich von ihren Liegen erhoben und zur Beach-Bar geschleppt. Einige wanken bereits, andere führen bunte Shorts und Wohlstandsbauch spazieren, um frische Luft zu atmen oder das Spiel der Spirituellen zu betrachten. Überall ist jede Menge los, der Strand hat sich in ein geschäftiges Zirkus-, Zauber- und Zigeunergelände verwandelt.
Eine kleine Gruppe trifft sich für eine Yoga-Session. Die Matten werden in Herzform ausgerollt, in der Mitte flackert eine Kerze. Es riecht nach Marihuana, da sich die Israelis mit den Rasta-Jungs zusammengehockt haben, um einen Strandabschnitt mit Qualm und Ganja zu versorgen. Geschwollene Augen und vergilbte Finger, aber auch ein Freiheitsschmunzeln im Gesicht. Zehn Meter dahinter steht ein nackter, dürrer Mann mit schütterem blondem Haar, der konzentriert in die Sonne starrt. Beim Versuch, zu erblinden, reißt er in ruckartigen Bewegungen seine Arme in die Luft. An der Wasserkante steht ein Pärchen in inniger Umarmung. Wunderschön. Genauso wie die anmutig fließenden Bewegungen einer hundertjährigen Tai-Chi-Oma. Einige Schritte weiter sitzt eine Gruppe zusammen, die Augen geschlossen, die Münder zum Himmel gestreckt und weit geöffnet. Sie brummen das heilige Om. Zwei Freunde unterhalten sich im Kopfstand. Links von uns werden Tische aufgebaut, die mit Schmuck und heiligen Steinen, Chakren-reinigenden Kristallen und Muscheln und Ölen und Glücksbringern bestückt werden. Im Zentrum steht Ganesha. Ein ganzes Heer von Statuen, denn der Gott mit dem Elefantenkopf erfreut sich der allergrößten Beliebtheit. Er hilft, Hindernisse zu überwinden. Ein Freund der Suchenden. Ein Ganesha in Miniaturausführung baumelt um meinen Hals. Die Verkäufer sind Aussteiger mit sonnengegerbter Haut, die den Unerfahrenen total überteuerte Esoterikwaren andrehen, um über die Runden zu kommen. Männer mit breiten Schultern und offenen Holzfällerhemden über der behaarten Brust, Frauen mit wilden Tätowierungen auf den Armen und alle mit Verkaufshoffnung in den Gesichtern. Aber auch Verzweiflung, denn der Versuch, der kühlen Eintönigkeit des heimischen Arbeitsalltags zu entkommen, lässt sie nun hinter diesen Ständen versauern. Ich verstehe sie, hab auch keine Lust, so viel zu knechten, möchte aber auch nicht tauschen.
Einer mit schwarzen Locken folgt meinem Blick: »He is a picaro, a blessed dancer and limber lover.« Er zieht die Augenbrauen hoch. Ich nicke. Ganesha ist ein munterer Begleiter. Weil kein Kaufinteresse besteht, wendet sich der Mann mit Unmut ab.
Indien ist das Eldorado ihrer Freiheit. Nur, was spielt sich hinter den glücklosen Augen der Systemrebellen ab? Sind da noch Träume, ist da Zufriedenheit, oder werden sie von einer phlegmatischen Gemütlichkeit beherrscht, die es unmöglich macht, in das System zurückzukehren oder das Leben in die Hand zu nehmen. Ich wünsche ihnen Glück, aber die anderen hier sind lustiger. Die, die irgendwas machen. Noch suchen, sich schütteln oder mit den Armen rudern.
»Sieh nur!«
Ole zieht an meiner Schulter. Der Strand bebt. Bekloppte Menschen, alle fliegen übers Kuckucksnest. Wie viel Leben, wie viel Kraft, wie viele Verrückte. Alle sind voll da! Wir mitten drin, Köln Lichtjahre entfernt. Eine Gruppe praktiziert heftige Hüftstöße. Immerhin haben sie Klamotten an. Die vier Herren und drei Damen hingegen, die im Kreis stehen, sich an den Händen halten und abwechselnd in die Runde kreischen, sind nackt. Labbrige Pobacken, Hausfrauenhaarschnitte und ellenlange Intimbehaarung. Will man nicht sehen, man kann aber auch nicht nicht hingucken.
Ein Mann mit Turban und langem grauem Bart – so einen müsste man hier haben – trägt ein unbeflecktes weißes Gewand. Er sitzt im Sand. Wie eine Säule. Natürlich Lotussitz. In Stille, umgeben von Kraft, von Aura, von tiefer Ruhe und Verbundenheit. Da würde jeder American-Football-Spieler beim Tackle-Versuch einfach abprallen oder zu Staub zerfallen.
Der kleine Kreis, der sich zum Acro-Yoga getroffen hat, zeigt wunderschöne Hebefiguren. Menschen schweben in vollkommener Körperspannung auf den zum Himmel gestreckten Füßen ihrer am Boden liegenden Partner. Da würde ich gerne mitmachen. Und sonst? Ein spontanes Didgeridoo-Konzert, Ölmassagen, die im Sand zu ungewolltem Peeling werden, Lachyoga. Ein selbsternannter Guru erklärt die Welt für eine Energiespende.
Es wird sich ausgetobt und ausprobiert. Alles ist erlaubt, Menschen, die sich fremdschämen, fallen auf der Stelle tot um.
Zwischen all diesen Gestalten und Ereignissen laufen ein paar Inder in Sandalen, mit langen Stoffhosen und schickem Hemd hin und her, um das Spektakel der Menschen, die aus fernen Ländern in ihre Heimat gereist sind, zu betrachten. Was die wohl denken? Also, was die wohl denken, was im Westen so getrieben wird, an einem Dienstagabend?
Hinter uns in der Ferne schallen dumpfe Trommelschläge.
»Endlich«, sagt Ole.
Es heißt, Tanzen und Umarmungen seien die wirksamsten Werkzeuge, um das Herz zu öffnen. Begegnung mit einem Menschen und Begegnung mit sich selbst. Und natürlich kenne ich die Sprüche: »Tanze, als würde dir niemand zusehen!« Aber das ist Theorie. Ich fürchte, dass meine Bewegungen nicht so geschmeidig und ästhetisch sind wie die der anderen. Dass ich blöd aussehe. Das erzeugt Schamgefühl, dagegen hilft Rum-Cola.
Aber mit den Jahren wage ich mich heran. Ich habe an meiner Unsicherheit gearbeitet, in Seminaren einen sicheren Raum gefunden, sodass ich meist mit geschlossenen Augen tanzen kann. Auch ohne zwei Promille. Trotzdem bleibt es eine Überwindung.
Thomas, ein Zimmernachbar auf einem Wochenendseminar, sagte mal zu mir und meiner Scheu:
»Angsthasen sind voll mit Liebe. Die Drübersteher und Belächler sind es, die Hilfe brauchen. Sie sind von Furcht zerfressen.«
Als die Sonne im Meer verschwunden ist, breitet sich eine geheimnisvolle Dämmerung über Arambol aus. Wir stapfen voran, den dumpfen Geräuschen entgegen. In der beginnenden Dunkelheit hat sich eine Menschenmenge gefunden, plötzlich stehen wir davor.
Es sind sieben. Sie sitzen auf Hockern und auf Kisten. Muskulöse und drahtige Männer mit Rastalocken und schwarzem Haar. Vor ihnen im Sand die Bongos, die heiligen Werkzeuge. Mächtige Instrumente, groß wie Kübel, aus afrikanischem Holz und filigrane Klanggefäße mit straff gespannter heller Ochsenhaut, eingeklemmt zwischen den Oberschenkeln der Spieler, deren Hände darauf klopfen. Sie sind der Motor der Leidenschaft. Sie wecken den Rhythmus, befeuern die Energie, kraftvoll, unaufhaltsam. Der legendäre Drum-Zirkel von Arambol ist bereit abzuheben.
In der Mitte ein Hüne mit wildem Bart, der mit den Handballen einen klaren Basisbeat in die Nacht schmettert. Der Typ daneben balanciert einen Joint zwischen den Lippen, schwarze Locken fallen in sein Gesicht. Er steuert mit den Fingerspitzen Finesse bei. Seine Kreativität verschmilzt mit der stramm nach vorne marschierenden Führung. Sein Nachbar steigt ein, seine Beine wippen, er forciert Geschwindigkeit, streut Zwischenschläge ein, entfesselt neues Feuer. Das Zusammenspiel spontan, hitzig, aufbrausend. Und frei.
Mein Kopf will sich bewegen. Links und rechts von mir stehen Menschen, die auf die Performance starren, wippen, federn, schwingen. Die Luft pulsiert, Leidenschaft erwacht, Kraft schwärmt durch unsere Adern.
Mehr Leute drängeln sich heran, unbewegte Körperteile werden aufgeladen, wollen fliegen, toben, tanzen. Die Beats immer heißer, wilder, die Umstehenden stapfen mit den Füßen, der Raum vor den Meistern an den Trommeln ist leer. Noch. Ein Vakuum, umringt von zuckenden Gestalten, der Damm ist kurz davor, zu brechen. Dann springt einer nach vorne in den Kreis. Nichts kann ihn jetzt noch halten. Ein Zweiter steigt mit kraftvollen Schritten ein, vor und zurück, stolziert durch den Sand, der unter seinen Füßen durch die Gegend fliegt. Eine Frau lässt ihre Arme tanzen, Ole den Oberkörper kreisen, er taucht ab und wieder auf, lässt sich hineinziehen, erfassen, davontragen. Ich will auch, aber kann nicht. Unsichtbare Fesseln halten mich zurück. Ein Bärtiger springt vor, sinkt auf die Knie, reißt die Hände in die Luft. Ein Urschrei entfährt seiner Kehle. Weitere stoßen hinzu. Die Kraft der Tanzenden, das Fieber dieser Nacht, elektrisiert die Häuptlinge an den Bongos. Eine neue Welle schießt durch ihre trommelnden Leiber, heizt sie an, immer schneller, immer weiter, immer schneller. Plötzlich sind alle in Bewegung. Die Körper schwitzen, ihre Schatten wild wie Tiere, die Bewegungen hemmungslos und wunderschön.
Dann ist es da, in mir, ein Vulkan, er bricht los, zügellos, roh, euphorisch. Meine Augen sind geschlossen, ich springe, springe, springe, mein Kopf zuckt ruckartig durch die Gegend. Erlösung strömt durch meinen Körper, peitscht ihn an, immer mehr, immer weiter, immer höher …
Schweißtropfen fliegen durch die Luft. Die glorreichen Sieben sind in Rage, wir sind ihre Energie, ihr Motor, ihre Raketenturbine. Wieder stürzt sich einer der Trommler auf den Beat, spielt mit, um plötzlich alles an sich zu reißen. Es geht hinauf, in die Höhe, eskaliert, immer weiter, weiter, weiter. Durch die Eingeweide, in die Schenkel, in die Arme. Das Blut in Wallung, die Freude grenzenlos. Jemand kreischt, ein Mann boxt durch die Luft, ein Junge taumelt, bebt, zersprengt die Ketten. Alles tobt, zuckt, springt, fetzt durch den Sand und wieder zurück. Eine Bauchtänzerin, die Füße fest im Boden, schüttelt ekstatisch ihre Hüfte, ein Mädchen mit Jeans und T-Shirt dreht sich, vibriert, leuchtet. Immer mehr Menschen stürmen nach vorne, die Meister an den Trommeln sind triefend nass, die Energie wächst und wächst und wächst. Sie glüht. Die Nacht ist schwarz; nur von den Handys der glotzenden Inder fällt das Licht wie ein Scheinwerfer auf die Verrückten, die sie filmen. Egal, die Ekstase ist lange schon nicht mehr aufzuhalten.
Pitschnass betreten wir ein Restaurant. Das Gute an einem Strand voller Verrückter: Man fällt nicht auf. Hinter uns liegt eine Stunde Superwahnsinn. Tanzen ohne Mut antrinken, meine Scheu wie weggeblasen, und dafür danke ich jetzt den Verrückten.
Ole bestellt im Vorbeigehen zwei Bier und guckt verdutzt, als ich mich für einen Liter Wasser entscheide. Wir setzen uns an einen Tisch unter tausend Sterne. Ein paar Tische sind besetzt, sanfte elektronische Musik begleitet die Gäste in die Nacht.
»Das Leben ist so schön!«, singt Ole.
»Das hat Megaspaß gemacht.« Es tut so gut, mal aus sich rauszugehen.
Wir ziehen die durchgeschwitzten T-Shirts aus, Schweißperlen glitzern auf der Haut.
Ole ist ein großer Tänzer. »Ich liebe es, wenn der Körper von allein macht. Wenn da keine Idee mehr ist, der Rhythmus das Steuer übernimmt, und die Jungs waren obergeil.«
»Unglaublich, wozu der Körper fähig ist. Ich bin gespannt, was meine Beine morgen zum Dauerspringen im weichen Sand sagen.«
»Ich könnte ein frisches T-Shirt brauchen.«
Als die Biere (beide für Ole) und das Wasser (für mich) geliefert werden, geben wir unsere Essensbestellung auf. Wir lehnen uns zurück und schauen uns an. Das Leben ist schön.
Es folgen die Instruktionen für das Tantra-Festival am morgigen Tag.
»Um neun Uhr geht’s los. Es beginnt mit einer Vorstellung des Ablaufplans und der Gurus, und dann finden die Sessions statt. In beiden Hallen läuft parallel eine Veranstaltung am Vor- und eine am Nachmittag. Man kann sich aussuchen, woran man teilnehmen möchte. Das Programm steht auf den Tafeln. Dazwischen Mittagessen, und abends wird getanzt. Das wird so guuuut.«
Ich bin froh, dass ich wieder fit bin. Ich bin froh, dass ich jetzt in Indien angekommen bin.
»Da liefen eben schon so viele Leute rum. Und die Mädels! Wahnsinn!!!«
»Ach, es geht hier auch um niedere Interessen?«, frage ich.
»Gewiss, das Auge meditiert mit.« Ole trinkt einen großen Schluck Bier.
»Genau, dein drittes Auge hat die Frauen stets im Blick.«
Ich freue mich, fühle nervöse Neugierde, will aber einen Einblick in mein Inneres erhaschen und nicht den Frauen hinterherjagen. Für Ole lässt sich das wunderbar vereinbaren. Er ist genauso interessiert, gespannt und offen, aber auch für zarte Weiblichkeit bereit.
»Sollte mich eine der Schönheiten in ihr Gemach zerren, werde ich, wenn das Universum es so will, keine Gegenwehr leisten.«
»Ich bin neugierig auf andere Sachen.«
»Das ist absolut legitim«, sagt Ole.
»Aufs Love Center«, grinse ich.
»Temple! Diese Respektlosigkeit. Das ist der stille Revoluzzer in deiner Seele.« Ole greift nach seiner Flasche. »Auf Indien, mein Lieber.«
»Ich finde, es sollte lustig bleiben. Ohne erhobenen Zeigefinger, und zu ernst darf es niemals werden. Dieses Leben.«
»Gute Einstellung. Ich freu mich auf die Heiligen … und die Mädels.«
Unser Essen kommt, ich habe Hunger. Trotzdem noch mal Sicherheit: Nudeln mit Tomatensauce. Ole isst Hühnchen.
Und einen Salat.