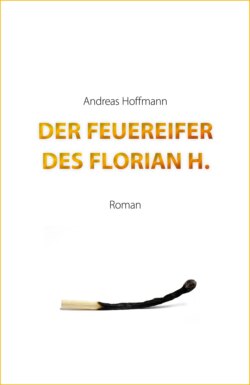Читать книгу Der Feuereifer des Florian H. - Andreas Hoffmann - Страница 5
Montag, 3. Mai
ОглавлениеWeithin ist er sichtbar: der stilisierte rote Turm mit dem Zinnenkranz, der sich unablässig, nachts wie ein Leuchtfeuer, auf dem gläsernen Verwaltungshochhaus dreht. Der Name „Thurmeisen“ strahlt in großen roten Buchstaben von den Dächern des Hauptlabors und der Fertigungshallen. Er leuchtet am Hochregallager. Er dreht sich mit den Kränen am Kai der Firma. Er rollt auf Lieferwagen und Lastzügen über die Straßen und Autobahnen und schwimmt auf Containern über die Weltmeere. Er titelt die dicken Arzneimittelkataloge, nach denen in aller Länder Sprachen die Kunden aller Länder ihre Bestellungen aufgeben. Er schmückt die Briefköpfe der Schreiben und Rechnungen, die abgehen nach Amerika, Asien, Australien, und er adressiert die Zahlungen, die von dort eintreffen. Und letztlich steht er auf den Packungen und Fläschchen, die der kranke Käufer öffnet, wenn es ihm schlecht, und verflucht, wenn es ihm hernach nicht besser geht. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, sollten Sie die Packungsbeilage nicht kapieren.
Thurmeisen kennt jeder, aber wenige wissen: Thurmeisen gehört seit der Fusion vor zwei Jahren German Chemicals. Die Direktoren residieren in Frankfurt am Main, die Forschung ist allerdings bei Thurmeisen verblieben, dicht an der Spree. Hier werden die Medikamente entwickelt. Getestet, gefertigt, verpackt, versandt werden sie immer häufiger andernorts, in den Vororten von Qingdao und Tampico, Ho-Chi-Minh-Stadt, neuerdings auch Sao Paulo und, so die Götter wollen, in nicht allzu weiter Ferne auch in Mumbai.
Unpünktlichkeit droht. Florians erschrockener Blick auf die Uhr am Firmeneingang: später als er dachte. Weck den Tiger in dir! Im Slalom durch die Lücken auf dem Parkplatz. Vier Minuten, dann beginnt ihre Kernzeit. Seine Gelenke jucken noch von den Handfesseln der Nacht, der Bauch brüllt nach Frühstück. Ausgefallen! Der Leere in Leos Kühlschrank wegen.
Leonore lächelt zur Pförtnerkabine hin, erwidert von dem Mann im Dienstanzug. Florian zieht seinen Firmenausweis. Im Foyer eine flüchtige Umarmung. Trennung bis zur Mittagszeit. Florian blickt ihr nach. Leger schlawinert ein Kollege an sie heran (derselbe wie immer). Ein Scherzwort. Sie lacht hell auf und zieht ihn mit sich in den Paternoster. Schnell dreht sie sich um. Bückt sich. Pustet Florian einen Kuss zu. Er sieht noch ihren Hosensaum und die schwarzen Slipper verschwinden, dann ist sie aufgefahren in die Büroebene. Über die Treppe hinab durch den Hinterausgang trottet Flo das Kopfsteinpflaster des weiten Firmenhofs hinunter zu seinem Arbeitsplatz am Ufer der Spree.
Dort, hart am Wasser, steht einsam ein altes Haus, umgeben von Postmorderne, als gehöre es dort gar nicht hin. Rote Klinkermauern, trutzige Ecktürme mit Zinnenkränzen, schmale Rundbogenfenster: Dahinter hütet Florian das Firmenarchiv, die Tradition der Firma, als berge es seine eigene Vita.
Am Anfang stand Leonhard Thurmeisen, der Apotheker, der Firmengründer. Erstaunlich. Fast nichts aus seiner Zeit blieb: Weder seine Villa noch der Park noch der Festsaal noch die Turnhalle noch die Kapelle. Die Orte wo Chef und Belegschaft spazierten, feierten, turnten und beteten, nichts ist übrig davon; das Unternehmen hat sich darüber ausgebreitet. Einzig das rote Haus am Wasser blieb, unbeachtet, im Abseits, scheinbar nutzlos geworden. Einst Dormitorium und Refektorium für Papa Thurmeisens ledige Arbeiter, Stätte ruhigen Schlafes, nahrhaften Essens, erbaulicher Betätigung. Kartenspiel, Raufen und Saufen führten zum Rauswurf. Mit Sack und Pack. Da kannte der alte Thurmeisen keinen Spaß.
Doch die zahllosen Aktionäre, die nach seinem Tode die Firma in Anteile häckselten: Was kümmerte sie, wo die Leute schnarchten oder schmausten, was sie trieben oder tranken? Das Ledigenheim wurde zum Kostenfaktor. Die Männer mussten raus. Schwamm und Holzbock zogen ein, bis der Vorstand der AG die Ruine für sich entdeckte. Sie wurde entkernt. Granit und Glas, Messing und Marmor hielten Einzug. Dazu ein Saal mit Panoramafenster und Blick auf den Fluss. Geschäftspartner beeindrucken? Den Geist der Firma beschwören? Dann hier im Haus am Wasser! Nicht in Frankfurt.
Im Souterrain arbeitet Florian. Da wo Thurmeisens Mamsells kochten, hortet Florian seine Schätze. In einem länglichen, schmalen Raum vom Zuschnitt einer Haftzelle steht sein Schreibtisch. An der Tür steckt in einem Plastikschlitz – schnell auswechselbar – ein Papierstreifen: „Archiv. U1. Haselbach“.
Aus seinem Ölporträt über der Tür schaut der alte Thurmeisen in die Bürozelle, so streng, als sei er unzufrieden mit der Enge, in der sein Vermächtnis gehütet wird. Entsetzt über die billigen Regale an den Längswänden, entsetzt über den mickrigen Schreibtisch, entsetzt über den schäbigen Stuhl davor. Florian vermag dem Alten kein Lächeln abzuringen, so peinlich er auf Ordnung achtet. Die Bücher, die Ordner, die Vorgänge, die Ablagen, ja selbst die Kaffeemaschine, Keksbüchse, der Wasserkocher und das Geschirr: Jegliches ist fest verortet. Auf dem Schreibtisch befinden sich, jedes an seinem Platz, im rechten Winkel zur Tischkante die üblichen Utensilien vom Locher bis zum Mousepad.
Dies ist Florians Klause, sein ora et labora. Tag für Tag. Selten krank. Pünktlich. Zuverlässig. Die Kollegen in den Büros und Labors, in einigem Abstand zu seinem ulkigen Haus am Ufer, mögen ihn gar nicht kennen oder für einen Eremiten halten. Was schert es ihn? Auch er steht in Thurmeisens Dienst. Genauso wie sie – fast: Er erhält Jahr für Jahr einen neuen Werksvertrag. Begrenzt, befristet. Befriedigend? Nun ja. Immerhin hat er einen Job. Immerhin darf er außerhalb der Kernzeit seiner wissenschaftlichen Arbeit nachgehen: „Feuersozietäten und Brandstiftungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts“. Bauern zünden aus Not ihre versicherten, elenden Lehmhütten an. Ein bisher nicht beackertes Feld. Vielleicht wird noch eine Promotion daraus.
Als Haselbach bei Thurmeisen begann, steckte man ihn in den Bereich Forschung. Korrekt. Er forschte ja, wenn auch nicht pharmazeutisch. Dann legte man ihm betriebsbedingt plötzlich einen neuen Vertrag zur Unterschrift vor. Er staunte. Sein Arbeitgeber hieß plötzlich Thurmeisen Catering GmbH. Er fragte den Betriebsrat. Der erklärte ihm, dies sei eine neue, hundertprozentige Tochter der Thurmeisen AG, allein dazu gegründet, dem Kantinenpersonal unabhängig vom Tarifvertrag der übrigen Belegschaft ein leistungsgerechteres Salär zu bieten. Ein niedrigeres. So sei das eben. Der Betriebsrat zuckte mit den Schultern. Florian ein Kantinenmitarbeiter? Der Betriebsrat zuckte noch einmal: Tja, er arbeite schließlich in einem Gebäude, in dem bei Tagungen auch gespeist werde. Ironie oder nicht? Florian war sich da nicht ganz sicher. Er unterschrieb mit knirschenden Zahnplomben. Sein Brutto liegt, fand Leo vor kurzem heraus, zwischen dem einer Küchenhilfe und dem des Kantinenkochs. Was hilft’s? Geht schon irgendwie in Ordnung. Hauptsache, er bekommt am Jahresende jeweils einen neuen Werksvertrag. Er ist zuversichtlich. Leistung muss sich wieder und wieder lohnen.
Haselbach macht in Zufriedenheit. Was bleibt ihm auch übrig? Die Zahl der Stellenangebote ist direkt proportional zum Erfolg seiner – zugegeben: wenigen – Bewerbungen. Eine einzige echte Chance, und er wäre dem Ziel einer Familie, mit Leo und ein, zwei Murkeln, einen Menschheitsschritt näher. So aber hat er sich mühsam beigebracht, das kärgliche Wort „Not“ mit dem schillernderen „Tugend“ zu übersetzen, etwa so: Was sorgt mich das Gehalt, solange es zum Leben reicht und die Werksverträge mir meinen Freiraum garantieren, Freiheit fürs Forschen, Freizeit für Leonore.
Sie ist es ja, der er die Stelle verdankte, ihr, ihrem Vater und besonderen Umständen. Die Firma stand damals im Verdacht, Giftgas im Ersten und chemische Waffen im Zweiten Weltkrieg entwickelt und geliefert zu haben. Ein Fall fürs Firmenarchiv. Der Archivar, ein loyaler, freundlich lächelnder, älterer Herr, fand trotz intensivsten Stöberns in seinen Beständen kein den Verdacht bestätigendes Material. Er sprach die Firma von der Anklage des Massenmords frei. Dasselbe Urteil wollte gerade die unabhängige Enquête fällen, die Prof. Georg Baken leitete, als von dritter Seite Belastendes zutage trat (das sich später als von der Konkurrenz erfunden erwies). Leos Vater hatte noch Glück. Um ein Haar hätte seine Reputation Schaden genommen. Wen aber unmittelbar die Wucht der Wut traf, war der loyale, freundlich lächelnde, ältere Herr, der wohl zu oberflächlich gesucht oder zu versteckt archiviert hatte. Er musste gehen. Baken erzählte davon Leo, die bedrängte ihn, warb inständig für Florian. Und dann telefonierte er mit Direktor Bergner und der telefonierte mit dem Personalchef und der telefonierte mit Haselbach. Und seither baumelt, wo mal der Hut des loyalen, freundlich lächelnden, älteren Herrn hing, Florians Jacke. Wie lange noch?
Große Ereignisse, das merkte Haselbach bald, laufen woanders. Er reponiert am laufenden Meter geschnürte Papierkonvolute (Vermerk „Ins Archiv“), er beantwortet laufend Anfragen, die ihm die PR zuleitet, er schreibt Reden und Ansprachen, schöne Worte über die schöne Welt von Thurmeisen, und manchmal unterhält er selbst Konferenzteilnehmer mit Witzigem aus der Firmenhistorie. Mit Schlips und Anzug. Oben im Tagungssaal, bei Kaffee und Kuchen. Genug zu tun gibt es immer. Mehr als genug. Genau besehen kommen seine „Feuersozietäten und Brandstiftungen“ nicht recht vom Fleck.
Ein Examen der besonderen Art stand am Anfang seiner Tätigkeit bei Thurmeisen: der Besuch der Eltern, Reifeprüfung mit seinem Vater als Examinator. Es war ein sonniger Januarfreitag, letzter Tag seiner zweiten Einarbeitungswoche bei Thurmeisen. Schon um sieben Uhr entsicherte er die Tür zum Archiv. Der Termin war um acht. Eine Stunde hatte er noch, um alle Gegenstände ungezwungen zu drapieren, von den Schrippen und Croissants bis zu den Servietten. Eine knappe Stunde noch, die Regale interessant anzuordnen, ulkige verbräunte Fotos zuvorderst. Eine halbe Stunde noch, dem Büro einen Anflug von Geschäftigkeit zu geben, auf dem Bildschirm eine spannende Seite zu suchen, Heiner im Labor um zwei Anrufe zu bitten, Papiere so zu legen, dass ihre Erledigung dringlich erschien. Wirklich Wichtiges gab es eigentlich nicht. Eine Viertelstunde noch für den letzten Schliff: die Regale einen Finger breit weiter öffnen, die Servietten doch besser neben die Teller legen als darauf. Den Konferenzsaal über sich konnte er nicht präsentieren. Er besaß keinen Schlüssel.
Kurz nach acht surrte es. Florian öffnete. Händeschütteln von langer Hand mit dem Vater, Umarmung mit der Mutter.
„Legt ab. Fühlt euch wie im Laden“.
Laden! Vaters Stichwort: Heute extra früh aufgestanden. Schon Großmarkt besucht. Züleyhas Schulfrei (Heizungsausfall). Steht zusammen mit Onur, ihrem älteren Bruder, hinterm Tresen. Polizei dagewesen. Ladendiebstahl nebenan.
Florians Mutter verfolgte scheinbar abwesend durchs Fenster die Enten auf der Spree. Dann drehte sie sich unmerklich um. „Bist du sicher, dass wir dich nicht stören?“, fragte sie. Unüberhörbar leise, fast flüsternd.
„Meinst du mich?“ fragte Florian.
Susanne lachte erheitert. „Wen denn sonst?“
„Genau, erzähl doch mal was.“ Es war, soweit sich Florian erinnern konnte, das erste Mal, dass sich sein Vater für ihn interessierte.
Also führte er seine Eltern so zwanglos er konnte plaudernd zu seinem Gral. Mit weit mehr Phantasie als Kompetenz beantwortete er glaubhaft die Fragen seines Vaters. Zugleich bemerkte er den Stolz seiner Mutter, auch ihr amüsiertes Lächeln über seine gewissenhaften Vorkehrungen. Lässig stellte er auf der Telefonanlage ein Gespräch mit Züleyha her, die Bildschirmseite auf dem Computer fand Interesse, Heiners Anrufe kamen pünktlich, das Frühstück mundete, die Lage der Servietten wurde nicht beanstandet, nach dem Konferenzsaal nicht gefragt. Als Florian die Pforte seiner Einsiedelei nach einer guten Stunde wieder öffnete, drückte ihn seine Mutter eng und fest. Und sein Vater murmelte: „Gut gemacht, Junge.“ Dies, merkte Florian, war ernst gemeint. Summa cum laude.
Das Telefon summt. Neun Uhr zwanzig. Die Arbeitswoche beginnt. Anruf von der Pforte. Da warte ein junger Mann, Doktorand, der behaupte, er habe für neun Uhr einen Termin im Archiv. Ach ja, richtig. Florian wird heiß, seine Handflächen feuchten sich ein. Publikumsverkehr! Kann kommen. Wenig später steht ein junger Mann mit seiner Besucherkarte vor der Tür, ein schlaksiger Lulatsch, schwarzer Lockenkopf, Tweed-Jackett und Jeans, Rucksack huckepack, ein Laptop mit ersten Bits und Bytes einer Promotionsarbeit darin. Florian macht den üblichen Witz: „Kaffee gefällig? Der gibt den Akten so schön Farbe.“ Dann die Einweisung: Ja, also, hier die Bauakten der nicht mehr bestehenden Gebäude, dort die Protokolle der Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen ab 1890. Im Nebenraum die handschriftliche Autobiographie eines Werksdirektors, die Firmenchronik von 1923 und diverse Festschriften. Schauen Sie sich selbst um. Einige Materialien sind, Entschuldigung, noch ohne Signatur. Zeitmangel. Bei Fragen: ein Ruf genügt. Und bitte daran denken: Nur Bleistift verwenden. Der Fotokopierer steht in dem Winkel da hinten, der Feuerlöscher auch. Kein Lachen.
Zehn Uhr, nach etwa einem Dutzend Fragen und Rufen aus Richtung Fotokopierer und Feuerlöscher, kommt der Bote von der Poststelle. Neben etlichem Werbematerial ein Brief. Die bereits telefonisch verabredete Anfrage der Zeitschrift „Pharma“ nun auch schriftlich: Bitte um einen Textbeitrag für ihre Serie „Deutsche Chemieunternehmen gestern, heute, morgen“. Etwa 8000 Anschläge. Bis 20. Mai. Thurmeisen ein deutsches Unternehmen? „Gestern“ ja, sagt sich Haselbach spontan, aber „heute“ und in Zukunft? Da wird er höheren Ortes nachfragen müssen. Das braucht Zeit. 20. Mai? Kann knapp werden für einen guten Artikel, Werbung für sich und die Firma zugleich. Da: der etwa dreizehnte Ruf des Rucksackdoktoranden von hinten (Papierstau im Kopierer). Klappe auf, Papierbehälter prüfen, da geht das Telefon schon wieder. Johanna die Emsige vom Besucherdienst. Eine Gruppe Inder sei im Hause. Sechs Herren – und eine Dame in einem magisch blauen Sari – mit unerwartet regem Interesse an der Firmengeschichte. Ob es auf die Schnelle möglich sei, um halb zwölf im Konferenzsaal ein paar Worte darüber zu verlieren. Die Herrschaften sprächen perfekt Englisch.
„Geht klar!“ Was sonst. Haselbach kann doch Johanna nicht im Regen stehen lassen. Im Schreibtischschub fingert er nach dem passenden Manuskript, da ereilt ihn Lulatschs Ruf Nr. 14. Ein Kaffeefleck auf der Firmenchronik.
„Ich war völlig verdattert.“ Florian löffelt im Schaumrest seines Milchkaffees. „Nicht wegen des schicken Saris der Inderin, sondern wegen ihrer Frage: Thurmeisens Sozialleistungen. Was soll ich denn dazu sagen?“
Die Mittagspause geht ihrem Ende entgegen. Er hat seine leere Suppenterrine neben die Vase mit frischen Maiglöckchen geschoben und die Tischdecke danach wieder bügelglatt gestrichen.
Leo nippt an ihrem Espresso, ebenfalls das Mittagessen hinter sich, das Biryani in sich, ihren Teller mit der trocknenden Currysauce vor sich.
„Hat dich noch nie ein Besucher danach gefragt?“
„Nach Sozialem?“ fragt Florian zurück. „Klar, schon oft, aber immer nur in Bezug auf Papa Thurmeisen. Früher, ja darüber kann ich Auskunft geben: ‚Sie befinden sich gerade im Ledigenwohnheim. Dort wo Sie sitzen, mein Herr, schlief einst Kutscher Kuno.‘ Schon wird gelacht. Und dann erzähl ich von der Krankenkasse, dem Kohlegeld und Kindergarten. Oder von Thurmeisens Festen: Der alte Patriarch im Mantel von St. Martin oder Nikolaus, wie er die Kinder seiner Beschäftigten beschert. Handschuhe, Socken, Süßzeug. Was die Empfängerinnen seiner Almosen fleißig gestrickt und gebacken haben. Na, du weißt ja.“
„Was für eine Gruppe war denn da?“
„Johanna sagte, eine Delegation des Magistrats von Mumbay.“
„Mumbay?“ Bei Leonore klickt es sofort. „Wo unsere neue Versuchsabteilung ist. Hat Heiner nicht gesagt, er hätte da sogar schon ein Medikament im Test? Gegen Mukoviszidose?. – Ich war übrigens vorhin in Heiners Labor. Er fehlt heute. Der Kollege meinte, er sei wohl krank. Hilke habe angerufen.“
Florian unterbricht: „Hat er mir auch gesagt. Ich habe aufgeschrien, so froh war ich. Und dann habe ich sofort bei Heiner angerufen. Hilke war dran. Von wegen Krankmeldung! Sie wusste immer noch nichts von ihm. Konnte vor Tränen kaum sprechen. Sie war sich sicher, ihm muss etwas zugestoßen sein. Die Polizei weiß nichts. Dann habe ich noch einmal bei ihr angerufen. Inzwischen waren Robert und Ricarda schon aus der Schule zurück. Sie wusste immer noch nicht mehr. Das hat mich vollends aus der Fassung gebracht. Bin völlig durcheinander. Was kann man denn da noch machen?“
„Ruhig Blut, Flo. Nur nichts überstürzen. Das verunsichert Hilke nur noch mehr. Es gibt sicher eine Erklärung. Wart’s ab.“
„Fällt mir schwer. Ich hab heute schon gedacht: Griffel hinschmeißen und zu Hilke gehen. Die braucht uns mehr als die Firma. Da bin ich anderer Meinung als du. Vielleicht, dass man zusammen zur Polizei geht. Oder die Umgebung absucht. Systematisch. Oder die Nachbarn fragt. Aber dann kam Johanna dazwischen – und die Inder.“
Gottseidank, mag Leonore denken, als sie das Stichwort sofort aufnimmt, um Florian aus seiner aufkommenden Erregung über Heiner zu seinem vorhin angeschnittenen Thema zurückzulenken.
„Und was hast du der Frau im Sari zu Thurmeisens Sozialleistungen nun gesagt?“
In Gedanken noch bei Heiner, sieht es aus, als könne Florian auf diese Frage gar nicht reagieren.
„Sprichst du nicht mehr?“
Noch einige Augenblicke Geduld, dann ist Florian wieder leidlich auf Empfang.
„Nichts habe ich gesagt. Johanna sprang ein. Sie kann ja fließend Englisch.“
Ende. Er mag nicht mehr weiter sprechen. Heiner sitzt ihm in Kopf und Kehlkopf.
„Ja, und? Was hat Johanna gesagt? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.“
„Na, was schon? Sie sprach von Urlaubsgeld, Prämien und Leistungszulagen, 14. Monatsgehalt, großzügiger Pausenregelung. Und dann tippte sie auf die Uhr und meinte, es sei Zeit, eine Sozialeinrichtung von Thurmeisen kennenzulernen: das Restaurant. Dann verabschiedete sich die Gruppe.“
„Johanna die Emsige“, kommentiert Leo. „eine Klasse für sich. Weg vom Thema, wenn‘s zu heiß wird, hin zur Kantine. Unser Schmuckstück.“
In der Tat, von der Terrasse, auf der beide sitzen, geht der Blick hinab zum Goldfischteich und zu der kleinen Wiese mit der Palmengruppe. Geflochtene helle Raumteiler trennen Sitzecken. Die Essenausgabe im Stil einer Trattoria ist hinter einem Hain von Immergrün versteckt, das gepflegt beschnitten bis fast ans Glasdach reicht. Wären nur die Mahlzeiten nicht so teuer. Man zahlt zwar bargeldlos mit Chipkarte, aber fünf Euro sind für eine Praktikantin mit Null-Einkommen auch virtuell ein nettes Sümmchen. Leiharbeiter zahlen dagegen nicht: Ohne Chipkarte kein Essen, also kein Grund sich an der Trattoria anzustellen. Letztens erst haben sie eine von denen erwischt, wie sie mit einem Glas stillen Wassers an der Kasse vorbeizitterte. Pech gehabt! Tut uns leid. Mit einem Klick kickte sie ihre Zeitarbeitsfirma aus der Personaldatei. Für die Zukunft alles Gute. Florian fällt wieder das Gerede der Kollegen ein, von dem ihm Leonore zynisch berichtet hatte: Wir sind doch keine Suppenküche, war der allgemeine Tenor.
Florian sieht Leonores Augen auf sich gerichtet.
„Was hättest du denn der Frau im Sari gesagt, Leo?“
„Auch nichts anderes als Johanna. Was blieb ihr weiter übrig? Sie musste vom Geld reden. Wovon sonst? Aber die Inderin wollte wahrscheinlich gar nichts davon wissen, sondern: Wie engagiert sich die Firma sozial?“ Leonore beißt in den Keks, der zum Espresso gehört. „Soziales? Ist da was? War da was? Ein Blumenstrauß zum Jubiläum. Na, Klasse. Die Betriebskita besteht noch, aber ohne Kinder. Nur noch als Kostenstelle. Buchhalterisch. Seit Jahren ohne Buchungen. Müsste mal gelöscht werden. Und die Vereine? Die Tennisanlage ist verkauft. Gab es nicht mal eine Keglerriege und Fußballer?“
„Keine Ahnung!“
„Weißt du, was aus der Sozialromantik von deinem Papa Thurmeisen geworden ist?“, setzt Leo ihren Gedanken fort, „Ich sag dir’s: Degeneriert zu Habenbuchungen auf den Gehaltskonten. Urlaubsgeld statt Betriebsausflug, 13. und 14. Netto statt Weihnachtsbescherung. Dazu ein verkürzter Arbeitstag im Advent statt gemeinsamem ,O du fröhliche‘, und wenn überhaupt eine Weihnachtsfeier, dann ‚lelujah‘ lallend im engsten Kollegenkreise in „Kalles Destille“ Anfang November, wenn nicht gerade Champions League läuft. Und das Eigentümliche: Fragst du die Kollegen, ist den meisten die Kohle lieber. Die Firma eine große Familie? Ach herrje. Jeden Moment kannst du aus ihrem trauten Kreise fliegen. Da nehm ich lieber gleich das Geld. Billigjobber und Leiharbeiter gehen eh leer aus. Die gehören gar nicht erst dazu. Wir sind doch keine Suppenküche.“
Sie hält ihren Essens-Chip zwischen den schmalen Fingern mit den rot lackierten Nägeln.
Florian grinst. „Na, wir von der Thurmeisen Catering GmbH gehören auch nicht dazu.“
„Siehste! Aber du darfst hier wenigstens mitessen.“
„Bin ja offiziell auch Kantinenmitarbeiter.“
Florian lacht. Unauffällig schaut er zur Uhr über der Trattoria, an der zwei Nachzügler mit ihren Tabletts stehen. Dreizehn Uhr. Pausenschluss.
„Hallo. –
Robert. –
Der ist verreist. –
Die ist bei der Polizei. –
Gleich. –
Mit der Eisenbahn spielen. Aber Ricarda nervt ständig. – Eh, hör auf damit. –
Ja. – Tschüß.“
Stenogramm eines Telefonats aus Leos aufgeklapptem Cabriolet heraus. 16:30 zeigt das Handy, als Florian die rote Banane drückt.
„Robert war an der Strippe. Heiner ist noch nicht nach Hause gekommen“, interpretiert Florian die Gesprächsfetzen. „Hilke ist wieder bei der Polizei und er hat Stress mit seiner Schwester.“
Keine Reaktion. Nur ein angedeutetes Kopfnicken. Zur Kenntnis genommen. Leo blickt unverwandt geradeaus.
„Stell dir vor, die Kinder sind allein zu Hause.“
Florian schaut nach links zur Fahrerin. Ihre Haare wehen unter der hineingesteckten Sonnenbrille wie ein rotgoldenes Banner. Mit den Augen tastet er ihre Konturen ab. Die Stirn, die Augenbrauen, die Nase, die Lippen, das Kinn. Er liebt ihr Profil.
Ein schönes Gesicht. Dabei so zielsicher. Voller Konzentration. Wohlwissend, wohin sie will. Florian findet ihre Fahrweise meist um einige Tachostriche zu flott. Aber eine Situation von Weitem zu erkennen, einzuschätzen und entsprechend zu lenken, darin ist sie gut! Sie kommt schneller voran als andere. Immer in der richtigen Spur. Meistens liegt sie richtig.
Auch bei Heiner? Wie schon den ganzen Tag, geht er ihm selbst bei sechzig Sachen im Berufsverkehr nicht aus dem Kopf. An eine glückliche Erklärung für sein Fehlen glaubt er nicht mehr. Optimismus, ja, Zweckoptimismus, mit jeder Stunde ausbleibender Nachrichten schwächer werdend. Er ahnt inzwischen Schlimmstes.
Die Bülow-, Yorck- und Gneisenaustraße hinter sich, hat Leos Wagen den Südstern erreicht. Die Ampel springt auf gelb. Sie bremst. Einer in Shorts und T-Shirt stellt sich vor ihr Auto und gestikuliert mit einem Scheibenreiniger. Auffordernd nickend dreht sich Leo zu ihrer Handtasche auf dem Rücksitz.
Florian sieht nur Heiner vor sich – vor der großen, grauen, kaiserlichen Garnisonkirche auf der Mitte des Platzes. Ein Haus für des Kaisers Krieger. Kurz nach Ostern erst haben sie sie besichtigt, alle Sechs. Die beiden Kinder haben sich lustig gemacht über die grinsenden durstigen Ungeheuer, die draußen lästerlich mit ihren langen, spitzigen Mäulern und Schnäbeln aus den Wandecken gaffen und schon längst kein Regenwasser mehr speien. Und drinnen diskutierten die Erwachsenen die Sprüche an den Wänden: die Strophe von Gott, der ein feste Burg ist, ein gute Wehr und Waffen, hammerhart wie Luthers Thesenanschläge an der Wittenberger Schlosskirche. Wozu überhaupt? Florian dozierte damals von Hottentotten, Boxern und Hereros, denen die Gottesdienstteilnehmer dieser Kirche (Helm ab zum Gebet!) zu Leibe rückten und die Wüste heiß machten, wenn sie nicht strebsam waren, in Reih und Glied, so wie es sich gehört. Selbst wenn es dein eigener Bruder ist, Rekrut! Schieß auf ihn. So sprach der Kaiser, der die Kirche bauen ließ. „Gute Wehr und Waffen? Kannste heute übertünchen. Hat mal jemand ‘ne Flasche tipp-ex da?“, schlussfolgerte Heiner und Hilke lachte dazu. Sie standen um das Taufbecken herum. Merkwürdig. Und Leo antwortete lutherfest: „Nicht so eilig, mein lieber Heiner. Das Wort solltest du lassen stahn. Wird immer noch gebraucht. Hurra und Halleluja auf unseren Doktor Martin Luther und alles, was den Geschäftsinteressen frommt, sei es am Hindukusch, in Bagdad oder auf dem Balkan und gegen die Belagerer der festen Burgen an den Tagungsorten von G8, IWF und Weltbank.“
Ob Leo auch gerade an Heiner denkt?
Die Ampel springt auf grün und mit ihr springt der gestiefelte Scheibenwischer von der verschmierten Windschutzscheibe zurück neben Leos Wagentür. Sie drückt ihm eine Münze in die Hand, dann den Knopf für die Scheibenwischanlage und wischt sich schließlich deren Spritzer von der Stirn. Die nächste Ampel zeigt schon bei Ankunft grün, der Verkehr kommt in Fluss, das Gespräch nun auch. Florian wendet es nicht auf Heiner, sondern seinen Sohnemann.
„So aufgeweckt der Robert ist, am Telefon sagt er nicht viel.“
„Er hätte gar nicht erst rangehen dürfen“, meint Leo. „Ich als Entführerin wüsste jetzt, dass bei Robert und Ricarda Besuchszeit ist.“
„Hilke hat ihnen bestimmt verboten zu telefonieren, wenn sie nicht da ist.“
„Sicher, Flo.“ Leonore beschleunigt. Hasenheide, linke Fahrspur. Leo vorneweg. Freie Fahrt. Die Spitze der Tachonadel kratzt die Achtzig. „Aber stört den Robert das? Wie oft sagen wir den Kindern, wenn wir mit ihnen unterwegs sind: ‚Tut dies nicht, tut das nicht‘. Robert macht doch trotzdem, was er will. Weißt du noch, wie wir im Schlosspark nach ihm gesucht haben? Und wie wir ihn dann im Batseba-Brunnen fanden, mit nasser Unterhose, die Hand am Wasserstrahl?“
„Stimmt, aber erst als wir die vollgespritzten Fußgänger schimpfen hörten.“
„Und Ricarda fing an zu kreischen, sie wolle auch zu der nackten Frau ins Becken.“
„Oh ja, ein toller Nachmittag. Einer der seltenen Momente, wo ich froh war, dass wir selbst keine Kinder haben.“
Nach zwei Runden um Florians Mietskasernenblock findet Leo eine Parklücke. Sie schließt Verdeck und Türen, dann tauchen sie ein in den Lärm der Karl-Marx-Straße. Sie holt vom Istanbul Markt noch eine Tüte voll Gemüse, Oliven und Fladenbrot. Er geht schon vor, durch die schiefe Tür zu Haselbach/Baken, erster Stock. Auf dem Treppenabsatz plauschen Frau Öczan, die quirlige Kleine aus dem dritten Stock, und Florians Nachbarin, Oma Schudoma, Franziska mit christlichem Namen, stets adrett frisiert und – wie alt sie auch sein mochte – à la mode gekleidet, ganz Dame von Welt, einer vergangenen Welt, in der der vordere Aufgang für Dienstboten tabu war und auf den Klingelschildern noch Fritsche, Bergmann, Dr. Schellenberger stand, auf einem sogar „Carl August von Krause“.
„Guten Tag, Herr Haselbach.“
„Guten Tag“, Kopfnicken, Lächeln und schnellstens hinein in den Schutz der Wohnung. Alltägliche Treppenhaushöflichkeit und vorgetäuschte Geschäftigkeit als Verteidigung gegen die Nachbarn, die – o Hilfe – versucht sein könnten, Florian in ein Gespräch zu verwickeln.
Tür zu, Jacke auf den Bügel, Schuhe parallel mit der Spitze zur Wand, auf Socken in die Küche, hellbraunes Leitungswasser und dunkelbraunes Pulver in die Kaffeemaschine, den müden Körper ins Wohnzimmer, Beine ausgestreckt aufs Sofa, kurzum: abschalten, so gut es geht.
Eine halbe Stunde später kommt auch Leo und sortiert die guten Dinge aus der Istanbul-Markt-Tüte in der Küche ein. Durch zwei Türen erzählt sie laut von Receps Kassendifferenz im Istanbul-Markt, von Frau Schudomas erfolgreichem Enkel und Frau Öczans vergeblichem Versuch Arbeit zu finden.
Florian hört nur halb hin. Ihm schwindelt vor dem Telefon, das auf dem Schreibtisch turmhoch aufragt, umso steiler und höher je heftiger er daran denkt. Hilke anrufen! Hilke Höfner. Heiners Frau! Heiners Witwe?
Flo krampft sich der Magen. Aus Angst vor dem Gespräch, aus Angst vor der schrecklichen Möglichkeit, die ihn bedrängt. Der Optimismus, Heiner könnte sich am Apparat melden, ist verflogen.
Leo, inzwischen barfuß, in Shorts und Bluse, kommt mit zwei Tassen Kaffee, einer weiß, der andere schwarz, aus der Küche zurück und winkelt sich in den Sessel. Sie scheint gefasster zu sein als Florian.
„Soll ich mit ihr sprechen? Von Frau zu Frau?“
Ein Angebot so verlockend wie unmöglich, denkt Florian. Es wäre eine Premiere. Immer waren Florian und Heiner am Draht, mit Gruß an Leo und Gruß an Hilke und die Kinder. Leonore mit Heiner, Leonore mit Hilke: solche Ferngespräche kamen nicht vor. Florian mit Hilke übrigens auch nicht oder nur kurz, wenn ausnahmsweise sie am Hörer ist („Kannst du mir mal Heiner geben?“).
So gern er Leo das Telefon hinreichen, sie mit der befürchteten Nachricht konfrontieren würde, er schüttelt den Kopf. Er hat vormittags schon zweimal mit Hilke telefoniert. Er wird es auch jetzt tun.
Er geht zum Schreibtisch, zieht das Telefon an seinem Antennenstummel aus der Halterung, wählt Heiners Nummer und legt das Gerät ans Ohr. Nichts zu hören. Dann von weit her der Doppelton. Noch einmal. Noch einmal.
„Höfner.“ War das Hilkes Stimme? „Wer ist denn da?“ Noch vier Wörter, fragil, leise, fast ängstlich, schüchtern und einschüchternd, zerschmettert und zerschmetternd. Florians Mut klumpt sich zusammen und sinkt. Er ahnt schon jetzt die Nachricht. Dieses brüchige Timbre kennt er nicht. Nicht von Hilke. Er weiß, dieser Ton bedeutet Trauriges.
„Hier ist Florian.“ Für den Unsinn, den er dann herauslässt, hätte er sich hinterher backpfeifen können, für den Schwall von überflüssigem, dummem Zeug, das er plappert. In ungewohnter Redeseligkeit. Der zerbrochenen Stimme am anderen Ende Pausen geben, Kraft zu neuen Sprechansätzen. Müssen denn wirklich alle Nachrichten, auch die unfassbarsten, in Worte gefasst werden? Mit Subjekt, Prädikat und Objekt, mit Adjektiven, Präpositionen und adverbialer Bestimmung, messerscharf und schmerzhaft: Wer, wann, wo und wie? Unter dem quälenden Einsatz unseres aufgeklärten Denkapparats, unter der Folter unserer Sprechwerkzeuge. Warum genügen uns nicht Gesten oder Laute, leise, ganz leise, als Signale?
Dann wird Florian still und unverständliche Flüstertöne pressen sich zwischen Ohr und Hörer ins Zimmer. Plötzlich feuert er das Telefon in Richtung Lutherbild und rennt hinaus. Im Schlafzimmer holt ihn Leonore ein. Mit den Fäusten trommelt er gegen den Schrank, als wolle er Sargbretter aus der Tür schlagen.
„Oh Heiner! Dieser Idiot, dieses Arschloch. Warum nur? Du verdammtes Arschloch. Du blöder Ochse. Was haben wir dir getan? Das kann doch nicht sein. Das ist nicht wahr.“
Leo hält ihn fest und zerrt ihn aufs Bett.
„Was ist denn? Flo, was ist denn los?“
Er verbirgt sein Gesicht. Sie dreht seinen Kopf zu sich.
„Was ist passiert?“
Sein Toben lässt nach. Es ist, als besinne er sich. Dann hält er die Hände vor die Augen, als schäme er sich seiner Tränen für Heiner, seinen einzigen Kumpel. Leo legt ihre Arme um seine Schultern und zieht ihn an sich. Ihr ist wie Florian. Jetzt stark sein, ihn drücken, trösten. Schweigend. Jedes Wort ist jetzt ein falsches Wort – selbst aus ihrem Munde.
Besinnungslosigkeit löscht die Erinnerung an die Gegenwart. Wie lange sie da lagen, wie eng, wann auch sie letztlich in Tränen ausbrach, wie viel Trost sie noch spenden konnte, ehe sie selbst welchen brauchte. Weiß es danach noch jemand? Anstrengend für Florian, krampfhaft Hilkes Sätze zu wiederholen, um sie Leo mitzuteilen. Es geht nun einmal nicht ohne Worte.
Zu sagen, wie Heiner losging, Bier für den Schachabend zu holen, wie Hilke mit jeder Minute, die er länger ausblieb, unruhiger wurde, nach drei Stunden die Polizei anrief, der Beamte ruhig auf sie einsprach, sie sich nachts zum Revier aufmachte und Alarm schlug, wie Robert ihre Mär von Heiners Reise nicht glaubte, er dann aber müde fragte, ob er sich nicht nachts mal wieder neben sie in Papas Bett legen dürfe, wie sie selbst eine Schlaftablette nahm, wie unerträglich sich der Sonntag dehnte, ohne Anruf, ohne Auskunft, ohne ehrliche Antwort auf die ungeduldigen Fragen der Kinder, vor allem von Ricarda, wann Papa denn endlich nach Hause komme, er hätte doch versprochen, mit ihnen Eisenbahn zu spielen, wie die Kripo vor ihrer Tür stand, ob sie so stark sei, mitzukommen und einen Mann zu identifizieren, der sich am Samstag um 14.47 Uhr in Halensee vor einen ICE geworfen hätte, wie sie beim Anblick seines linken Armes – viel mehr war vom Leichnam nicht freigedeckt – den Namen „Julie“ auf einem Hautfetzen erkannte, ihr weiß vor Augen wurde, der Beamte sie stützte und sie auf dessen Frage schließlich „ja“ sagte.
„Ja hat sie gesagt“, zischt Florian wie von Sinnen. Er brüllt Leo an und schüttelt sie. „Ja, verstehst du? Ja hat sie gesagt. So wie damals. Vor dem Altar. Wir alle haben es gehört. Er hat es auch gesagt. Ja! Bis dass der Tod uns scheide. Wir saßen direkt dahinter“, schreit er. „Und das Ja hieß damals Anfang. Und jetzt steht sie im Kühlraum, bibbert und sagt wieder ja. Aber jetzt heißt das Ja Ende. Abschied. Scheidung. Er hat sich scheiden lassen, auf diese Tour, dieser Arsch.“ Mit Wut gegen Trauer – ein unsäglicher Versuch.
Damals, mein Gott, wie lange war dies auf einmal her, und wie ewig das Jawort! Der Segen des Pfarrers, der Tausch der Ringe, ihr Kuss, ihr Lächeln. Leo hielt damals Ricarda auf dem Arm, Florian den zappelnden Robert an der Hand. Leo und Florian waren im Zeugenstand der Trauung, Zeugen einer glücklichen Ehe, einer Familie, fröhlich bis zur Ausgelassenheit. Sorgen: hallo? Probleme: na, wo denn! Leo und Flo und Heiner und Hilke mit Robert und Ricarda. Das war wie eine große Familie. Eine WG mit zwei Adressen, sagte Leonore. Genau genommen war es nur eine Anschrift: Westend. Höfners Reihenhaus und Garten.
Wie viele Wochen und Wochenenden verbrachten sie dort? Wie viele Prosecco verspritzten sie auf der Terrasse? Wie viel Klebrot haben sie geköpft? Und umgekippt. Besonders als Heiners gefeiertes Projekt, die patentreife Klebrotentkorkungsmaschine, fertig war. Monatelang hatten sie unter seiner Anleitung daran gearbeitet. Pedalantrieb, Fahrradkette, Ritzel, Gestänge und Transmissionsriemen, Wellen und Korkenzieherspirale nach seinen Zeichnungen zusammengeschraubt und -geschweißt. Dann der erste Probebetrieb. Hilke durfte auf dem Sattel sitzen und treten, Leo die erste Flasche unter die Öffnungsstation kurbeln, und am Ende lagen sechs Flaschen besten Klebrots unterm Tisch, eine kaputter als die andere. Heiner lachte nur und griff direkt zu Kehrwisch, Eimer und Lappen. Von einem Patentantrag nahm er feierlich Abstand. Mit den letzten Tropfen zusammengeschütteten Rotweins in ihren Gläsern und einer Abschiedsrede, die ans Zwerchfell ging, bestattete er die nie ernst gemeinte Erfindung. Sie hatten ihren Spaß gehabt, und damit war der Zweck erfüllt. Heiner ließ Ärger, Frust und Schwermut wenig Raum, und nur wer ihn näher kannte, wusste, dass er auch daran leiden konnte.
Und so bildete sich, noch unausgesprochen, eine Frage in Florians Kopf: Warum? Warum hast du das getan? Warum nur, du großes, großes Giga-Arschloch, Heiner, du alter Kumpel?