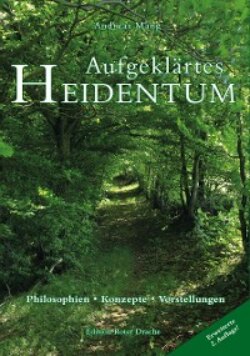Читать книгу Aufgeklärtes Heidentum - Andreas Mang - Страница 9
Was ist Religion?
ОглавлениеSind Sie religiös?
Eine an sich einfache Frage, doch hätte ich Probleme, sie ebenso einfach mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten, stellte man sie mir. Antwortete ich mit „nein“, wäre das falsch und unwahr, antwortete ich mit „ja“, würde man mich mit hoher Wahrscheinlichkeit mißverstehen. Das rührt daher, daß die heute üblichen Definitionen des Begriffs „Religion“ im wesentlichen aus dem christlichen Umfeld stammen und sie deshalb nur für Religionen zutreffen, die dem Christentum oder den anderen abrahamitischen Monotheismen wie Judentum und Islam ähnlich sind.
Eine gängige Definition ist, Religion sei die „Rückbindung an Gott“. Diese Aussage habe ich selbst schon von Heiden gehört, nur daß sie „Gott“ durch „Götter“ ersetzt haben. Diese Definition wurde von dem nordafrikanischen christlichen Apologeten Lucius Caecilius Firmianus, genannt Lactantius, den man zu den Kirchenvätern zählt, im frühen 4. Jahrhundert niedergeschrieben. Lactantius leitet religio von religare = „zurückbinden“ ab, Religion bildet bei ihm ein Band der Frömmigkeit zwischen Mensch und Gott [Fir12].
In späteren Zeiten, speziell im Mittelalter, wurde Religion dann fest mit dem Glauben an Gott, Götter oder andere höhere Mächte in Verbindung gebracht, was bis heute Geltung hat. Knaurs großes Wörterbuch der deutschen Sprache definiert Religion folgendermaßen [Her85]:
„1 Glaube an eine oder mehrere überirdische Mächte sowie deren Kult
2 Glaubensbekenntnis; christliche, jüdische R.“
Bezogen auf das Heidentum liefert diese Beschreibung zwei Schwierigkeiten. Zum einen spielt der notwendige Glaube im Heidentum eine andere Rolle als hier angedeutet (siehe Kapitel Was ist Glaube?). Zum anderen impliziert „überirdische Mächte“ eine Übernatürlichkeit oder Außerweltlichkeit, die leicht zu Mißverständnissen führt. Heidnische Götter werden eher als immanent denn als überirdisch im Sinne von transzendent oder jenseitig betrachtet (siehe Kapitel Was ist ein Gott?).
Das eigentliche Problem besteht allerdings in dem notwendigen Bezug auf höhere Mächte. Dies tangiert das Heidentum zwar nicht, aber beim Buddhismus zum Beispiel wird oft gefragt, ob dieser überhaupt eine Religion oder doch „nur“ eine Weltanschauung sei. Götter oder andere höhere Mächte sind im Buddhismus irrelevant, man kann an sie glauben, sie verehren, muß es aber nicht. Jemand, der höhere Mächte komplett ablehnt, kann dennoch Buddhist sein. Nun gibt es buddhistische Tempel, Klöster, Priester und Mönche sowie eine Lebenseinstellung und Verhaltensweisen, die auf das nächste Leben oder das Nirwana vorbereiten sollen. Für mich besteht keinerlei Zweifel, daß Buddhismus eine Religion ist, nur eine ohne Götter als konstituierende Elemente.
Eine in meinen Augen weitaus passendere Definition von Religion stammt aus vorchristlicher Zeit und läßt sich bei Cicero nachlesen [Cic95]. Cicero leitet religio von relegere = „aufsammeln“ oder „wieder auflesen“, im übertragenen Sinne „achtgeben“, ab. Einer Religion zu folgen, heißt hier, ihre Rituale, ihre Ethik, ihre Werte, ihre Ideale und ihre Traditionen zu beachten. Götter allgemein oder nur ganz bestimmte Götter oder höhere Mächte, egal in welcher Anzahl, zu einem exakt definierten Pantheon zusammenzustellen oder eine fest vorgeschriebene beziehungsweise dogmatisch festgelegte Vorstellung von diesen Mächten zu haben, ist hier nicht von Belang. Der Glaube an solche Konstellationen spielt dann nur eine untergeordnete Rolle; einen „falschen Glauben“, Häresien usw. gibt es im allgemeinen nicht.
So versteht Cicero an derselben Stelle auch etwas völlig anderes unter dem Begriff superstitio als im Christentum, welcher hier üblicherweise mit „Aberglaube“, das heißt den Glauben an falsche Götter oder falsche höhere Mächte, übersetzt wird. Superstitio ist für ihn übertriebene Frömmigkeit, d. h. überzogenes Beten oder Opfern, eine Überhöhung des Religiösen im Lebenswandel, so daß das Verhältnis von religiösem und „normalem“ Leben nicht mehr stimmt. Oben genannter Lactantius widerspricht dieser Auffassung übrigens vehement [Fir12].
Diese begriffliche Erklärung von Religion umgeht die Nachteile der heute üblichen. So zählt hier auch Buddhismus ohne jede Schwierigkeit oder zusätzliche Annahmen als Religion.
Bezüglich des germanischen Heidentums stellt sich nun die Frage, wie die Germanen wohl über den Begriff Religion gedacht haben. Leider gibt es hier keinerlei schriftliche Hinterlassenschaft, die mit den philosophischen Arbeiten der Griechen und Römer vergleichbar wären, so daß wir keine direkte Kenntnis haben. Angesichts der vielen Gemeinsamkeiten zwischen griechisch-römischer und germanischer Mythologie, auch wenn man von letzterer nicht annähernd so viel weiß und sie, so sie denn erst im Mittelalter notiert wurde, teilweise von christlichem Gedankengut beeinflußt ist, hege ich die Vermutung, daß der Grundgedanke hinter der Religion bei den Germanen nicht wesentlich anders als bei Griechen und Römern aussah. Selbiges vermute ich auch für Kelten und Slawen, um weitere europäische Ausprägungen des Heidentums zu nennen.
Ein weiterer interessanter Punkt bei Religion ist, daß viele meinen, man könne nur eine haben. Einer Religion zu folgen, bedeute, daß man alle anderen für falsch halten müsse.
Daß dies nicht korrekt sein kann, zeigt allein die Tatsache, daß ein Großteil der Japaner zwei Religionen folgt, die so gut wie nichts miteinander zu tun haben, nämlich Buddhismus und Shintoismus. Buddhismus lehrt u. a. die Überwindung des eigenen Egos, des eigenen Individuums, um der andauernden Wiedergeburt zu entgehen und ins Nirwana einzugehen. Shintoismus dagegen ist eine animistische Naturreligion; die Seele eines Toten fährt nach dieser Anschauung in einen Schrein oder einen Teil der Natur. Im Shintoismus werden kami () verehrt, was gewöhnlich mit „Götter“ übersetzt wird. Diese Übersetzung geht allerdings nicht weit genug, unter kami versteht man auch Naturgeister oder Seelen von Verstorbenen. Für eine Einführung in den Shintoismus siehe z. B. [Lok01].
Auch im antiken Heidentum war es üblich, mehrere Religionen parallel zu haben [Kla95], auch wenn man heute eher von „Kulten“ statt von Religionen sprechen würde. Angesichts der oben genannten Definition von Religion seitens Ciceros sehe ich zwischen einer Religion und einem Kult allerdings keinen wesentlichen Unterschied. Wer die Anforderungen zweier religiöser Kulte beachtet, folgt bei großen Unterschieden zwischen den Kulten halt zwei verschiedenen Religionen.
So hatte ein Römer mindestens die Staats- und die Hausreligion. Bei ersterer wurde das römische Pantheon verehrt, bei letzterer z. B. die Hausgeister, die Laren und Penaten. Nun passen diese beiden Vorstellungen noch gut zusammen und widersprechen sich auch in keiner Weise, so wie es Buddhismus und Shintoismus anscheinend in weiten Teilen tun. In der Antike nahm man allerdings noch häufig an religiösen Vereinen1 teil, zu denen auch die Mysterienkulte gehörten und die sich nach dem Zusammenbruch des griechischen Städtesystems bildeten [Kla95]. Die Gotteswelt des Isis-Kultes z. B. paßt überhaupt nicht mit dem römischen Pantheon zusammen, eine gedankliche Kombination ist hier kaum möglich. Aus politischen und ethischen Gründen, wobei die ethischen Gründe auch religiösen Ursprung haben konnten, schritt der römische Senat öfter gegen diesen ägyptischen Kult und andere ein, verbot sie sogar für kurze Zeiträume. Ihre Praktizierung und Ausbreitung verhindern konnte er nicht [Klo06].
Auch wenn wir jetzt ein wenig dem Kapitel Was ist ein Gott? vorgreifen, die scheinbaren Widersprüche beim Folgen von Religionen mit inkompatiblen Pantheons lösen sich auf, weil im Heidentum in der Regel ganz andere Gottesvorstellungen als in den Monotheismen vorherrschen. Betrachtet man einen Gott als menschliche Beschreibung für etwas schwer Beschreibbares, das dahinter steht, stellt ein anderes Pantheon einfach eine andere Sichtweise auf das dahinterstehende dar. Die Römer nannten es interpretatio Romana = „römische Deutung“, wenn sie Götter aus anderen Kulturen mit ihren identifizierten.
Die Eigenschaften und „Aufgabengebiete“ von Göttern verschiedener Pantheons sowie deren Beziehungen untereinander verhindern vielleicht, daß man sie in einem Ritual oder Gebet gleichzeitig ansprechen kann – bei verschiedenen Ritualen sich jedoch auf andere Pantheons zu beziehen, stellt für einen Heiden kein Problem dar, auch wenn er gewöhnlich zu einem Pantheon allein steht.
Jede andere Religion außer der eigenen, die die absolute Wahrheit darstellen soll, für grundfalsch zu halten, ist eine Eigenschaft der abrahamitischen Monotheismen. Der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Jan Assmann nennt dies Teil der „Mosaischen Unterscheidung“ und identifiziert ihr Auftreten mit dem Umbruch des Judentums vom Poly- oder Henotheismus zum Monotheismus, siehe [Ass03] oder [Ass07]. Ein allgemein bekanntes Indiz für diese These liefert das erste Gebot im Alten Testament. Dort ist nicht die Rede davon, daß es sich bei „Gott“ um einen verehrungswürdigen Gott handelte oder daß das Anbeten dieses Gottes eine positive Sache sei, dort wird einfach gesagt: „Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.“ (2. Mose 20,3). Andere Götter zu haben, sei falsch, beim eigenen Gott liege die Wahrheit, bei allen anderen die Unwahrheit, und das hat direkten Einfluß auf den Wahrheitsgehalt der mit dem Gott oder den Göttern verbundenen Religionen. Heutzutage sehen das zum Glück für andere viele Anhänger der abrahamitischen Religionen weitaus toleranter als in früheren Zeiten. Der Vatikan zum Beispiel bezeichnet die römisch-katholische Kirche (RKK) seit dem 2. Vatikanischen Konzil nicht mehr als alleinige und einzige Quelle der selbst antizipierten Wahrheit, sondern gesteht auch anderen Religionen Teile dieser Wahrheit zu, wenn auch nicht in dem Umfang, wie ihn die RKK besitze [Vat65]. Alle anderen Religionen außer der eigenen für falsch zu halten, schwingt zwar als Grundgedanke immer noch mit, als offensives Argument taucht dieser Gedanke aber meistens nur noch im Fundamentalismus auf.
Man kann die Gebote allerdings auch als eine Sammlung von Werten und Tugenden sehen, an die man sich hält, wenn man den darin involvierten Gott verehrt. Sie sind dann keine Befehle Gottes, sondern die Verhaltensweisen der Gläubigen, die zur Gottesvorstellung passen. Wer einen monotheistischen Gott verehrt oder an ihn glaubt, hat selbstverständlich keine weiteren Götter, das ergäbe keinen Sinn. Die äußere Form der Gebote lautet dann nicht „du sollst folgendes“, sondern „wenn du an diesen Gott glaubst, dann tust oder unterläßt du folgendes“. Es geht also mehr um Ethik als um Justiz; dazu passen auch die fehlenden Strafmaße im Dekalog [Sch95].
Selbstverständlich halten auch die Anhänger anderer Religionen als der abrahamitischen ihre eigenen religiösen Ansichten für wahr, sie lehnen die anderer Religionen aber nicht unbedingt kategorisch ab. Ein gutes Beispiel dafür sind die oben schon erwähnten Japaner, die zwei nach westlichen Maßstäben widersprüchliche Religionen haben.
Viele religiöse Ansichten, insbesondere ethische und solche, die sich auf die Lebensführung beziehen, basieren auf der persönlichen Lebenseinstellung. Die Lebenseinstellung entwickelt sich aufgrund des gesellschaftlichen Umfeldes, der elterlichen Erziehung, persönlichen Erfahrungen und ebenso persönlichen Entscheidungen. Ich denke, es ist offensichtlich, daß eine solche Lebenseinstellung wegen der vielen involvierten Umweltfaktoren sich nicht allgemein naturwissenschaftlich herleiten läßt und ihr somit eine objektive Gültigkeit für alle Menschen abgeht. Eine solche Objektivität muß man aber annehmen beziehungsweise fordern, wenn man eine bestimmte Religion als die allein richtige für alle Menschen hält und propagiert.
Als Beispiel für eine religiöse Ansicht, die stark mit der Lebenseinstellung korreliert, möchte ich den Umgang mit dem Schicksal nennen. Stoiker z. B. glauben an eine beinahe ultimative Schicksalsabhängigkeit, der man laut Seneca eigentlich nur durch den Freitod entgehen kann [Kla96]. Auch bei vielen Christen, Juden und Moslems kann man einen fortgeschrittenen Fatalismus erkennen, weil sie das Schicksal als Ergebnis der Handlungen und Wünsche eines allmächtigen und allwissenden Gottes halten, an dem man als Mensch keinen Anteil hat. Den Freitod als Alternative akzeptieren diese natürlich nicht.
Eine gegensätzliche Position besteht darin, ein sich negativ anbahnendes Schicksal zu bekämpfen. Dies ist im germanischen Heidentum oft anzutreffen, weil hier die Götter genauso wie die Menschen im Schicksalsnetz gefangen sind und ebenfalls gegen ein sich schlecht entwickelndes Schicksal ankämpfen, selbst wenn der Kampf aussichtslos sein sollte. Ein gutes Beispiel dafür ist der Ragnarök-Mythos [Jor01]. Obwohl Odin weiß, daß er weder den drohenden Weltuntergang noch seinen Tod abwenden kann, rüstet er gegen dieses Schicksal und versucht, es zu verhindern. Dies kann man als Lehre nehmen, ein sich anbahnendes negatives Schicksal nicht hinzunehmen, sondern dagegen vorzugehen. Nur wenn man es bekämpft, hat man eine Chance, es abzuwenden. Auch im griechischen Heidentum, in dem die Götter im Gegensatz zum germanischen oft Schicksal für die Menschen spielen, sind sie nicht immer vor dem Schicksal selbst gefeit. Der Tod des Sarpedon, eines Sohnes des Zeus, im 16. Gesang der Ilias [Hom09] wird gerne so gedeutet.
Ein weiterer Fehler, den viele Religiöse, insbesondere Monotheisten, machen, und der ebenso mit einer vorgeblichen Objektivität der eigenen religiösen Texte zusammenhängt, ist zu glauben, die eigene Religion würde erklären, wie die Welt im naturwissenschaftlichen Sinne funktioniert. Sei es nun, seine Schöpfungsgeschichte oder diverse Mythen für historische Tatsachenberichte oder die Evolution aus obskuren Glaubensdogmen heraus für falsch zu halten. Da gibt es Christen, die für die Welt ein Alter von 6000 Jahren annehmen, was zwar angesichts der geologischen, astronomischen und kosmologischen Kenntnisse unsinnig ist, sich so aber mittels des Alten Testamentes ausrechnen läßt, wie es der anglikanische Bischof Ussher getan hat [Uss50].
Ich sage dagegen: Wer wissen will, wie der Kosmos funktioniert, soll Physik-, Chemie- oder Biologiebücher lesen. Wer eine bildhafte und poetische Beschreibung haben möchte, wie man in der Welt leben sollte, der lese einen Mythos. Und wer mit Leidenschaft spüren will, wie sich die im Mythos geschilderte Welt verhält, der feiere ein religiöses Ritual. Die Religion kann einem sagen, wie er in der Welt leben soll. Das ist etwas, was die Wissenschaft, speziell die Naturwissenschaft, nicht leisten kann. Das hat nichts mit fehlender Wahrheit zu tun, sondern mit Wahrheiten in Bereichen, die der Naturwissenschaft nicht so einfach oder auch gar nicht zugänglich sind, wie zum Beispiel Ethik oder Lebenseinstellungen.
Ein weiteres gutes und bekanntes Beispiel dafür, welchen Schaden naturwissenschaftlich interpretierte Mythen anrichten können, ist die Ablehnung des heliozentrischen Weltbildes durch die römisch-katholische Kirche. Erst vor kurzem wurde Galileo Galilei diesbezüglich rehabilitiert. Dabei wurde das heliozentrische Weltbild schon im 3. Jhd. v. Chr. von Aristarchos von Samos aufgestellt [Sag82], der vermutlich auch die Möglichkeit des empirischen Nachweises durch stellare Parallaxe2 vorgeschlagen hat, welche allerdings zu klein ist, als daß man sie ohne Ferngläser und nur mit bloßen Auge feststellen könnte. Leider ist von Aristarchos nichts Schriftliches direkt erhalten, man kennt sein Werk nur durch Sekundärliteratur. Vermutungen über seine wissenschaftlichen Experimente, ob vorgeschlagen, geplant oder durchgeführt, sind daher sehr vage. Aristarchos mag auch sehr weit bis unendlich weit entfernte Sterne angenommen haben, was der fehlenden Möglichkeit des Nachweises der Parallaxe mit bloßem Auge entspricht.
Das Schlimme hierbei ist, daß dieses Weltbild nicht aufgrund des fehlenden empirischen Nachweises bis in die Neuzeit abgelehnt wurde, sondern wegen des Inhalts religiöser Mythen, die in eine andere Richtung deuteten, und der Dogmatisierung philosophischer und astronomischer Aussagen wie des ptolemäischen geozentrischen Weltbildes. Erfolgt dann der naturwissenschaftliche Nachweis, entsteht automatisch der Eindruck, daß die damit verbundenen religiösen Mythen falsch seien, egal welche sonstigen Lehren sie noch für die Lebensführung oder anderes enthalten mögen. Eine solche naturwissenschaftliche Aushebelung derartig interpretierter Mythen fördert natürlich den Atheismus als Ablehnung jedweder Religion. Mythen sollten daher anders interpretiert werden als naturwissenschaftlich, wie wir genauer im Kapitel Was ist ein Mythos? sehen werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Begriffsbestimmung von Religion ist ihre Kategorisierung nach bestimmten Typen oder Formen. Gewöhnlich wird zwischen Monotheismus und Polytheismus unterschieden, allerdings bereiten diese Kategorien einige Schwierigkeiten. Allein dem Namen nach unterscheiden sie Religionen, die entweder genau einen Gott oder mehrere Götter haben. Der wesentliche Unterschied zwischen abrahamitischen Monotheismen und europäischen Polytheismen liegt aber weniger in der Anzahl der Götter sondern in der Art und Weise, wie sie angesehen werden.
Desweiteren paßt der Hinduismus nur schwerlich in diese Kategorisierung. Mit seinen 330 Millionen Göttern würde man ihn sofort dem Polytheismus zurechnen, allerdings sind alle diese Götter letztlich Inkarnationen eines einzigen höheren Geistes, was zum Typus des Monotheismus passen würde [Cot08]. Da dieser Geist aber weit weniger personale Elemente enthält und oft als kosmologisches Prinzip dargestellt wird, ist eine gemeinsame Kategorie mit Christentum, Judentum und Islam als weiteren Monotheismen nicht gerade statthaft.
Jan Assmann kritisiert die Verwendung dieser Kategorien, weil die Begriffe erst in „kontroverstheologischen Debatten des 17. und 18. Jahrhunderts“ entstanden und „für die Beschreibung antiker Religionen vollkommen ungeeignet“ seien [Ass03]. Wie viele Götter man habe, wäre nicht von Interesse gewesen, und er zählt auch nicht-göttliche, aber dennoch höhere Wesen wie Engel, Dämonen oder im Heidentum Wesen der niederen Mythologie zur Religion dazu, so daß der Begriff Monotheismus auch bei nur einem Gott unzureichend ist.
Stattdessen kategorisiert Assmann in primäre und sekundäre Religionen, die auf der Unterscheidung von primärer und sekundärer Religionserfahrung nach dem Theologen Theo Sundermeier aufbauen [Mue87]. Primäre Religionen sind prähistorisch entstanden, man kennt hier weder den Zeitpunkt der Entstehung, vermutlich weil sie eine stetige Weiterentwicklung von weit in der Vergangenheit liegenden religiösen Ansichten sind, noch einen oder mehrere Stifter. Bei sekundären Religionen sind diese beiden Punkte definitiv der Fall, man kennt den groben Zeitrahmen der Entstehung und mindestens einen Stifter. Europäische heidnische Religionen und der Hinduismus sind nach diesem Muster primär, Christentum, Islam und Buddhismus sekundär. Beim monotheistischen Judentum kennt man zwar keinen Stifter namentlich, aber der Zeitrahmen und die stiftenden Priester als Gruppe sind gut eingrenzbar, so daß man auch das Judentum als sekundär bezeichnen kann. Assmann bemerkt an derselben Stelle noch, daß jede sekundäre Religion eine Buchreligion sei, so daß eine Unterscheidung zwischen Buch- und Nicht-Buchreligionen in etwa seiner Kategorisierung entspricht. Eine Ansammlung schriftlich fixierter Mythen und Geschichten ohne dogmatische oder glaubensbekennende Aussagen zählt nicht als Buchreligion. Dieser Typus trifft daher nicht auf griechisches, römisches oder germanisches Heidentum zu.
Abbildung 1: Häufige Gottesvorstellungen in primären und sekundären Religionen
Eine besonders im modernen Heidentum verbreitete Kategorisierung ist die Unterscheidung zwischen Offenbarungs- und Erfahrungsreligionen. Diese bezieht sich allerdings mehr auf den persönlichen Umgang mit der eigenen Religion als auf deren äußere Form. Eine Offenbarungsreligion fußt zum größten Teil oder gar komplett auf einer oder mehreren Offenbarungen, die einem oder mehreren Stiftern zuteil geworden ist, was stark mit Buch- und sekundären Religionen korreliert. In einer Erfahrungsreligion ist dagegen die persönliche Erfahrung mit den Göttern wichtig, sei es im Ritus, im Gebet, in der Meditation, in der Reflexion von Mythen oder auf anderen Wegen wie der Rekonstruktion älterer Formen der eigenen Religion. So sinnig diese Unterscheidung auch ist, in der Praxis kann sie durchaus zu Problemen führen. Das Christentum beispielsweise ist natürlich im wesentlichen eine Offenbarungsreligion, deren Offenbarung in der Bibel aufgeschrieben ist; viele Christen sehen es aber als Erfahrungsreligion, was bezüglich des Auf- oder Ausbaus einer persönlichen Beziehung zu Jesus ja durchaus korrekt ist.
Animistische Vorstellungen – das heißt, daß so ziemlich alles in der Welt beseelt sei – sind auch im Heidentum sowie in den meisten anderen Religionen anzutreffen. Dies rührt vermutlich daher, daß der Animismus als Archetyp einer Naturreligion eine der ersten Religionsformen überhaupt darstellt und sich in zeitlich darauffolgenden Religionen vererbt hat. Ebenso ursprünglich sind wohl Bestattungsriten und damit verbundene Jenseitsvorstellungen und Ahnenkulte [Rie93].
Abbildung 2: Gottesvorstellungen weiterer Religionsformen
Es gibt noch weitere Religionsformen, die mit den bisher genannten Kategorien kaum beschreibbar sind. Sie haben zwar keinen oder nur geringen Bezug zum Heidentum und dessen Abgrenzung zum Christentum beziehungsweise den anderen abrahamitischen Monotheismen, sollen aber der Vollständigkeit halber hier erwähnt werden.
Pantheismus: Die Vorstellung, daß das Universum und Gott identisch seien oder daß dem Universum ein göttlicher Geist oder ein göttliches Prinzip innewohne.
Panentheismus: Ähnlich dem Pantheismus, nur daß hier das Universum lediglich einen Teilbereich eines umfassenderen göttlichen Wesens darstellt.
Deismus: Die Annahme eines Schöpfergottes, der nach der Schöpfung des Universums allerdings nicht mehr in dasselbe eingreift.
Pandeismus: Eine Mischung aus Deismus und Pantheismus, d. h. der Schöpfergott geht nach der Schöpfung vollständig im Universum auf.