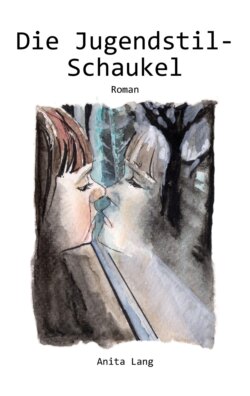Читать книгу Die Jugendstil-Schaukel - Anita Lang - Страница 2
1. Kapitel
Оглавление„Ich habe unsere Cilli gefunden!“ Marie klatscht freudig in die Hände. „Sie arbeitet von früh bis spät als Dienstmädchen.“ Gespannt hält Agnes den Atem an. „Endlich, wie geht es ihr?“ „Du weißt, ich kann sie nur sehen, wenn sie an mich denkt.“
Cilli sieht blass aus. Mit zwölf Jahren kam sie hierher, nach Laa am Grenzfluss. Nun dürfte sie achtzehn sein. Eine fesche Dame ist aus ihr geworden, mit aufgestecktem, dichten Haar und feinem Gesicht. Die langen, nach Seife duftenden Kleider, die zart gemusterte Schürze, lassen sie gut situiert aussehen. Obwohl sie eigentlich nur eine Dienstmagd ist. Ihre Hände sind kräftig, von der vielen Plackerei. Kiloweise, emsiges Kartoffel schälen. Faltenfreies Bügeln sauber gewaschener Wäscheberge. Zum Leuchtglanz geputzte, hohe Glasfenster. Schmerzende Arme eines fleißigen Mädchens. Mariechen hat auch mitbekommen, dass sie unter der Treppe schlafen muss. Nicht einmal ein Bett haben ihr ihre Dienstherren zugeteilt. „Heute hat sie Grammelknödeln aus Erdäpfelteig gekocht, für die Familie. Mit Sauerkraut.“ Fabelhaft, wie es den Kriehubers schmeckte. Eine Blaskapelle marschierte an ihrem Haus vorbei. Der blecherne Klang treibt der kleinen Schwester wieder Tränen der Rührung in die Augen. Das, und die Erinnerung an die leckeren Speisen.
„Öha!“, Agnes wäre fast von der Schaukel gekippt.
„Vater hat das öfter gesagt“, erinnert sich Marie kichernd.
„Auch schon egal, hier kann dir nichts mehr passieren.“
Im Park der Dichter schwingen die Schwestern, Stunde um Stunde, unter der Baumkrone des steinalten Ahornbaums hin und her. Nebeneinander sitzend, auf ihrem Schaukelbrett, reden sie über vergilbte Zeiten. Als ihnen noch vergönnt war, munter auf Erden zu weilen. Die marmornen Statuen von Schiller und Goethe richten ihre adeligen Blicke auf die runden Zierformen und Schnörkel roter und gelber Begonien-Beete. Am murmelnden Mühlbach füllt eine Gärtnerin ihren Blechkübel mit frischem Wasser. Mariechen summt leise vor sich hin, im Rauschen eines vorbei kommenden Lüftchens.
„Sing mit mir, so wie früher“, bittet sie. Agnes denkt an die Schwalben. Wie fürsorglich sie doch ihre Jungen gefüttert haben, hoch oben im Kuhstall, in ihrem stillen Dorf. Dann gibt sie sich einen Ruck und trällert mit.
„Wo werden sie wohl geblieben sein - Agnes und Mariechen?“ fragt sich Cilli, bevor sie ihr Nachtgebet spricht. Im Gebet kann sie ihre Sorgen abladen. Sie haben ihr ein Nachtlager zugewiesen, unter der Treppe, die zum Dachboden führt. Zehn Kronen zahlen sie ihr hier, am Ende des Monats. Mutter und die Geschwister brauchen das Zubrot daheim, um den stattlichen Bauernhof an der Hauptstraße über Wasser zu halten. Das nötige Saatgut zu kaufen, damit Weizen und Kartoffeln gedeihen können. Die gescheckte Kuh soll genügend Heu haben, die im Hof scharrenden Hühner ihre Körner. Die Wände riechen nach frischer Kalkfarbe. Vor dem Eingangstor sind bunte Dahlien ausgesät, um im Frühling unter den Akazien aufzublühen.
Sie sieht den massiven, großen Holztisch in der Küche vor sich. Fünf Schwestern und drei kleine Buben sitzen verunsichert, dicht an dicht. Ihr letztes Beisammensein. Die Brüder können ihre Füße nicht still halten, schlagen ihre Fersen gegen die Bank. Mutter Katharina mit ihrer geflochtenen Frisur und dem bodenlangen, rauschenden Rock. Vater hat sich, von einer Erkältung geplagt, heim geschleppt vom Acker. Katharina macht ihm Lindenblütentee und Umschläge aus Apfelessig, um das Fieber zu senken. Jedoch in der darauf folgenden Nacht geht es zu Ende mit ihm.
„Ihr müsst jetzt tapfer sein! Mariechen und Agnes fahren zu Onkel und Tante in Berlin“, eröffnet Mutter ihren Plan, um der Geldnot zu entrinnen. Eine große Lücke, die durch den Tod des Vaters entsteht. „Cilli muss in den Dienst zum Kriehuber in die Stadt.“ Mit ernster Miene streckt ihre Mutter die Handflächen vor. „Es bleibt uns kein anderer Ausweg.“
Zu Fronleichnam, im Morgengrauen, machte sich Cilli auf den Weg zum Haus ihrer künftigen Brotgeber. Aus einer bäuerlichen Welt, in der das Notwendigste zum Überleben da war. Ihr blieb kaum Zeit, über Vaters Tod zu weinen. Das Klappern ihrer Holzschuhe auf dem Straßenpflaster. Die Hauptstraße entlang bis an die Grenze, gesäumt von Akazienbäumen, die gerade in der Blüte standen. Ihre Freuden im Alltag bestanden aus freundlichen Worten, einem friedlichen Zusammenleben. Dem Anblick der blauen Kornblumen und des roten Klatschmohns in den goldenen Weizenfeldern. Die köstlichen Gerichte, die Mutter kochte. Das langsame Auffalten der gelben Blüten der „Königin der Nacht“, wenn sie am Abend im Vorgarten beisammen standen. Zufriedenheit, wenn sie ihr Tagwerk bewältigen konnten, bevor die Nacht hereinbrach.
Den Rathausplatz hatte sie früher schon einmal gesehen, als sie Vater zum Markttag begleitet hatte. Schmuck sah sie aus, die mit Reliefs verzierte Fassade des Bürgerhauses, an der Ecke des Platzes. Das Erkerfenster und die obere Fensterreihe, wie mit weißem Biskuitporzellan belegt, auf Schönbrunner Gelb. Die teuren, bunten Glasfenster neben dem Eingang des zweistöckigen Hauses zeigten den heiligen Florian. Der Schutzheilige, der die Bewohner vor Feuer bewahren soll.
Familie Kriehuber hatte ihr Vermögen mit der Herstellung von Fässern gemacht. Tagsüber hatten sie mit ihren zahlreichen Geschäften zu tun. Erna, die resolute Hausdame, öffnete ihr die Tür.
„Grüß Gott, ich bin die Cäcilia Weihs.“ Cilli knickste und nannte ihren vollen Namen, wie in der Schule.
„Komm rein, wir haben dich erwartet.“ Erna atmete auf, endlich bekam sie Verstärkung. Sie war eine geduldige, fleißige Angestellte, gab sich erheblich Mühe, Cilli auszubilden. In allem, was in Haus und Küche gebraucht wurde. Der vornehme Haushalt verfügte über kupferne Töpfe und Pfannen. Feines Porzellan, geschmückt mit grünen Efeublättern. Silbernes Tafelgeschirr auf weißen Damast-Tischtüchern. Hauchdünne, gravierte Bleikristallgläser. Einen schwarz-goldenen Paravent vor der Chaiselongue. Die wohlhabenden Betten mit vielen Polstern, Überwurfdecken aus rot-schwarzem Brokat. Allerlei kunstfertiger Hausrat und glamouröse Ziergegenstände. Die passende Garderobe für diverse Anlässe. Für das Ehepaar, die Eltern der Hausherrin, zwei Kleinkinder und zwei Schulkinder. Cilli wunderte sich, dass sie so viel redeten. Schwulstige Redewendungen, die ihr noch nie zu Ohren gekommen waren.
„ Der ist hin in der Marille“, sagte Erna einmal. Ein Lieferant hatte zu wenig Mehl gebracht. Dabei war es doch einem Christenmenschen verboten, zu fluchen.
Karl, der Zwölfjährige, war hässlich in seiner Verwöhntheit und machte ihr zeitweise das Leben schwer. Absichtlich patzte er Sauce auf den Boden, schmierte Honig in die Vorhänge. Oder er dachte sich andere ärgerliche Streiche aus. Dann fing die Arbeit von vorn an. Boden sauber machen. Vorhänge abnehmen und Flecken heraus waschen. Er wusste, dass ihn niemand zurechtweisen würde. „Dazu sind Dienstboten da.“ Doris hingegen, die Fünfjährige, hatte ein sonniges Wesen. Sie stahl sich, oft heimlich, in die Küche, um Cilli während des Kochens singen zu hören. Zudem durfte sie die süßen Teigreste ausschlecken, wenn ein Kuchen gebacken wurde.
Zeitig war Cilli auf den Beinen, auf dem Weg zur Kirche. Vorbei am Rathaus mit seinen dunkelroten und gelben Dachgiebeln. Die Uhr, hoch auf dem Zwiebelturm, schlug dreiviertel sechs. Durch die alte, gepflasterte Gasse eilte sie, ihr Gebetbuch in der Hand, an den idyllischen, niedrigen Häusern vorbei. Zur Morgenmesse in die große Pfarrkirche mit dem gotischen Turm, der in den Himmel ragte.
Fast wäre Cilli im Sitzen eingeschlafen, nachdem sie die Küche geputzt hatte. Wären da nicht die Bilder von früher. Die lieben, kleinen Hände ihrer Schwestern, die unermüdlich aus dem Zugfenster winken. Im Mai vor sechs Jahren. Marie mit den blonden, kunstvollen Stoppellocken und dem elfjährigen Engelsgesicht. Agnes, die sich gerne die Ärmel aufkrempelt und mit einem Ruck ihr welliges Haar zurückwirft.
Am Vortag beteten sie in der Abendandacht. Die vom Weihrauch erfüllte Dorfkirche sollten sie zum letzten Mal gemeinsam besuchen. Vor dem Schlafengehen packt Mutter das Binkerl. In ein rot kariertes Tischtuch schlingt sie die Winterjacken mit den großen Knöpfen, feste Schuhe, ein paar Habseligkeiten und verknotet die Enden. Agnes ist schon vierzehn, sie schultert es, ohne ein Wort zu verlieren. Am Morgen nehmen sie ein stärkendes Frühstück zu sich, Butterbrote und Malzkaffee. Den staubigen Weg zur Bahnstation gehen sie schweigend, im Stillen hoffend auf ein baldiges Wiedersehen.
„Onkel Toni und Tante Bärbel holen euch morgen am Bahnhof ab, in Berlin!“
„Baba, wir schreiben euch ganz bestimmt!“ Sie werfen sich noch Kusshände zu, als die Eisenbahn schnaufend aus der Station Höflein in Südmähren abfährt, nach und nach in der Ferne verschwindet.
Zwei Tage danach klopft der Postbote energisch ans Tor, bringt unverhofft ein Telegramm in die nach Apfelkuchen duftende Bauernstube. Mutter Katharina muss sich hinsetzen. Gruselig und voll der Rätsel die paar Worte: „Wo sind Agnes und Marie? Haben vergeblich gewartet. Anton und Barbara“ Sie bedankt sich beim Postbeamten, schenkt ihm einen Birnenschnaps ein. Ob er wohl gleich ihren Brief mitnehmen könne? An die Verwandten in Berlin, eilig das Wichtigste. Die Kinder wären doch auf dem Weg gewesen. Am Gemeindeamt spricht sie kurz darauf vor, legt ihr schwer gewichtiges Anliegen dar. Man werde sich darum kümmern, die Kinder aufzuspüren. Danach verläuft sich die Spur der kleinen Schwestern im Sande.