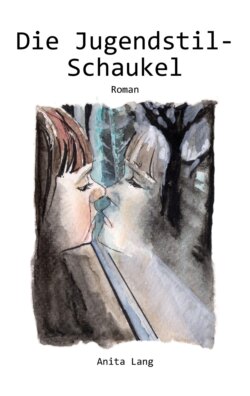Читать книгу Die Jugendstil-Schaukel - Anita Lang - Страница 3
Оглавление2. Kapitel
„Hätte ich doch schon eine Nachricht von der Schulleitung“, sinniert Rudi und reibt die Zähne aufeinander. Vor zwei Monaten hat er sich beworben, um die Stelle als Schulwart in der romantisch angehauchten Stadt. Dann wäre er sein eigener Herr, sozusagen. Er schüttelt seinen gewellten Haarschopf nach hinten. Jetzt muss er sich auf seine Arbeit konzentrieren. Der Maurergeselle wurde dringend in das Haus der Kriehubers beordert. Neben dem Küchenherd war der Verputz herunter gebröckelt. Vermutlich durch die Hitze des nahen Kamins. Rudi Lindermeier rührt den Mörtel an. Dann pocht er an die bedürftige Wand. Ein paar locker gewordene Teile rasseln auf den Küchenboden.
„Tun sie uns hier nicht zu viel Mist machen.“ Erna, die Hausdame, ist so eine mit Haaren auf den Zähnen. Doch die Jüngere, die mir die Tür aufgemacht hat, ohlala. War die hübsch, das Mädel. Angezogen ist sie wie eine Dienstmagd. Aber sie hat etwas Zartes an sich. Sicherlich würde sie niemals fluchen. Eine Brave mit herzförmigem Gesicht. Man kann die Adern auf ihrem Handrücken sehen, dann ist sie tüchtig. Ihr leise schmunzelnder Mund, entschlossene Lippen, aber sinnlich. Sie isst gerne, das wird’s sein. Für Schabernack ist sie wahrscheinlich nicht aufgelegt. Zu ernst, ihr Blick. Und sie riecht gut, nach Lavendelblüten und knusprigen Keksen. Was für ein Vergnügen wäre es, sie in meinen Armen zu halten und mit ihr zu tanzen.
„Cilli schlag jetzt den Schnee, für den Marmorkuchen.“
Jetzt kennt er ihren Namen. Das ist die Abkürzung von Cäcilia.
„Öha!“ Fast wäre ihm der Kübel mit dem Mörtel umgekippt. Cilli schaut verwundert auf. Der Geselle mit den blauen Augen und dem schneidigen Schnurrbart hat eine gefühlvolle Stimme. Sie muss rasch weitermachen. Nur zu gerne würde sie in seiner Nähe bleiben. Der Schneebesen klickert im raschen Takt. Rudi pfeift eine Melodie vor sich hin. Fröhlich tönt es herüber und versüßt ihr den Tag. Die graue, verputzte Wand muss trocknen. Sorgfältig verstaut der Handwerker mit den muskulösen Armen sein Werkzeug. Er fischt seinen schwarzen Regenschirm vom Garderobehaken. Draußen hat inzwischen der Schnürlregen aufgehört.
„Fräulein Cilli“, sagt er freundlich und sieht ihr entschlossen in die Augen. „Wollen sie sich nach der Arbeit mit mir treffen, in der Konditorei?“
Cilli hebt die Augenbrauen und schürzt die Lippen.
„Ja“, sagt sie zögerlich. „Ich muss erst um Erlaubnis fragen.“ Ihr Herz galoppiert dahin und klopft wie wild. Verflixt, ihr fällt nichts mehr ein, was sie sagen könnte.
„Na, dann könnt ich sie abholen, am Samstag um vier. Ja?“
Eine Haarsträhne fällt ihr in die Stirn, als sie nickt. Leicht und ungläubig, dass sie eine Verabredung hat.
„Pfüat Gott, Rudi Lindermeier.“ Über ihr Gesicht huscht ein warmherziges Lächeln und umfängt ihn wie ein träumerisches Netz. Die Lindenbäume blühen und verströmen Duftwölkchen über den weitläufigen Platz, als sie ihn zur Haustür hinaus begleitet.
Bei Erdbeerkuchen und Kaffee erzählt er ihr von seinen hochfliegenden Plänen. Das Warten auf die Antwort von der Schulleitung fällt ihm am schwersten. Ansonsten redet er nicht viel, der junge Mann mit dem brünetten, lockigen Haar. Findet Cilli, die gerne redet wie ein Wasserfall und bereits herausgefunden hat, dass er zwanzig ist und das Kartenspielen liebt.
Noch stundenlang könnte sie in diese interessanten blauen Augen sehen und Pläne schmieden. Rudi scheint es nicht aufzufallen, dass sich die vorbei kommenden Damenköpfe nach ihm umsehen. Sie hat die Ruhe weg, denkt er. Voller brauchbarer Gedanken, die Frau. Kurzweilig neigt sich ihr Rendezvous dem Ende zu.
„Was für ein schönes Paar sie doch abgeben.“ Mariechen kann es kaum erwarten, Agnes davon zu berichten. Von seiner Geschicklichkeit erzählt sie und wie sich die beiden ergänzen könnten. Zur gewohnten Zeit treffen sie sich auf dem verwitterten Schaukelbrett, das an langen Seilen unter dem knorrigen, alten Baum pendelt. Die Sonne hat sich schon nahe an die Gartenhütten gesenkt.
„Er hat sie geküsst, zum Abschied.“ Schaukelnde, strahlende Gesichter sehen sich an, unter der luftigen Baumkrone im Park. Die schwingenden Bewegungen lassen ihre aufgewühlten Gemüter langsam zur Ruhe kommen. Jäh kommt die Erinnerung zurück, mit der Dämmerung der Sommernacht.
„Manchmal sind Küsse gar nichts Nettes.“ Sie sehen auf ihre gleichzeitig vorgestreckten Fußspitzen, die unter den rauschenden Röcken hervorgucken, die sie auch damals trugen.
„Es wäre anders gekommen, hätten wir uns von denen nicht bequatschen lassen.“ Agnes hadert noch immer mit ihrer Entscheidung, die sie an diesem schicksalhaften Tag aussteigen ließ, aus dem schützenden Zugabteil.
„In einen fremden Menschen kann man halt nicht hinein schauen.“ Mariechen ist in Gedanken dabei, wie ihr zweifelhaftes Abenteuer begann. Noch nie zuvor hatten sie eine Eisenbahn betreten. „Genoveva“ hat sie auf ihren Schoß gesetzt. Die gestrickte Puppe mit dem gestreiften Hut und dem kecken Schal hat Cilli für sie angefertigt, im letzten Winter. Das schnaufende Anfahren des Dampfrosses versetzte sie in freudige Erregung. Die vorbeiziehenden Felder vor dem Waggonfenster, die sprießenden Halme. Die laue Brise des Frühlings über den Äckern und Wäldern. Heitere Reihen der ziegelroten Dächer über niedrigen, behaglichen Häusern. Ihre ältere Schwester saß ihr gegenüber. Gespannt, wie ein Haftelmacher, was sie wohl erleben würden.
Fast könnte Cilli alles vergessen, über den arbeitsreichen Tagen. Das liebenswürdige sich Kennenlernen, die Hochzeit im unschuldigen, weißen Brokatkleid. Wie sie vor dem Pfarrer stehen und sich das treue Jawort versprechen. Der stolze Blicke hinter der Schleierspitze, auf ihren gut aussehenden Mann, stark und feierlich, im schwarzen Hochzeitsanzug an ihrer Seite. Es ist ihr, als ob es gestern gewesen wäre. Während ihre klammen Erinnerungen an die entrechtete Dienstmagd, die sie einmal war, verblassen.
Sie sind ein Paar geworden, das durch alle Wirrnisse des Alltags schifft. Noch nie hat sie eine Zusammenarbeit wie diese erfahren. Ein großer Gebäudekomplex hat sie und Rudolf in seine Obhut genommen. Vertrauenserweckende, hohe Räume hinter dicken Mauern und weitläufige Gänge. Am Morgen voll tönender, kindlicher und jugendlicher Stimmen, die dann für eine jeweils knappe Stunde verstummen, in ihren Schulbänken hinter Klassentüren hockend. Ein eigener Rhythmus, in dem sie in den Pausen herausspringen, kurz entlassen aus der Pflicht. Bis das Läuten sie wieder zurückholt und bändigt.
Die rechte Hälfte des Trakts, aus der Sicht eines Vogels gesehen, wenn er vom Kirchenturm losfliegt, beherbergt die Hauptschule. Ein großer Torbogen führt in den Innenhof, ihren Wirtschaftshof. Zwei wohl genährte Ziegen meckern in ihrem kleinen Stall. Sieben Hasen, zehn Hühner, drei Gänse gehören zu ihrem Haushalt. Im kleinen Gemüsegarten neben der Mauer geht die Saat auf, im Geruch von Dille, Knoblauch und Salatköpfen. Zwei riesige Apfelbäume, ein Kirschenbaum, ein Marillenbaum stehen ihnen mit all ihren Schatten spendenden und Frucht bringenden Vorzügen zur Verfügung. Bei der Ernte und Verarbeitung arbeiten sie einander zu. Wie die Rädchen eines gut ausgeklügelten Uhrwerks greifen ihre Taten in einander, bis alles erledigt ist. Auf der linken Seite, aus dem Blick einer Taube, sind unter dem ziegelroten Dach, ihre Dienstwohnung, dann die Unterrichtszimmer der Volksschule angelegt. Am Ende des Ganges, der große, nach Lederbezügen und angestrengtem Schweiß riechende Turnsaal.
Cillis erster eigener Herd, mit einer Wanne für Warmwasser und einem Backrohr. Sie kann ihr Glück kaum fassen. In ihrem Vorratsschrank sind Schmalztopf, Eier, Mehl und Zucker gestapelt. Apfelstrudel zubereiten will gelernt sein. Ganz dünn müssen die Teigblätter gezogen werden, über ein sauberes Leintuch. Trotzdem darf kein Riss entstehen. Dann kommt die Fülle mit fein geschnittenen Äpfeln, Bröseln und Zimt. Rudi sitzt am Tisch und entwirft einen neuen Plan zur Grundreinigung der Schule. Der würzige Strudel-Duft verheißt ein wohl schmeckendes Mittagessen.
„Was wären wir für lustige Tanten geworden, für Franzi.“ Mariechens Lachen hat etwas von einer leichten Melodie.
„Manchmal würde ich schon noch gerne mitmischen, unter den Lebenden“, maunzt Agnes.
„Eigentlich müssten wir froh sein, wenn sie überhaupt noch an uns denken.“
„Wieso nicht, wir denken ja auch an sie“, meint Agnes. „Ich freue mich so mit Cilli.“
Ihr kleiner Sohn hat in der Wohnung zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt. Schon bald wird er die schulischen Gänge unsicher machen.
„In was für eine krumme Welt wir doch damals geraten sind“, seufzt Agnes.
Als sie das Ehepaar Lazne vom Zugfenster aus einsteigen sieht, verspürt sie plötzlich eine ungewohnte Scheu. Der große Mann mit der gelben Stoppelglatze nimmt die freien Plätze neben ihnen ins Visier und stellt sich als „Karol Lazne“ vor. Agnes fragt sich, warum sie mit ihm partout nicht reden will. Vielleicht sind es seine komischen, großen Ohren oder die unpassende Stupsnase in seinem derben Gesicht. Seine Frau ist jung und dicklich.
„Grüß Gott, ich bin Jana“, sagt sie einschmeichelnd zu Marie. Sie hat schwarzes, gelocktes Haar, das in einem frommen Knoten gebändigt ist.
„Ich heiße Marie und meine Schwester Agnes“, sagt Mariechen bereitwillig.
Das ist eine Herrschernatur, schießt es Agnes durch den Kopf. Ach was, wir sind hier in der Bahn und viele Menschen um uns herum. Ob sie ihren Karol unter der Knute hat, kann uns wurscht sein. Aber wieso reden die uns dauernd an? Es müssen biedere Leute sein, die uns über den Dorfpfarrer ausfragen. Auch waren sie schon einmal in unserer Gegend.
„Wir fahren zu unserer Verwandtschaft nach Berlin.“ Mariechen, in ihrer Gutherzigkeit, wittert nichts Arges darin, es zu erzählen.
„Da müsst ihr in Prag umsteigen“, erklärt Jana. „Der Fahrplan wurde geändert.“
„Aber uns wurde gesagt, wir dürfen nicht aussteigen.“ Agnes ist sich sicher, dass Mutter Katharina das Richtige gesagt hat. Sie hat ihnen eingeschärft, auf niemanden zu hören. Agnes redet den Schaffner an, ob es stimmen würde. Mit gestreckten Zeigefingern neben seinen Ohren deutet er, dass er kein Deutsch verstehe.
Der einfältig anmutende Karol wirft seiner Frau einen flüchtigen Blick zu. Das wäre egal, wenn sie glaubten, sie wüssten es besser.
„Sie werden schon sehen, die zwei. Aber dann ist es zu spät.“
Agnes und Mariechen sehen sich ratlos in die Gesichter. Mariechen sagt, sie meinten es gut, die Laznes. In den Stationen steigen fremde Leute mit ihrem Gepäck aus. Andere steigen zu, mit Koffern und Taschen. So viele sind unterwegs nach Norden, mit der Eisenbahn. Gut gelaunt plaudern sie untereinander. Manche schauen grimmig weg. Wenn sie nicht gestört werden wollen. Jana neben ihnen streckt Marie ein Keks entgegen.
„Kleine Marie, für Dich.“
„Danke sehr“, freut sie sich. Lautstark ruft der Eisenbahner „Praha, Prag“ durch die Gänge. Dann etwas auf Tschechisch.
„Was ist, wenn sie Recht haben? Sollen wir umsteigen?“ Agnes ist geneigt, den Laznes zu glauben.
„Sie sind nett“, sagt Marie und lächelt. Ad hoc entschließen sie sich, ihr Bündel zu nehmen. Sie trotten hinter Karol und Jana her, im fahrenden Zug zum Ausstieg.
„Cillis Mann trägt die Uniform des Kaisers.“ Mariechen hat ihn gesehen, bei der Musterung in der Warteschlange. Im August 1914 gäbe es Krieg in Europa. „Cilli sorgt sich, ob ihr Rudi wohlbehalten zurückkehren wird.“
„Die Ärmste, sie wird mit der ganzen Arbeit übrig bleiben.“ Die Schwerarbeit im Winter, Kohlen schleppen, treppauf und treppab, um die hohen Schulräume zu heizen. Das Putzen der Klassenräume, Gänge und Treppen. Die beiden Schwestern konnten Cillis Sohn sehen, als er seine ersten, wackeligen Schritte im Gang machte. Franzi ist ein Jahr alt geworden. Tapsig machte er sich auf den weiten Weg, vorbei an der Bassena, zum Turnsaal. Der Vierkanthof ist riesengroß, mit gelb gestrichener Fassade. Im Innenhof halten sie gackernde Hühner und flauschige Hasen in Ställen. Von den Ziegen bekommen sie täglich Milch. Schlicht ist ihre Dienstwohnung, aber gemütlich. Im Schlafzimmer geben zwei hohe Fenster den Blick in den Vorgarten frei. Der Flieder mit seinem üppigen Blattgrün ist für heuer verblüht. Rote, weiße und rosafarbene Rosenbüsche stehen am Zaun, in Reih und Glied. Das Ehebett mit seiner blitzblauen Überwurfdecke glänzt, umrandet von Messing. In drei zweitürigen, furnierten Kästen sind fein säuerlich Kleider und Wäsche verstaut, wie es sich für eine bürgerliche Familie gehört. Neben der Küchentür erfüllt ein weißer, eintüriger Spind seinen Zweck. Dann ist da noch ein Schubleerkasten, mit breiten, tiefen Laden und gedrechselten Knöpfen. Darüber ein größerer Spiegel. Weiter hinten gereiht, das Kabinett, brauchbar als Kinder- und Spielzimmer. Neben dem Küchenherd steht ein bequemer Lehnsessel aus altrosafarbenem Samt bereit, den zumeist der Hausherr benützt.
„Morgen versuchen wir, in ihrer Nähe ein Lied zu singen“, schlägt Mariechen vor. „Vielleicht können sie es fühlen.“
An diesem sonnigen Nachmittag geht Cilli in den Hof. Angenehm kühl ist der Schatten. Die Hühnerschar pickt Maiskörner auf. Flink packt sie die Henne mit dem braunen Gefieder von hinten und klemmt sie unter ihren rechten Arm. Da strampelt sie jetzt, erbarmungslos eingeklemmt. Ob sie wohl weiß, was ihr blüht, über ihrem hilflosen Gegacker? Cilli drückt sie gekonnt auf dem Hackstock nieder und hält ihre Flügel fest. Dann, mit einem Ruck, dreht sie ihr den Kragen um. Rasch soll es gehen, das Tier darf nicht leiden. Ihr Glaube lehrt, dass der Mensch mit seiner unsterblichen Seele über dem Tier stünde. Sie darf das Huhn schlachten, ohne sich deswegen schlecht zu fühlen. Im Hof setzt sie sich auf einen Schemel und rupft die Federn sorgfältig vom Fleisch. Vor ihr ein weiß emailliertes Lavoir, das sich mit weichen Daunen und Gefieder füllt. Das beste Material kann für Polster verwendet werden. Die gröberen Stifte müssen fein heraus gezupft werden. Dann, in der Küche, wird es aufgeschlitzt und vorsichtig von den Eingeweiden befreit. Die Galle darf auf keinen Fall platzen, sonst ist das Fleisch verdorben. Der Kopf und die Füße kommen in die Suppe. Der Hühnerbauch wird mit Semmelbrei, gehackter Petersilie, einem Ei und Muskatnuss gefüllt und zugenäht. Salz, auf jeden Fall, kommt auf den Braten, bevor er ins Backrohr geschoben wird. Mit Schmalz bestrichen und übergossen, eine sorgsam überwachte Prozedur. Der Duft zieht unwiderstehlich durch die Zimmer und Gänge. Morgen müssen sie sich trennen. Rudi muss einrücken, zum Regiment. Noch einmal soll er verwöhnt werden, mit einem köstlichen Brathuhn. Franzi quietscht vergnügt und belustigt, auf dem wippenden Knie seines Vaters.
Cilli hat ihre Arme um den Hals ihres Mannes geschlungen. Sie legt ihren Kopf an seine Brust, traurig und gefasst.
„Hoffen wir das Beste“, sagt sie. „Unser Herrgott möge dich schützen.“
„Wir werden uns gewiss wiedersehen“, sagt Rudi. „Am besten, wir machen es kurz, sonst fängt am Ende noch einer an, zu weinen.“
„Weißt du noch, das Volkslied über die weißen Dragoner?“ Cilli fällt unverhofft die Melodie dazu ein. Mit ihren Schwestern hat sie es oft gesungen.
„Es ist wie ein Ohrwurm.“ Sie weiß, er wird zurückkommen. „Bis bald, mein Lieber.“
„Warte“, ruft Cilli ihm nach, als er durch die wuchtige Schwingtür hinaus stapft. Sie nimmt die Photographie, die sie als stolzes Paar, mit Franzi im Vordergrund, zeigt aus dem Rahmen und drückt sie ihm in die Hand. „Dann hast Du uns immer bei dir.“
Ein Jahr später ist er noch immer fern der Heimat. Das Infanterieregiment hat ihn zum Truppenfahrer ausgebildet. Der schwarze Armeewagen mit dem stabilen Dach steht großteils seinem Hauptmann zur Verfügung. Wie zwei wache, runde Glupschaugen, die blank geputzten Scheinwerfer. In die österreichische Festung Przemysl an der Ostfront, in Polen, wurde er zuerst abkommandiert. Im März 1915 konnte ihre Truppe noch abrücken, bevor sie von den Russen erobert wurde. Die anderen Kameraden gerieten in Gefangenschaft, wie man hörte. Als Truppenfahrer bekommt man so einiges mit, an Nachrichten. Wenn sich die Obrigkeit unterhält und zeitnah ihre Neuigkeiten austauscht, um sich die Fahrzeit kurzweiliger zu gestalten. Manchmal lassen sie sogar eine Zeitung zurück im Wagen. Im Juni hat unsere Armee die Festung wieder zurück erobert, wie in der Wiener Allgemeinen zu lesen war. 60 Offiziere und über 12.000 Mann gefangen genommen, 14 Geschütze und 35 Maschinengewehre erbeutet. Wie lange es wohl dauert kann, so viele Gefangene abzuführen?
„Gefreiter Lindermeier meldet sich zum Dienst.“ Er salutiert vor Hauptmann Haller auf und steigt zackig auf der Fahrerseite ein. Die hechtgraue Bluse mit Umlegekragen und Kniehose sitzen tadellos. Schmucke, mattierte Knöpfe prangen, auch auf seiner Kappe. Ihr Einsatzbefehl führt sie südlich vor Krakau, an diesem frühen Vormittag im August. Der Zustand der Straßen schadet den Reifen und Achsen. Es gilt, den tiefen Schlaglöchern geschickt auszuweichen. Hauptmann Haller wird dringend zu einer Stabsbesprechung an der Front erwartet. Breitbeinig hat er auf dem Rücksitz Platz genommen. Er ist ein drahtiger Mann, findet Rudi. Einer, der sich ausschließlich für das Wesentliche interessiert. Manchmal fühlt er sich von ihm ausgefragt. Was er in seinem zivilen Leben mache, will er wissen.
„Meine Ehefrau und mein kleiner Bub sind in der Stadt Laa“, berichtet Rudi. „Ich bin Schulwart, für ein großes Schulgebäude zuständig.“
„Na, da müssen sie sich hier längst nicht so viel ärgern, wie mit den Fratzen daheim.“ Hallers joviale Anwandlung lässt einen hie und da staunend zurück.
Von weitem hören sie Granaten und die vernichtenden Geschosse von Haubitzen einschlagen. Sie sind näher an der Front, als vermutet. Auf einmal blitzt es auf, am Horizont. Ein Feuerball entlädt sich schwallartig in der Luft.
„Anhalten, Lindermeier“, schreit Haller und gibt Anweisungen, den Wagen sofort am Straßenrand abzustellen. „Das muss die Artillerie des Russen sein.“ Dann gehen sie eilig in Deckung, hinter der Böschung, bei einem Kilometerstein. Felltornister und Patronentaschen haben sie in der aufkommenden Hektik im Wagen zurück gelassen.
Ein ohrenbetäubendes Pfeifen kündigt den nahen Einschlag an. Zu rasch, als dass sie hätten wegrennen können. Die Wucht der Granate hebt die Soldaten vom Boden. In die Staubwolke, die hochwirbelt und sie zu ersticken droht. Rudi fühlt ein dumpfes Beben, als würden seine Innereien durcheinander gewürfelt. Der Schall der Detonation, mit seiner enormen Kraft, lässt ihn taub zurück. Neben dem aufgewühlten Krater im Ackerboden liegt sein Hauptmann, leblos. Es ist noch alles dran, Arme und Beine. Er robbt vorwärts und dreht ihn auf den Rücken. In seinem schmutzverschmierten Gesicht ist keine Regung zu erkennen. Mit Daumen und zwei Fingern fühlte er seinen Puls. Hurra, noch lebt er. Dann fasst er ihn unter den Schultern und zieht ihn aus dem Graben. Wie schwer doch so ein Mensch ist, wenn er nicht mithelfen kann. Am nahen Waldrand ziehen zwei braune Ackerpferde ein Geschütz durch das unwegige Gelände. Eine Handvoll österreichischer Infanteristen bringen es in Stellung. Von den feindlichen Angreifern ist nichts zu sehen. Vermutlich sind sie geschickt getarnt. Der Wagen von einer Staubschicht bedeckt, hat keine Dellen abbekommen. Entschlossen hievt er Haller auf den Rücksitz. Er nimmt sich vor, den Verletzten in Sicherheit zu bringen. Der Hauptmann hätte das sicher ebenso gewollt, wenn er sich noch rühren würde. Jetzt muss nur noch das Automobil anspringen.
„Mach schon“, sagt er, enttäuscht vom Gestotter der Karre. Dann kämpft sich der Motor frei und heult auf. Rudi wendet den Wagen, als ob der Teufel hinter ihm her wäre.
„Hauptmann, das packen wir schon“, redet er auf den Bewusstlosen ein. Langsam findet sich sein Hörvermögen wieder ein und lässt ihn aufatmen. „Das wäre doch gelacht, wenn wir da nimmer raus kämen.“ In der Früh hat er sich die Karte eingeprägt, sicherheitshalber. Vier Kilometer soll ein Feldlager stationiert sein, wenn es denn stimmt. Stündlich wird umdisponiert, im Kriegszustand. Da tauchen weiße Zeltplanen auf, am Horizont.
„Gerade rechtzeitig“, beruhigt ihn der Sanitäter und lacht übers ganze Gesicht. Haller schnappt nach Luft unter der Sauerstoffmaske. „Er wird es überstehen, glaub ich.“ Zu seinem Erstaunen, ist Rudi unverletzt. Rastlos klopft er sich den Staub aus den Kleidern. Die Augenlider werden ihm schwer, als er sich in seine Unterkunft schleppt. Am liebsten würde er seiner Cilli alles brühwarm erzählen. Morgen, gleich beim Frühstück, wird er ihr einen Brief schreiben.
„Was für ein Glück, er ist dem Einschlag entkommen“, meint Agnes erleichtert.
„Das Schicksal ist schon ein rätselhaftes Wesen“, sagt Mariechen. Unaufhörlich drängen sich die Erinnerungen an die Oberfläche, für die beiden kindlichen Schwestern im Park der Dichter. Neben dem Stationsschild „Praha“ steht Karol Lazne. Auf dem Schottersteig, im Stimmengewirr und Tumult der Reisenden. Starr, wie ein Möbelstück, unüberwindbar. Sie haben keine Koffer mit, keiner der Laznes, fällt Agnes plötzlich auf. Dann geht alles in Windeseile. Jana packt sie mit eisernem Griff an der Hand und zerrt sie weiter. Eine Geierhand, mit überlangen Fingernägeln. Ihre Gesichtszüge, in zornigen Falten entgleist, zeigen Entschlossenheit. Mit Mariechen haben sie leichtes Spiel, ihre Füße sind fast in der Luft, als Karol sie weiterzieht.
„Loslassen“, schreit Agnes. Sie sieht hilfesuchend in die Menschenmenge um sich, ruft ihnen zu: „Sie wollen uns mitnehmen!“ Mariechen kreischt auf und weint laut drauflos.
Das Ehepaar redet in beschwichtigendem Tonfall zu den Leuten. Dann lachen die Reisenden auf und gehen ihrer Wege.
„Die werden glauben, wir sind ihre Kinder.“ Agnes fühlt ein beklemmendes Drücken auf ihrer Brust. Als schnüre ihr jemand die Kehle zu.
„Keiner wird euch glauben“, sagt Karol streng. „Wir die einzigen, die deutsch kennen.“
Dann wird Mariechen in ein Pferdefuhrwerk gestoßen. Das ist ein abgekartetes Spiel, überlegt Agnes. Das einspännige Fuhrwerk, ein wartender Kutscher, vor dem grauen Bahnhofsgebäude. Wild schießen ihre Augen hin und her, als sie sie in den schmalen Eingang, in die dunkle Kabine des Wagens, ziehen. Die gespenstige, zornfaltige Hexe und ihr Gespons, mit spöttischer Wut im Gesicht. Ein Pferdefuhrwerk mit schwarzen Vorhängen. Mit einem Ruck werden sie zugezogen. Sie haben uns überrumpelt, uns stimmlose Kinder.
Eine grün-giftige Flüssigkeit soll sie trinken. Zwischen den fremdländischen Worten hört sie „Absinth“. Davon hat sie schon einmal gehört. Das ist so etwas wie ein Schnaps.
Mariechen hat sich gefügt. Totenblass sitzt sie auf der Bank, krallt sich an Genoveva fest. Als ob ihre niedliche Strickpuppe helfen könnte. Ihre Lage ist aussichtslos, ein müheloses, böses Spiel.
„Mariechen, die geben uns Alkohol.“ Was werden die mit uns vorhaben? Wozu das alles?
„Halts Maul“, schreit Karol und schlägt ihr ins Gesicht. Dann zeigt der benebelnde Flaschengeist seine stetige Wirkung.
Jana stützt Agnes schlaffen Körper ab und lehnt sie gegen das Verdeck. Als wäre sie eine Theaterpuppe. Über die holprigen Pflasterstraßen werden sie eine Weile zu fahren haben. Die Kleinere ist ausgeknockt, liegt mit dem strohblonden Haarbündel auf Karols Schoß. Wie eine alberne Perücke. Ebenso lächerlich, wie Karols Figur, die sie schon seit jeher widerlich findet. Diese weibische Rundlichkeit von Schultern eines Riesenkleinkinds. Das süchtig ist, nach Sahnetörtchen zu jeder Tageszeit. Aber er ist brauchbar, meistens, wenn man ihm gehörig in den Hintern tritt. Imponieren können ihr nur welche, die schlauer sind. Aber Karol? So ein Narr, bald hätte er es vermasselt. Er hätte hinter den Gören bleiben sollen, beim Aussteigen. Zur Absicherung, falls sie es sich noch anders überlegen sollten. Dabei sind sie wie Federvieh abgeführt worden, die zwei Gänse. Sie glauben, sie kommen in den Himmel, wenn sie Mutter und Vater gehorchen, ohne Widerrede. Nach der ersten Frechheit, die eine Ohrfeige nach sich zieht, wissen sie es. Kein Zurückreden bei Erwachsenen, den Mund halten und Sauberkeit. Gemäß dem heiligen Gebot, schulden sie den Älteren Gehorsam und Ehrerbietung. Und jetzt sind wir so etwas wie ihre Familie. Mir steht das genauso zu. Der Respekt, das Folgen aufs Wort.
„Karol, sind dir die Cremetörtchen ins Gehirn gestiegen“, fährt sie ihn an. „Schau, dass sie nicht aufwachen, bevor wir im ‚Sladky Andel‘ sind.“