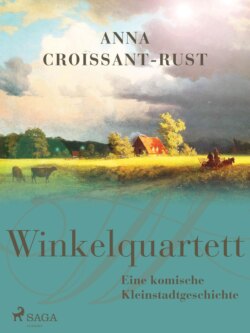Читать книгу Winkelquartett - Anna Croissant-Rust - Страница 3
ОглавлениеWer heutzutage in die alte Stadt kommt, von der ich reden will, und vor das schöne gotische Rathaus unter den mächtigen Linden, wird vergebens nach den Gewölben ausschauen, die in dieser Geschichte immerhin eine gewisse Rolle spielen. Eine Rolle, weil in einem dieser Gewölbe der Held Kampelmacherfritzl das Licht der Welt erblickt hat, eigentlich fast gegen den Willen und die Absicht der Mutter, und dann weil er einen Teil seiner Jugend dort verlebt, im zweiten weiteren Gewölbe seine Lehrzeit durchgemacht und im dritten seine Tätigkeit als Meister ausgeübt hat.
Auch das schmale engbrüstige Haus, in dem die Mahn-Rosine geboren und erzogen worden ist und in dem ihr Vater das ehrsame und nährende Gewerbe eines Tändlers und heimlichen Ferkelstechers betrieb, wird wohl nicht mehr in der Girgengass stehen, die jetzt als Georgenstrasse die „Avenue“ der Stadt geworden ist und vom Marktplatz an mit stattlichen Zinskästen prangt.
Nur das einstöckige Haus mit seinem späteren Aufbau, windschief nun und förmlich in sich zusammengesunken, wird man finden können, das Vater- oder besser das Mutterhaus des hinkenden Maxl, das heute noch in der Paradeisgasse stehen muss.
Es ist richtiger zu sagen das Mutterhaus, denn dem eigentlichen Vater des hinkenden Maxl war gewiss die berüchtigte Paradeisgass, in der nur kleines und kleinstes Volk lebte und die ihren Namen wie zum Hohn trug, kaum bekannt, bis zu dem Augenblick, wo er den hinkenden Maxl, seinen leiblichen Sohn, in einer besonderen Mission aufsuchte.
Wenn dieser Vater, der Baron, einmal zur Stadt kam, so geschah das im eleganten Landauer, und sein Wagen mit dem Wappen hielt gewöhnlich nur vor der Behausung anderer Adeliger, vor der der „Spitzen der Behörden“ oder vor dem Kasino des kleinen Städtchens, wo der einzige Kellner Hans, der Stolz und das Kleinod des Traiteurs, in fieberhafte Aufregung geriet, sobald er nur einen Schein der sandfarbenen Livree des Kutschers des Barons von Lohberg erblickte; denn es gehörte wahrhaftiger Gott mehr dazu wie nur Servietten schwenken, um diesen verwöhnten Krautjunker zu befriedigen!
Gewiss war der Baron nie in die Paradeisgasse gekommen, bis zu der Stunde, da er den hinkenden Maxl im vollen Sinne des Wortes in Augenschein nahm, was in der besagten Gasse eine ungeheure Aufregung verursachte und auch für diese Geschichte nicht ohne Folgen bleiben wird.
Die Paradeisgässer waren als sehr neugierig, schlagfertig und spottsüchtig verschrien, und nicht umsonst ging der Vers:
„Wer durch die Langgass geht ohne Kind,
Hinter Sankt Martin ohne Wind,
Durch die Paradeisgass ohne Spott,
Der hat a Gnad von Gott!“
Davon, d. h. vom Spott, konnte der hinkende Maxl mit seinem langen und traurigen Pferdskopf ein Liedlein singen! Doch nicht von ihm soll jetzt erzählt werden, obwohl er vielleicht durch den baronlichen Vater mit dem schönen Coupé schon einiges Interesse erweckt hat. Der hinkende Maxl kann warten; er ist ja das Zurückstehen von Profession gewohnt, er ist geboren zurückzustehen.
Eigentlich hätte jetzt wohl die holde Weiblichkeit des Kleeblattes zu erscheinen, vor allem die Mahn Rosine; doch da die schönen alten Gewölbe schon den Anfang machten, soll die Rosine mit dem schwarzen Haar und einigen markanten Abzeichen ihrer Raffe in der Mitte liegen bleiben und der Kampelmacherfritzl zuerst aufmarschieren, der sowieso in seinem ganzen Leben nichts hat erwarten können, was er schon bei seiner Geburt bewies, denn er kam ganze acht Wochen zu früh, war also ein Siebenmonatskind.
Damals war er freilich nicht der Kampelmacherfritzl, sondern der uneheliche Sohn der Genoveva Glocke, Obstlerin, die bei seiner Geburt schon ziemlich in den Jahren war, weshalb sie warmherzige und liebenswürdige Leute von da ab Mutter Glocke oder schlichtweg Glockin nannten.
Dass das Folgende gleich von zwei ausserehelich geborenen Subjekten zu handeln haben wird (siehe den hinkenden Maxl!), ist gewiss sehr fatal, aber erstens ist an den Tatsachen nichts mehr zu ändern und zweitens wird hoffentlich durch die Mahn-Rosine, die so ehelich geboren ist wie nur irgendeiner, alles wieder gutgemacht. Auch gereicht es sicher zur allgemeinen Genugtuung dass sich der Fritzl zwar nicht infolge seiner illegitimen Geburt, doch wohl infolge seiner schlimmen Anlagen durchaus nicht als tadelloser Bürger, als kein einwandfreies Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft auswuchs, und nicht die gewünschten friedlichen und staatserhaltenden Eigenschaften aufwies, die von ihm hätten gefordert werden können, so dass mit vollem Rechte sehr bald und auch später in der Nachbarschaft eine gewisse grimmige Befriedigung über ihn herrschte, ganz in Uebereinstimmung mit der guten, d. h. besseren Bevölkerung des Städtchens, die von Uranfang an prophetisch gesagt hatte: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme.“
Vorderhand oder bis jetzt ist aber der kleine, sehr kleine Fritzl erst andeutungsweise geboren, und noch immer ist wohl die Mutter Genoveva Glocke, leider keine „Geborene“, erwähnt, aber kein Wort vom Vater gesagt. „Ja eben, ja eben“, oder, wie Genoveva Glocke sagte, „ja ehm, ja ehm“, da stak der Haken. Ein Wunder war es, ein „völliges“ Wunder, dass der Fritzl nicht auf öffentlichem Marktplatz unter den Lindenbäumen zur Welt kam, oder wem es widerstrebt, das Wunder zu nennen, ein reiner Zufall.
Der dicken Obstlerin Genoveva Glocke (noch Vevi, nicht Mutter Glocke genannt) war die Geschichte nach zwanzigjähriger Pause, während der sie vor sich selber und vor den anderen quasi wieder zur Jungfrau geworden war, eine heillose Ueberraschung. Sie konnte und konnte nicht daran glauben.
Grübelnd und kopfschüttelnd sass sie Tag für Tag unter dem doppelten Schutz ihres grossen grauen Leinenschirmes und des mächtigen Daches der Linden, war ein bisschen konfus und schämte sich ein bisschen. Als sie zweiundzwanzig alt war, frisch und blühend, hatte sie sich freilich noch mehr geschämt, obwohl sie den Vater des kleinen Mädchens genau anzugeben wusste, was diesmal ganz und gar nicht der Fall war. Jetzt war sie zweiundvierzig, dick, verfettet, mit Säcken unter den Augen und einem fast unheimlichen Umfang. Kein Mensch dachte daran oder sah ihr an, dass sie bald dem kleinen Erzspitzbuben, dem späteren Kampelmacherfritzl, das Leben geben sollte.
Sie selbst wollte die Affäre auch vor sich nicht wahr haben, darum blieb sie fest auf ihrem Hökerinnenstuhl sitzen bis zur letzten Minute. Ein Glück, dass das Gewölbe, Salon, Wohn- und Schlafgemach der Dame Glocke sowie Obstvorratskammer, in der allernächsten Nähe war, sie hätte sonst keinen sicheren Port mehr erreicht, kaum dass sie noch die paar Stufen hinunterkam.
Dies Geschrei und Gelächter unter den anderen Hökerweibern! Dies Raten und Disputieren, diese Garde vor dem Gewölbe, als die Hebamme angerückt kam! Und erst als der Vater sollte ins Taufregister eingetragen werden! Die Vevi Glocke heulte drinnen. Wenn sie sich doch die ganze Zeit schon besonnen hätte, wenn das doch ihr grösster Kummer war! Was lag ihr an dem armseligen Kinde! Am Vater lag ihr und auf den konnte sie nicht kommen! Es verwirrte sie erst recht, dass man beständig in sie drang: „Ja, einen Vater muss er doch haben?!“
Gewiss, recht, aber welchen?
„Es mag sein, es ist der Henne-Musi oder der lange Packträger am Markt vorne, den Namen woass i net, oder an anderer, oder der Nachbar Kampelmacher, na, der is et net, i mag niemanden unrecht verdächtigen, schreibt’s halt niemanden ein und wart’s, bis er grössser werd, wem er gleich siecht.“
„Bis jetzt siecht er überhaupt net amal an Kind gleich“, spöttelte Madame Hühnlein, die Amme, der es gar nicht passte, den winzig kleinen roten Wurm zur Schau zu tragen. Mit dem kriegte man ja überall das Gespött! Nicht einmal den dritten Teil des Taufkissens füllte er aus, und ihre sämtlichen Taufhäubchen fielen ihm bis zur Nase über das verrunzelte Faltengesicht, das vorderhand noch wie das eines greinenden boshaften Aeffleins aus den Kissen sah.
Den Paten machte, nachdem der lange Packträger, den die Amme perfiderweise zitieren wollte, ausgerissen war, irgendeiner, den sie im Vorbeigehen aufgabelte. So kam der Fritzl sogar um ein Patengeschenk, was ihn in späteren Jahren noch giftete und weswegen er die Madame Hähnlein, die ihm zum Eintritt in die Welt verholfen hatte, nicht leiden konnte.
Mutter Glocke war es vorderhand nur darum zu tun, ihren Beruf, der unterhaltlich, beschaulich, wenn auch nicht aufregend einträglich war, sobald als möglich wieder ausüben zu können.
Am fünften Tage nach der schleunigen Geburt Fritzls sass sie schon wieder, genau anzusehen wie vorher auch, unter dem grauen Schirm, und über ihr tanzten die Sonnenflecken, wenn der Wind die breitästigen Linden oben bewegte.
Es war sommerlich warm und erschien ihr angenehm, so mitten auf dem Marktplatz, mitten im Leben der kleinen Stadt, zu sitzen, ein wenig scheu zwar, aber mit dem Gefühl, etwas interessanter geworden zu sein.
Später aber, als die Bäume anfingen, die Blätter herabzusäen, als sich manchmal ein gemessener Tanz bunten Herbstlaubes, von der Allee hereingewirbelt, um ihren Stand erhob und die Leute laut schimpften, dass die kleine, armselige, alleingelassene Kreatur im Gewölbe schrie, dass ihre Lunge fast zerplatzte, fand Mutter Glocke, dass das Wandeln zwischen Stand und Gewölbe für ihre stets zunehmende Körperfülle zu beschwerlich sei. Sie fasste den Entschluss, einen Strich unter die Idylle ihres Hökerinnendaseins zu machen und — als Zeichen der endgültig entschwundenen Jugend — von nun an in Züchten und Ehren ihre Aepfel und Birnen, ihre Zitronen und Hutzeln, ihr Johannis- und Kletzenbrot, die ersten und letzten Kirschen und „Zweschben“ vor ihrem Heim, dem Gewölbe, auszubreiten
Da konnte sie — und sie fand ihr Tun bald sehr löblich —, wenn draussen der Wind rumorte oder gar schon Schnee fiel, unangefochten von Kälte und Sturm im Gewölbe sitzen, das sie sonst nur zur ganz strengen Winterzeit bezogen hatte.
Ganz so „unterhaltlich“ wie auf dem Marktplatz war’s nicht, aber doch recht vergnüglich, durch die Glastür zu erspähen, wer da vorbeiging oder sich drüben in der Löwenapotheke oder in dem grossen „Spezlereiladen“ etwas holte. Als Missstand empfand sie freilich, dass sie mit anhören musste, wie bunt es der kleine Balg nebenan trieb.
Eine Lunge hatte der Zwerg! Die stand in gar keinem Verhältnis zu dem Brüstchen und Körperchen, das man immer erst in den Bettstücken suchen musste. Zwei Stufen höher als das tiefgelegene Gewölbe lag nämlich das „Kabinettl“, Schlafgemach der Dame Vevi, vor kurzem Ort „des accouchements“, jetzt Kinderzimmer, dabei Küche, Garderobe und im grimmen Winter auch Empfangszimmer für etwaige Besuche. Es hatte die Länge des Gewölbes, war aber so schmal, dass Mama Vevi nur mit Mühe die gewichtigen Teile ihres Körpers zwischen Bett und Kommode durchzuzwängen vermochte.
Nun stand ausser der alten Kommode, dem alten Schrank, einem alten Holzkoffer und anderem Gerümpel noch der Korb mit dem neuen Jungen darin, und Mutter Glocke begab sich nicht gern unnötig in die Enge und Wirrnis des Kabinettls. Die Mauern waren dick und die Türe hielt sie geschlossen: das Schreien des stets lauten Knäbleins musste schon mörderisch werden, ehe sie ans Aufstehen dachte.
Jetzt, da sie den Weg von ihrer Behausung zum Stand nicht ein paarmal am Tag hin und her zu machen gezwungen war, nahm ihr Umfang täglich zu, ja sie glich eher einer wandelnden schwammigen Fettphramide denn einem auch nur einigermassen geformten weiblichen Wesen.
Wenn sie ging, sah sie aus, wie wenn sie auf ein Brett mit kleinen Rädern gestellt wäre, das eine unsichtbare Hand an einer unsichtbaren Schnur hinter sich drein zog.
Aller unnötigen Beschäftigung abhold, war ihr die mit dem Kinde in den Tod zuwider. Konnte denn der krebsrote Kerl mit den spindeldürren Beinchen, der stets aussah, als sei er am Ersticken, nicht endlich den Zweck erfüllen, den Mutter Vevi für seinen einzigen hielt, nämlich — sich möglichst bald aus dem Staube zu machen? Nein, voll ausgesuchter Bosheit blieb er leben, genau wie er eben diese Bosheit dadurch bewies, dass es ihm auch in der Folge gar nicht einfiel, einem der mutmasslichen Väter zu gleichen.
„Wo der Bua ner des G’müt her hat?“ fragte sie oft und oft die dürre Wiesnerin, ihre Kollegin, die manchmal ihre Abendvisiten machte. „Von mir doch net! Ich bin alleweil gutmütig und g’fällig g’wesen, und er is es net. Es is, g’wiss und wahr, ein Irrtum, und ich kann’s gar net glauben, dass grad ich sei Mutter worden bin. G’münzt hab ich’s net auf ihn g’habt und entbehren könnt ich ihn leicht.“
Die dürre, ausgemergelte Wiesnerin verstand das sehr gut. Sie hatte es auch nicht auf ihre zehn „gemünzt“ und hätte sie auch leicht entbehren können
„Ja, gelt Wiesnerin, vor fünfundzwanzig Jahren, da war’s anders!“ Gerieten sie auf dies Thema, so kamen die beiden, die miteinander jung und sauber gewesen, an kein Ende.
Wer allerdings heute Mama Glocke sah, förmlich zerflossen, Leib und Brust ineinander übergehend, dass nur die Schürzenbänder die mutmasslichen Konturen bezeichneten, mit entzündeten Augen, die Haut rot und höckerig unter dem spärlichen Haar, der musste erstens freilich den Kopf schütteln über Fritzls Existenz, zweitens konnte er sich gewiss nicht vorstellen, dass die schwammige Hökerin einst eines der schönsten Mädchen war.
Die Wiesnerin jedoch hob jederzeit den Schwurfinger für Vevis Reize, und wer es trotzdem nicht glauben wollte, den konnte man schlagend auf die schöne Tochter verweisen, die, zwanzig Jahre vor dem Fritzl geboren, der Mutter Abbild geworden, eine bekannte Schönheit, gross und schlank, mit blitzenden Augen und blitzenden Zähnen, mit einer Haut wie Alabaster. Leider war sie nur im Bild und nicht leibhaftig zu sehen, da sie von einem reichen Viehhändler geheiratet und nach Ungarn exportiert worden war. Dort blieb sie bis gegen das Ende dieser Geschichte für die Mutter verschollen, froh wahrscheinlich, die Schweinewirtschaft im grossen Stil vertauscht zu haben.
Die sei ein anderes Kind gewesen, kein solcher Wechselbalg wie der Fritzl, klagte Mama Glocke.
Der glich ja eher einem Vogel denn einem kleinen Menschenkind; sein Gesicht büsste niemals die Röte ein, die er mit in dieses Jammertal gebracht, und er sah schon im Wickelkissen aus, als sei er voller Zorn und Geifer.
Die war prompt zur richtigen Zeit gekommen, Vevi konnte prompt den Vater angeben, und mit einem Jahr fing sie prompt zu laufen an.
Dagegen der!
Im dritten Jahre bequemte er sich erst, auf den dünnen gekrümmten Beinchen zu stehen und ein wenig zu reden. Geschimpft hatte er freilich, ohne reden zu können, von allem Anfang an aus seinem Korb heraus wie ein Rohrspatz. Da lag er drinnen, anzusehen wie ein halbverhungerter Rabe, mit dem langen dünnen Halse, der grossen Nase und den runden schwarzblanken Augen, die schon ganz früh eine Verruchtheit verrieten, die später sein Stolz und seine Stärke wurden.
Nichts hatte er von ihr, wie sie meinte, vor allem nicht ihr schönes, warmes und gütiges Herz.
Er konnte noch nicht einmal laufen, nur krabbeln, doch versuchte er schon, die Mutter von ihrem Lehnstuhl zu zerren, weil er ihn in Besitz nehmen wollte, und konnte dabei blaurot vor Wut werden und um sich schlagen und beissen wie ein kleines Tier.
„Fot! fot!“ schrie er und stiess nach dem unbeweglichen Fettkoloss von Mutter. Sie stiess nicht wieder, das verbrauchte zu viel Kraft. Ihre ganze Vitalität hatte sie nötig, um aufzustehen, wenn ein Kunde kam, und dem ein süsses Maul über die Hängebacken zu machen. Hatte der die Tür wieder von draussen zugedrückt, sank sie allsogleich in den Lehnstuhl zurück, der noch lange nach der „Niederlassung“ Töne des Protestes von sich gab.
Dort sass sie — der Fritzl erinnerte sich in späteren Jahren noch wohl daran — und kaute gern Hutzeln und Nüsse, die etwas trockene Vesper mit dem Fläschlein befeuchtend.
Ihre Kochkunst war nicht allzusehr ausgebildet; ohne viel Vorbereitungen in Szene gesetzt, schnell verschlungen, bestand ihr Menü stets aus einem Gerichte, d. h. aus Verschiedenem, das kunterbunt in einem Topfe aufgesetzt wurde, während der Fritzl meistens aus dem Uebriggebliebenen, aus kalten Näpfen aufgefüttert wurde, besonders in späteren Jahren.
Da fing auch das Nebengelass, das Kabinett, von Fritzl Keuche geheissen, an, zu klein zu werden, und ohne viel Federlesens warf Vevi dem Jungen einen Kotzen ins Gewölbe, ein paar Decken und ein Polster dazu. Nun schlief er mitten unter Obstfässern und Gemüsekörben, eingewickelt und förmlich in sich zusammengeringelt, wie junge Hunde es machen, denn das Gewölbe war kalt im Winter, da Mama Vevi in weiser Fürsorge gerade so viel Wärme aus dem Kabinett herausliess, dass Obst und Gemüse nicht erfroren.
Untertags blieb sie dort oder sass, in Mäntel und Decken verpackt, und so noch monströser anzusehen, heraussen im Gewölbe das traditionelle Kohlenbecken der Hökerin unter den Füssen.
Im Winter kamen die Kunden zu ihr herein: eilige und schwatzhaste Dienstmädchen, kleine Studentlein und Gewerbeschüler ohne Mäntel, mit roten und schwarzen Pulswärmern an den blaugefrorenen Handgelenken; es kamen kleine und grosse, schüchterne und freche Klosterschülerinnen die die Süssigkeiten rasch in den Muff und dann sogleich ins Mäulchen steckten.
Alle kannten den Fritzl und gingen mit ihm um, wie man mit einem zwar amüsanten, aber bösartigen gezähmten Vogel oder einem bissigen kleinen Köter umgeht.
So ähnlich behandelte ihn auch Mutter Vevi, wenn sie friedfertig war, und sie war das wirklich aus Bequemlichkeit und einem angeborenen Hang zum Duseln. Aber, aber! Etwas verdüsterte das Bild ihrer beschaulichen Seele.
Sei es, dass das Fläschlein wohl manchmal seine Wirkung auszuüben begann, sei es, dass in irgendeinem Winkel ihres Gemütes noch ein Stück unausgelösten Temperamentes spukte, von Zeit zu Zeit überkam die sonst so stille Seele ein furchtbarlicher Zorn, der sie ohne Veranlassung fast, ja wie der Blitz aus heiterem Himmel überfiel.
Dann stürzte sie wortlos auf den Fritzl los und zerbläute ihn so lange, bis sie genötigt war, unter Aechzen auf den protestierenden Stuhl niederzusinken, in der Farbe ihren rotvioletten Krautköpfen nicht unähnlich, die in den Stellagen in Reih und Glied standen.
Das waren ihre Quartalszörne, die sich leider in späteren Jahren auch auf die Kunden auszudehnen begannen Harmlose Bürger und Bürgerinnen, kleine Schulkinder, eilige Gewerbeschüler (in der Stadt Gewerbschachteln geheissen), dürftige Präparanden oder Fremde, die, nur ganz bescheiden vielleicht, handeln wollten, bekamen ganz plötzlich zu ihrem masslosen Erstaunen böse Worte um die Ohren und allerlei Waren ins Gesicht geworfen. Standen sie trotzdem noch eine Weile still oder begannen gar aufzubegehren, so konnten sie es erleben, wie Mutter Glocke Aepfel und Birnen Feigen und Bonbons, selbst das vielbegehrte Studentenbrot Lebkuchen und süsses Gebäck im wildesten Tumult durcheinanderwarf, ja das Leinendach ihrer Auslage mit wütenden Griffen herabzerrte, sogar zuletzt anfing, ihrem Handel tatsächlich alle Basis zu untergraben, indem sie ihrem wackligen „Stand“ die Beine ausriss und alle Waren durcheinander mit einer bei ihren Fettmassen ans Wunderbare grenzenden Behendigkeit unter die Zuschauer warf, die sich stets in hellen Haufen einfanden.
Das grösste Gaudium hatten dabei natürlich die Gassenkinder die schon länger, den Finger im Munde, auf einem Bein stehend und sich so um sich selber drehend, in vorausahnender Wonne dem Verlauf der Dinge zusahen.
Endlich war alles so weit gediehen, dass sie sich wie heulende Derwische auf die Leckereien stürzen konnten, während Mutter Vevi, in ihren Grundfesten erbebend, eine Masse unziemlicher Ausdrücke und unflätiger Schimpfworte unter die Menge warf, so unflätig, dass man sie sogar in Gedanken nur errötend und widerwillig wiederholen mochte.
Das Schimpfen dauerte so lange, bis ihr keine noch wüsteren Worte mehr einfielen, oder bis ihr der Atem versagte, um das Gelächter und den Tumult zu überschreien.
Dann watschelte sie, noch immer unter Geschimpfe, ins Gewölbe, dessen schwere, eisenbeschlagene Holztür, die sonst nur während der Nacht geschlossen ward, sie hinter sich zuwarf.
War es dem Fritzl noch gelungen, vor diesem Akt zu entkommen war es gut; wenn nicht, war es schlimm, denn die Reihe kam nun an ihn.
Eine wilde Jagd begann in dem stockdunklen Gewölbe. Der Fritzl suchte instinktmässig zu verhindern, dass die Alte an die Tür des Nebenzimmers kam, denn wenn sie die aufriss und es hell wurde, war er verloren. Da kriegte sie ihn allemal. Je weniger Mutter Vevi ihren leiblichen Sohn erreichen konnte, desto hartnäckiger wurde sie. Wie ein Affe hüpfte der Fritzl von einem Obstfass aufs andere, hopste auf den Lehnstuhl, warf der Keuchenden Krautköpfe vor die Füsse — dennoch, trotz seiner Behendigkeit fiel der Junge ihr fast regelmässig doch noch in die Hände, und in dem tiefen Dunkel entspann sich dann ein Kampf, bei dem beide blindlings aufeinander losschlugen und der Fritzl wie wütend um sich biss, so lange, bis sie ihn aus allen Kräften an sich zog, förmlich in sich hineinpresste, dass er fast in ihrer „Leiblichkeit“ ersticken musste.
Hier und da gelang es dem Fritzl, das Nebengemach zu erreichen und drinnen sofort den Riegel in die Finger zu kriegen. War es ihm, unter triumphierendem Indianergeheul, geglückt, ihn zwischen sich und den entfesselten Fettklumpen zu schieben, so erhob sich alsbald ein solches Gebrüll und Zetergeschrei im Gewölbe — man war im Rathaus und die Polizeiwache ganz in der Nähe —, dass sämtliche Polizeisoldaten aufsprangen die vielleicht gerade alle an ihren Uniformen vorhandenen Knöpfe aufgeknöpft hatten und in der Wärme und in dem Frieden der Wachtstube die Fliegen an der Decke und auf dem Fussboden mit den Augen fingen. Mit krummen Zehen angelten sie nach ihrem danebenstehenden Schuhwerk und liefen schnell fort, im Lauf noch die allernotwendigsten Knöpfe schliessend. Gleich darauf erschienen sie säbelumgürtet und mit strengen, schnurrbärtigen Mienen, zerteilten durch Augenrollen und durch drohende Bewegungen den Tumult, worauf sie mit dem ihnen zukommenden Ernst und der ihnen wohl anstehenden Würde nach feierlicher Eröffnung der Tür den nachbarlichen Kobold, der ihnen schon Streiche genug gespielt, in schöner Uebereinstimmung versohlten. Alsdann sprachen sie je nach der Würde und Laune ein paar Worte mit der verstummten Vevi, zogen auch, je nach Würde und Laune, kürzer oder länger an der Glockin Fläschlein und verschwanden wieder, würdig und mit befriedigtem Ausdruck, in der Richtung nach der Wachtstube zu.
Das Ende eines jeden Quartalszornes war stets gleich, nur der Effekt war für Mutter und Sohn ungleich.
Fritzl hockte immer heulend, von ohnmächtigen Rachegedanken gegen die hohe Polizei und Mutter Glocke gleichmässig erfüllt, doppelt versohlt auf seiner Decke im Winkel, und die Alte lag, nachdem sie noch eine Weile gegröhlt, mit dem leeren Fläschchen schnarchend auf ihrem Bett.
Den nächsten Tag war sie demütig, zerknirscht, voller Erbitterung, nicht gegen Fritzl, sondern stets gegen die hohe Polizei, die nicht früher eingeschritten und so ihre „Sach“ gerettet hatte.
Mit vielem Aechzen und unter einer schweren seelischen Depression suchte sie rings um das Gewölbe, sogar im Rinnstein nach den verschleuderten Waren, und der Fritzl musste nach dem Schreiner laufen, dem sie jedesmal sagte:
„Brunnhuber, da schau her, a Kreiz is, alles is hin! Gestern hat mir der Wind, der elendige, wieder alles umg’schmissen,“ worauf Brunnhuber jedesmal mit schönem Ernst erwiderte: „Ja ja, damisch is er gestern gangen, der Wind!“ ein paar Nägel einschlug, einige Kreuzer einsackte und wieder ins Wirtshaus trollte, aus dem ihn der Fritzl aufgestöbert.
Süss war der Aufruhr dennoch des öfteren für Fritzl. A conto des Wirrwarrs stopfte er sich die Taschen mit guten Sachen voll, die er später, freilich unter Tränen, in seinem Winkel hinabwürgte. Manchmal behielt er auch das eine oder andere Stückchen, das ihn nicht besonders anzog, zurück, um es seinem intimsten Freund, den hinkenden Maxl, gönnerhaft in Wort und Allüren, zu überreichen. So ungefähr waren die Höhen und Tiefen, war das „Auf und Ab“ in Fritzls Jugend, und als wohlbestellter nachmaliger Kampelmachermeister hat er nicht an dem Gewölbe vorbeigehen können, ohne auszuspucken und einen schnellen schiessenden Seitenblick nach der teuren Heimat zu tun.
Eigentlich wäre jetzt von seinem getreuen „Spezl“ und viellieben Freund, dem hinkenden Maxl, zu reden. Doch soll jetzt die Mahn-Rosine an der Reihe sein, und auf unserer Wanderung vom Rathaus und Marktplatz die Girgengass hinauf gegen die Paradeisgass zu steht ihr elterliches Haus auch gerade am Weg.
Wenn man das Palais Glocke zum Vergleich heranzieht, war freilich dagegen gehalten die Mahn Rosine, die bestimmt war, in Fritzls Leben eine Rolle zu spielen, „in Herrlichkeit geboren“.
Tochter des Tändlers und Kleiderhändlers Aaron Mahn und seiner Ehefrau Malche, geborene Blumenstätter, war man über ihren Vater nicht im unklaren, wie über den des pp. Fritzl. Die Hebamme hatte sofort die ordnungsgemässe Solidität und das durchaus zu billigende Bestreben des kleinen Kindleins, dem „Date“ ähnlich zu sehen, konstatiert. Nur die Peinlichkeit allein, mit der die Nase der kleinen Rosine sich bemühte, aufs Haar der des alten Aaron zu gleichen!
Die jüdische weise Frau konnte sich nicht enthalten, der Wöchnerin anerkennend zuzurufen: „Malche, des hascht de gut gemacht, ganz der zwett Alt’!“
Doch Malche, von der der spätere Hang Rosinens für alles Schöne und Ideale stammte, hatte für die Art Schönheit und für dieses Ideal kein Verständnis bekundet, sondern nur ein paar tiefe, ja beschämte Seufzer ausgestossen, die schon eher ihre Enttäuschung und Erbitterung bekundeten; ja, sie machte später ihrer Verwandtschaft gegenüber kein Hehl daraus, dass es ihr furchtbar bitter sei, dass das Rosinchen nicht ihr gleichen wollte, sondern hartnäckig fortfahre, immer tiefer in die Aehnlichkeit mit dem „Date“ hineinzugeraten. Diese fieberhaften Bestrebungen des Kindes, den Alten nachzuahmen, erlebte das schöne Malche freilich nicht allzulange. Acht Monate nach der Geburt des kleinen Mädchens legte sie sich hin und starb.
Die Verwandtschaft des alten Aaron, boshaft und schlagfertig wie er selber, die stets im Krieg mit dem ideal veranlagten Malchen gelegen hatte, behauptete, dass sie, eitel wie sie gewesen, aus Gram darüber gestorben sei, dass das Rosinche, eine echte „Mahn“, sich hartnäckig weigere, den idealen, aber bornierten Typus der Blumenstätter anzunehmen, und lieber aussehen mochte wie sie, die rassigen und siebengescheiten Mahns. Das hatte sie, die sich im Kinde wiederfinden wollte, nicht überlebt.
Frau Malchens Höchstes war freilich von jeher die Schönheit und die „Kunscht“ gewesen. Da kam sie allerdings bei Vater Aaron selbst sowie in seinem Tun und Treiben, Leben und Sein nicht auf ihre Rechnung. Ihre heissen Wünsche und Sehnsüchte fielen ganz aus dem Rahmen des geschäftigen, streng und eng geführten Lebens im Hause Mahn. Der alte Aaron jedoch, der seine viel jüngere schöne Frau nicht gern andere Pfade hätte wandeln sehen mögen als „zulässige“, erlaubte ihr, schlau und bequem, wie er zugleich war, alle Extravaganzen, die sie allein geniessen konnte und die ihr zugleich harmlos und dennoch prickelnd dünken sollten, ihm aber tauglich und angebracht erschienen für ihr etwas zu jugendlich überschäumendes Temperament. Sie konnte alle Konzerte besuchen, die sie wollte; sie konnte im Theater der kleinen Stadt die blonden und braunen Liebhaber anschwärmen oder im Laden und in der Wohnung Tränen über irgendein unnützes Buch vergiessen.
„Das koscht’t nit so viel,“ beschwichtigte er die Stichler und Hetzer aus seiner Familie, „müsst’ ich bezahle mit meiner Ehr’ wär’s mehr, so sind’s ä paar Grosche und sie is zufriede und ich auch.“
Also in ihren Gefühlen sanktioniert, schwärmte das schöne Malche für die meisten männlichen Mitglieder aller Truppen und Trüppchen, die ins Städtchen kamen und in der in einen Musentempel umgewandelten, ehemaligen romanischen Kirche ihre romantischen Schauspiele und verkürzten „aktuellen“ Lustspiele den hungrigen Kleinstädtern kredenzten. Auf diese harmlose Weise löste das Weib Aarons alle ihre unausgelösten erotischen Gefühle schamhaft und keusch aus. Dabei hielt sie streng dem Alten die eheliche Treue, stets demütig und dankbar, und das bisschen böse Gewissen, das sie meinte haben zu müssen, gab ihr in den Augen des alten Fuchses eine Charme mehr, obwohl er vom Theaterrennen und vom „Stuss“ seiner Frau sprach. Ihr Tod ging ihm sehr nahe, da auch seine Eitelkeit mit im Spiel gewesen und er sich gern prahlend neben ihr gezeigt hatte; er verkroch sich ganz ins Haus und ins Geschäft, während er sonst, besonders an hohen jüdischen Festtagen, mit dem Zylinder, das Malche schön geputzt, rauschend in Seide, auf der Promenade gewandelt war.
Jetzt kam er kaum vor die Ladentür; selbst als das Rosinche so weit war, ihren Wünschen Ausdruck zu verleihen, und das war ziemlich früh, und beständig bettelte, „hörschde Date, nemm mich mit,“ schielte er nur über die Brille auf die kleine Kreatur herunter, liess sich aber nicht erweichen. Er hatte das Kind gern auf seine Art, aber ausgehen mit ihm? Wozu? Staat war keiner mit dem Rosinche zu machen. Erstens blieb’s ewig ein Knirps, und nichts wollte wachsen an ihm, nur die Nase und der Kopf, und dann ging es knipp — knapp, und er, der alles gern im Sturmschritt nahm, kam mit dem hüftenlahmen Kreatürchen nicht vom Fleck. Nein, er war nicht zärtlich und nicht von der Sorte:
„Ich und mein Knipperlknapp
Geh’n mer spazieren,
Geh ner her Knipperlknapp,
Lass dich schön führen.“
Das schöne Führen hatte er niemals verstanden, auch zu Malchens Zeiten nicht, und ausserdem — was hätte er denn mit dem kleinen Ding reden sollen? Vom Geschäft wusste es doch nichts. Das sollte nur droben bleiben in der grossen Wohnstube, die, wie hinten die gute Stube, mit zwei Fenstern die ganze Front des engbrüstigen Hauses einnahm.
Unten war der Laden, daneben ein schmales Hinterzimmer und die Küche, im dritten Stock die Kemnate der alten Tante, die seit der Mutter Tod das Rosinchen betreute, das Schlafzimmer des Alten und des Töchterchens daneben, dazu eine Kammer für die Magd.
So waren in den drei Stöcken die Zimmer und Zimmerchen verteilt, und Treppchen und Stiegen und Absätze und Nischen und Gänge gab es noch genug innerhalb dieses Winkelwerks; denn die Hinterzimmer lagen niederer als die Vorderzimmer, und ausser der Treppe, die eng und schmal war und an den Ecken mit einem unerwarteten und energischen Ruck kehrtmachte, ehe sie weiter führte, bestanden noch Separathühnerleitern oder Stiegen von Stock zu Stock.
Das hatte für Frau Malche etwas sehr Heimliches und Romantisches gehabt, die alten Gänge und Stuben in die ihr Mann so viel schönes und altertümliches Gerät hinemtrug, aber das Rosinche sagte schon mit drei Jahren bestimmt und überlegen: „Ich möcht’ ä neu Haus; ich möcht’ ä schönes Haus und Plüschmöbel.“ Ja, das Rosinche hatte Ambitionen!
Als es anfangen sollte, in die Schule zu gehen, begann der Vater sich für das Kind zu interessieren. Wenn er mit ihm des Abends am Tische sass oder wenn er die Kleine im Ladenstübchen auf den Knien hatte und rechnen liess, grinste er über das ganze Gesicht. Das war Fleisch von seinem Fleisch, Blut von seinem Blute! Und bald stand das Rosinche im Laden hinter der Theke. Allerdings schauten nur ein paar graue, etwas hervorquellende Augen und eine grosse Nase über den Ladentisch, und man sah den zehn Fingern, die sich ans Brett krallten, die Mühe an, sich so weit oben zu halten. Aber die grossen Augen wunderten und wunderten und liessen den Käufer nicht los, verfolgten ihn, wenn er etwas in die Hand nahm, wurden unruhig, wenn er handelte; ging er und hatte gekauft, so platzte das Rosinche heraus: „Was hat er gegebe for die Stiwwel?“
Ging er, ohne zu kaufen, so verliess das Kind lautlos seinen Platz, und in den grauen Augen war ein Ausdruck von Geringschätzung für den Vater.
Die Kleider Rosinchens behielten beharrlich den Geruch des Ladens, denn das kleine Mädchen war viel mehr unten als oben.
Da das Hinterzimmer auch noch mit Waren, vornehmlich mit Stiefeln, vollgepfropft und die Tür zwischen Laden und Hinterzimmer beständig in Bewegung war, hatte sich auch dort derselbe fatale Geruch festgesetzt, der im Laden dominierte, dem alten Mahn aber nicht mehr zum Bewusstsein kam, denn er kannte keine andere Atmosphäre; die sonntägliche Luft in den oberen Räumen schnaufte er misstrauisch ein, und sie erschien ihm unzuträglich.
Ueberhaupt die Sonntage hasste er. Die benutzte gewöhnlich die alte Tante, die sonst seiner nicht habhast werden konnte, sich an ihn zu hängen wie eine Klette. Da begann sie von den zahlreichen Krankheiten zu erzählen, die sie während der Woche überfielen, oder von den ebenso zahlreichen früheren Mägden, die es durchaus nicht hatten einsehen wollen, dass das Haus Mahn ein Eldorado — oder — aber das war ein gefährliches Thema — über das Rosinchen zu klagen; denn die alte Tante war weichen Gemütes und liebte das Kind, obwohl es, spottsüchtig und respektlos, einstweilen seinen Witz an der Alten ausübte.
Diese schüchternen Klagen aber passten dem Vater Mahn gar nicht; er war in dem Punkte sehr empfindlich; schön war das Rosinche nicht, also musste es doch brav und gescheit sein. Jetzt war die alte Schaluppe schon so lange Jahre im Haus und wollte das nicht einsehen!
„Des steckt dich zehnmal in de Sack, gelt, des sind dein Schmerze?“ spottete er.
Im Grund war die alte Tante ebenso ehrgeizig und ebenso verliebt in das Rosinche wie der Alte. Es war doch sonst niemand da!
Schon lange dünkte ihr die jüdische Volksschule nicht mehr passend für das Talent des Kindes, und es verlangte ja auch selbst, herausgenommen und ins Institut getan zu werden.
„Es hat doch Ambitione!“ sagte vorwurfsvoll die Alte, „des weisst de doch!“
„Stuss!“ brummte der Alte, „werd se dort schöner, werd se dort grösser, werd se dort gescheiter?“ — aber er gab doch nach und, freudig erregt, von Ehrgeiz und Stolz gebläht, hickelte das Rosinche in das Institut, das Töchterschülche, wie der Vater Aaron sagte.
Es war so klein geblieben, dass es noch gut in die erste Klasse der Volksschule gepasst hätte; die Nase zwar war mächtig gewachsen und das lange Kinn hing tief auf die schmale Kinderbrust herab. Die Haare pflegte die Tante in der Mitte zu scheiteln und dann mit solcher Wucht hinter die Ohren stramm zu kämmen und dort in zwei eisenharte Zöpfe zu pflechten, dass es aussah, als sprängen gerade durch diese barbarische Prozedur die Augen so gar sichtbarlich und gewölbt aus dem Kopf hervor.
Für die Gassenbuben, und dazu war vor allem der Kampelmacherfritzl zu rechnen, war das Rosinchen schon lange ein beliebtes Objekt, beliebt und dankbar, denn es weinte nicht wie die anderen Kinder, wenn es verschimpfiert wurde, oder lief auf und davon, sondern es schimpfte herzhaft wieder, kräftig und abwechslungsreich, schimpfte wie ein Rohrspatz und, findig wie es war, blieb es den Angreifern nichts schuldig in Worten und erfand obendrein noch die prächtigsten Namen für sie, so dass es oft die Lacher auf seiner Seite hatte.
Als es in einem neuen grasgrünen Kleide, das zu seiner fahlgelben Haut, Teint des Date Aaron, wundervoll stimmte, mit einem nicht nur angedeuteten, sondern ziemlich umfangreichen Reifröcklein, einem grossen Herrenwinker mit strohgelbem wehenden Band auf dem Haupte — Geschmack der Tante — in die Töchterschule wandelte, wurde es in dieser neuen und erstaunlichen Equipierung von seinen Widersachern mit Hallo empfangen, mit Hallo eskortiert und mit Hallo an der Tür des Instituts abgeliefert.
Bis dahin hatte das Rosinchen geschwiegen, wohl aus einem unklaren Gefühl heraus, dass es sich für eine angehende Töchterschülerin nicht schicke, auf der Strasse Krakeel zu machen. Vor der Pforte riss ihm aber doch die Geduld und es drehte sich ganz unerwartet um, streckte den Widersachern die lange, kohlschwarze Zunge entgegen, denn es hatte eben Schwarzbeerkuchen gegessen, riss blitzschnell die Schultasche vom Buckel, die gross und gewichtig aufs Wachsen berechnet war, packte sie bei einem Riemen und schlug herzhaft unter die Horde.
Resultat: Eine zu Tode erschreckte Pförtnerin, ein unsanftes Befördern ins Klassenzimmer, eine zürnende Standrede der Schwester-Lehrerin, eine Anstandspredigt der herbeigeeilten Oberin zum Beginn; dann folgte eine lange Ermahnung, Drohung der Ausweisung — das Rosinchen war ja nur ein Judenmädchen — und ein Tränenmeer von seiten der „kleinen Mahn“ als Eintritt in das Institut. Beim Eintritt in das Klassenzimmer war das Rosinchen von den neuen Gefährtinnen fast mit demselben Hallo begrüsst worden wie auf der Strasse von den Widersachern.
Still und langsam hickelte es, in seinem Krinolinchen einer kleinen wandelnden Glocke gleich, heim, nicht triumphierend, wie sich der eitle Date und die eitle Tante gedacht, sondern begossen wie ein Pudel, nicht strahlend die Girgengass herunter, sondern heulend durch die Gassen und Gässchen; daheim stane es noch ein Weilchen, ganz gegen seine sonstige kecke Art im Hausflur, bis es sich so weit ermannte, ins Hiuterzimmer zum Vater einzutreten und dort seine Niederlage zu bekennen.
Der Alte setzte flugs seinen Ingrimm in Hohn um, weil ihm das besser passte und sich überlegener ausnahm, und da er das kleine Mädel in seinem grossen und gerechten Schmerze nicht noch mehr kränken wollte, fiel er über die Tante her. Das war das Ende ihres verfluchten Ehrgeizes und ihres bornierten Geldausgebens!
„Da hascht dein Töchterschülche! Da hascht dein grasgrünes Kleid! Da hascht dein gelbe Hut!“
Die Alte zitterte vor Erschütterung, kniete sich vor das heulende grasgrüne Idol hin, das von Zeit zu Zeit vor Wut stampfte, suchte es zu trösten, obwohl es fest auf die liebkosenden Hände schlug; sie schwur trotzdem, von nun an alle Ströme ihrer Liebe über das arme Kind zu ergiessen. Ja, sie liebte es, sie liebte es unbändig in dem Augenblick, wo man gewagt hatte, es so zu misshandeln. Ihr Goldkind, ihr Sonnenstrählchen so zu kränken!
Da die alte Dame „latschte“, lautete ihr Rosinche ungefähr wie „Lochchinche“ und ihr Sonnenstrählche wie „Chlonnenchltrählche“. Aber das Chlonnenchltrählche wollte nichts von ihrer Zärtlichkeit wissen. Sie war an allem schuld, nur sie, und das Rosinche riss das grasgrüne Kleid herunter und spuckte darauf:
„Da, da, tu’s fort! Mach, mach!“ Erst als der Staat verschwunden war, wurde es ruhiger, ass, in seinem weissen Unterröckchen, dem weissen Pikeeleibchen, den Herrenwinker auf dem Kopf, noch immer sehr feierlich und feiertägig anzuschauen, mit am Tisch im Ladenzimmer, bekundete nach und nach sogar Interesse an den Kunden, die während der Tischzeit kamen, indem es aufhüpfte, sich auf die Zehen stellte, den Vorhang lüftete und mit grossen runden Augen die Vorgänge draussen im Laden überwachte.
Die Tante Mine, selig, dass der alte Aaron nicht mehr schimpfte, und der die Sache erledigt schien, schwätzte ununterbrochen darauf los, nur damit die fatale Geschichte nicht wieder berührt wurde. Die war aus und begraben, schimpflich, glimpflich.
Als es gegen halb zwei ging, sah der Alte angelegentlich und immer angelegentlicher nach der Uhr, über den Hornkneifer hinaus auf das Rosinche und zuletzt auch auf die Tante Mine.
„No, werd’s bald?“ frug er.
„Ja, was denn?“ fragte die Tante und kriegte es mit allen Schrecken. Das Rosinchen wurde blass, wie ein langer grauweisser Käsleib sah sein Gesicht aus, es sprang von seinem Stühlchen herab und stand zur Flucht bereit.
„Was denn, was denn?“ spottete der Alte nach. „Anstellerei! Als fort in die Schul!“
„In die Schul?“ — — und Tante und Nichte fingen zu gleicher Zeit ein Gezeter an, bei dem hauptsächlich das Chlonnenchltrählche sich krampfhaft hervortat.
Nein, nein, nein, sie ging nicht und der Vater wäre gescheit genug, das einsehen zu können, dass das nichts für sie wäre, lieber sollte er sie totschlagen.
Diesmal gab aber der Alte nicht nach; er hielt das quiekende Rosinchen fest bei der Hand und kommandierte: „Kleider her!“, er hing ihr den grossen Schulranzen, zum Hineinwachsen berechnet, auf den Rücken, die Tante setzte ihr weinend den alten schwarzen Strohhut auf; dass sie das Chlonnenchltrählche nicht segnete bei seinem Ausgang, war alles.
Der Alte setzte sich selbst in Trab und das Rosinche musste wohl oder übel mit.
„No, was wär dann des, die Flint glei ins Korn zu werfe! Ich hab vorausbezahlt, und die Zeit sitzt se mir ab.“
So handelte der alte Aaron ähnlich den Bauern, die, um nichts umkommen zu lassen, was viel Geld gekostet hat, die Medizin nach dem Tode eines Familienmitgliedes trinken; das Rosinche musste das Geld im Töchterschülche absitzen, ob ihm die Sache schmeckte oder nicht.
Der Date hielt das Kind fest bei der Hand, da half kein Sperren und kein Stemmen; in seinem alten schwarzen Ladenkittel, den Hornkneifer auf der Nase, barhaupt, führte er das widerspenstige Mädel vor die Pforte des Instituts.
Diesmal folgten die Gassenbuben, deren grösste Anzahl die Paradeis- und Langegasse stellte, in gemessener Entfernung, aber das Johlen ging nicht aus, bis der Aaron das Rosinche der Schwester-Pförtnerin übergeben hatte und es für die Rangen die höchste Zeit war, in der altersbraunen Tür der benachbarten Knabenschule zu verschwinden. Der letzte war natürlich der Fritzl, der Vevi Glocke Sohn, denn nie pressierte es ihm in die Schule. Alles war ihm wichtiger denn Stillsitzen und Lernen. Nicht einmal die Person des alten Aaron war ihm heute heilig gewesen, er hatte den Lehm, den er zufällig in der Hand trug — und er trug stets etwas zufällig in der Hand — gleichmässig auf den kaftanartigen schwarzgrünen Lüsterrock des Aaron Mahn wie auf das graue Mixkleid des Rosinchen verteilt, wo er besonders schön sitzen blieb weil das Krinolinchen eine entgegenkommende gefällige Wendung machte. —
Auch der Nachmittag war kein Triumph für die Tochter Aarons; wieder kam sie durch die Gässchen heimgeschlichen, und es gab von nun an Tag für Tag Proteste und Tränen.
In der jüdischen Volksschule war das „Lochchinche“ eines der angesehensten Kinder gewesen, war die Gescheiteste, stets mit dem Finger in der Luft, immer aufspringend wie ein Gummiball, weil es alles wusste, immer belobt und bevorzugt, hochmütig und voller Verachtung auf die anderen herabsehend, auf die Fauleren, die Dümmeren, die Aermeren. Dort war sie Herrscherin, hier die Geduldete, die kleine, krumme, hinkende Jüdin, die mit zu wenig Vorbildung in die Töchterschule kam, mit der sich niemand Mühe gab, und die deshalb nichts nachholte, die steckenblieb, wenn sie schon etwas wusste, weil alles lachte, ehe sie anfing; hier war sie die Vereinsamte, ja fast die Gemiedene. Wenn man mit ihr sprach, geschah’s stets mit Herablassung und in überlegenem Ton; auch die Klosterfrauen, die Lehrerinnen, machten es so, nur war ihr Ton noch gönnerhaft dazu. Rosinchens Keckheit, ihr rasches und böses Mundwerk, ihr heller Kopf waren beim Kuckuck, wenn sie mit den „Chrischdekindern“ in der Bant sass. Sie war wie ausgewechselt, und daheim war erst recht der Teufel los, so schlechten Humors war sie immer.
Der Date brachte sie in der ersten Zeit stets selbst zur Schule, später musste Tante Mine die Eskorte bilden, aber es war schon oft vorgekommen, dass man das Kind zur Schulzeit am Morgen vergebens suchte.
Mäuschenstill hatte es sich an einen Ort geschlichen, den zu betreten man ihm keinesfalls verwehren konnte. hatte dort den Riegel vorgeschoben und weder Bitten noch Drohungen hatten es zum Oeffnen veranlassen können. Der Alte merkte nichts, nur Tante Mine stand leise flehend vor der geschlossenen Pforte und brauchte alle Listen: „Bitt’ dich, Lochchinche, mach uff! — der Date kommt. — Und ich will doch chlelbst“ — aber alles blieb totenstill. Die Tante rüttelte mit Vorsicht: „Hörchlte, ich will doch chlelbst!“
Da tönte ein Stimmlein mit unterdrücktem Kichern heraus:
„So geh halt in de erschte Stock!“ womit Tante Mine aus dem Felde geschlagen war.
Einmal kam aber doch der Date an die verriegelte Tür, und da setzte es Prügel, die ersten. Die nahm das Rosinchen, mit seinem klugen Kopf überschlagend, dass es verdiente waren, schweigend hin, aber der Hass auf das Kloster und die Chrischdemädcher wuchs.
Verstockt, wortkarg, aber gelegentlich doch wieder frech und ungezogen, unmanierlich wie ein Gassenkind, anders kannte man die „kleine Mahn“ nicht im Institut.
Allmählich gewöhnte man sich wohl an sie, das heisst, man übersah sie. Keines der Mädchen machte sich etwas aus ihr oder ging mit ihr nach Hause; in der Pause warfen sie ihr kaum ein paar Worte zu.
Da war nur ein grosses, plumpes, unbeholfenes Ding vom Lande mit wasserblauen Augen und einem Gesicht wie aus Kartoffeln gemacht: das fühlte sich in seinem dumpfen Drange zum Rosinchen gezogen. Es war fast ebenso gemieden wie die „kleine Mahn“, war wortkarg, unsicher und wurde auch übersehen. Es kam von einer Landschule und alles, was es hörte, waren ihm böhmische Dörfer. Ausserdem trug es auch noch eine Krinoline wie das Rosinchen und dazu stets ein weisses dreieckiges Halstüchlein, womit es von Anfang an der Spott aller besseren Mädchen war. Da es Lina hiess, brachten ihm die Kinder, die stets erbarmungslos treffsicher und grausam sind, den Spitznamen „Krinolineline“ auf, und es verstand sich von selber, dass die Krinolineline und das Rosinchen zusammengehörten und eine oder mehrere Stufen tiefer standen als sie selbst.
Die Krinolineline wurde von ihrem „Herrn Onkel“ ins Institut geschickt. Da der Herr Onkel aber nur ein armer Benefiziat war, der sich um die Waise angenommen, und kein Dekan, geistlicher Rat oder etwa ein hübscher junger Katechet, da sie noch dazu auf Fürbitten hin einige Stunden unentgeltlich bekam, machte man im Kloster durchaus nicht etwa so viel Federlesens mit ihr, wie man es mit der Nichte des Dekans tat, und als später der alte Benefiziat starb und sich niemand meldete, der das Schulgeld hätte weiterbezahlen können, wurde die Line sofort ohne viel Umstände vor die Tür gesetzt.
Ihre Beziehungen zum Rosinche hatte sie aber doch angeknüpft, und als die Tochter Aarons nach dem Absitzen ihres Schulgeldes das Töchterschülche verliess, verbanden sie noch immer Freundschaftsbande mit der dicken Line, die in der Stadt verblieben war.
Der gute Onkel Benefiziat hatte nämlich ihr und seiner alten Haushälterin sein kleines Vermögen hinterlassen, und die Line blieb, da sie keinen Menschen hatte, bei der Alten und begann eine Nähschule zu besuchen, damit sie sich späterhin etwas verdienen könne.
Des Sonntagnachmittags aber war ihr gewöhnlicher Gang zum „Herrn Mahn“, wo sie sich nie anzuläuten oder gar an irgendeiner Tür anzuklopfen getraute, sondern bewegungslos und steckensteif im Gang stehenblieb, bis irgend jemand auf sie stiess.
Das Rosinchen, von ihr zärtlich Rosinerl genannt, wusste ganz genau, dass am Sonntag in irgendeinem Winkel, im Gang oder auf der Treppe die Line stand und sehnsüchtig darauf wartete, entdeckt zu werden: es bereitete ihm aber ein ganz besonderes Vergnügen sie nicht zu entdecken, ja, sie hielt sogar die Tante ab wenn diese nachsehen wollte.
„Lass das Stöckle stehe,“ sagte sie (die Line hiess Stock), „und pass auf, wie lang’s stehe bleibt.“
Einmal hatte sie es sogar über das Herz gebracht, die Line bis zum Dunkelwerden in der Kälte stehen zu lassen und dann erst herein zu holen; freilich überschüttete sie sie herinnen dann mit Liebenswürdigkeiten und konnte ganz unbefangen tun. Nie sagte sie: „So läut doch, Line!“ oder „Warum klopfst du nicht?“
Die Befangenheit und Devotion des Stöckels, die sie um jeden Preis erhalten wollte, gaben ihr die Harmonie und das schöne Gleichgewicht der Seele wieder, die ihr das Töchterschülche beinahe geraubt hätte.
Linens unbedingte Ergebenheit, ihre Bewunderung der viel klügeren Freundin, ihre gänzliche Unterordnung machten sie wieder zum alten Rosinchen, das den Glauben an sich wiedergefunden hatte.
Eine Eigenschaft der Line aber konnte das Rosinchen nicht leiden: sie ass zu viel. Wie ihr nur stets der Kaffee mit dem gewandelten Kuchen schmeckte! Ein Stück, zwei Stück, das kann man sich ja noch gefallen lassen, aber beim ersten schielte die dicke Line schon aufs zweite und beim zweiten nach dem dritten, streckte auch wirklich die Hand danach aus, doch die Rosine war schneller und packte sie fest und streng beim Handgelenk.
„Es langt jetzt, du kanscht satt sein!“
Der Line blasses Kartoffelgesicht rötete sich und sie schämte sich furchtbar, sich so vergessen zu haben. Der Tante Mine kamen fast die Tränen: „Aber Chlonnenchltrählche, so lachs’s ihr doch!“ Rosinche dagegen unerbitterlich: „Die is satt!“
Beim Fortgehen drückte Tante Mine der Line stets noch ein in Zeitungspapier gewickeltes Stück Kuchen heimlich in die Hand, trotz der Argusaugen des Chlonnenchltrählche, denn etwas heimlich halten, etwas heimlich tun, darin war sie dem Rosinche weit über, das alles herauspoltern und herausschreien musste:
„Es kriegt sonscht en Kropf,“ meinte der alte Aaron.
War schönes Wetter, so gingen die zwei Kameradinnen gewöhnlich spazieren. Die Line mit ihrem wehmütigen dicken Gesicht, das aber doch stets aussah, als lache sie, gross, eckig, mit schon knospendem Busen, den die Ziehmutter fest in ein blau und schwarz kariertes Kleid (Winter und Sommer zu tragen) eingepresst, und das kleine, humpelnde Rosinchen mit den Bollaugen, dem langen, gelben Gesicht und dem grünen Sonntagsstaat, beide in Krinolinen, die, einige alte Damen und Jungfrauen älterer Semester ausgenommen, niemand mehr sonst trug.
Bei Regenwetter und im Winter blieben sie meistens im Hause und hatten stets Gesprächsstoff und verstanden sich stets.
Beide waren im Vorhof des Wissens stehen-geblieben, und beiden war der Drang gemein, weiter zu lernen und gebildet zu werden. Die Line war unbeholfen, täppisch eifrig dabei und wahllos schwärmerisch, die Rosine praktisch, systematisch fast, aber mit einem kleinen Einschuss von Phantasterei: Erbe der Mutter. Dieser Einschuss bekundete sich bei ihr vorderhand in einem starken Hang nach Marionettentheater, Seiltänzerbuden, wandernden Truppen aller Art und Romanen obskurer Herkunft. Was die zwei überhaupt zusammenlasen! Und mit welchem Ueberschwang in Gefühl und Sprache sie alles wiedergaben, davon sprachen und darüber seufzten!
Der Alte liess das Rosinchen gewähren, ganz wie er das schöne Malchen hatte gewähren lassen, ja er war mit dem werdenden Jungfräulein noch sorgloser, witterte er doch heraus, dass das alles nicht allzu tief sass bei dem Rosinchen: „’s is ä Pubertätsrummel“, sagte er, und schmunzelnd gestand er ein, dass hinter all den Dummheiten ein reeller Kern stecke, ein kalkulierender Kopf, sein Kopf.
Er durfte sie ja nur im Laden sehen! Hinter den Kunden her wie ein Geier die Augen überall, den Vorteil fest in der Hand hatte sie sich jetzt mit ihren vierzehn Jahren schon hinter die Buchhaltung gemacht und führte die Bücher nachdem er sie nur ein wenig eingewiesen, prächtig, sauber, ordentlich und peinlich.
Hier und da gelüstete es ihn, sie ein wenig mit dem Institut zu necken: „Rosinche, es is schad, dass du hast die Wissenschaften nit studieren wolle! Dein Kopf wär danach gewese!“
Da kam er aber schön an! Das war etwas, was sie noch nicht verwunden hatte. Ihr ganzer Zorn auf das Kloster und die Mitschülerinnen und ihre heftige Sehnsucht, so sein zu können, so viel zu wissen und zu gelten wie diese, kam heraus, und sie konnte kein Ende finden mit Schimpfen und Anklagen und Schmähreden, so dass sie der Alte erst mit bösen Worten zurechtweisen musste, ehe er sie dazu bringen konnte, dem Sturzbach ihrer entfesselten Wut Einhalt zu tun. Auch zwischen dem Stöckel, der Line und ihr bewegte sich, wenn auch weniger leidenschaftlich und eruptiv, das Gespräch in ähnlichen Gleisen. Die Line empfand ihre Halbbildung ebenso schmerzlich wie das Rosinche. So hockten die zwei immer wieder beisammen und suchten zu lernen. Bei dem wahllosen Durcheinander ihrer Lern- und Bildungswut wurde die Line immer überspannter und sentimentaler und trug einen Tumult von Gefühlen in dem in das schwarz und blau karierte Kleid eingepressten Busen. Das Rosinchen wurde herrisch und eingebildet und zu Zeiten wenn es die Unzulänglichkeit ihrer Bestrebungen einsah, zänkisch und unleidlich, ja despotisch, und es bedurfte wahrlich der schwärsmerischen Hingabe der Line, die stets zur Bewunderung bereit war, es mit dem Chlonnenchltrählche auszuhalten.
Während sich also die zarten Freundschaftsbande zwischen der kleinen Mahn und dem Stöckel erst im Alter beginnenden Jungfrauentums knüpften, „auf der Schwelle vom Kinde zur Jungfrau“, wie die Line schwärmte hatte ihr keckster und eifrigster Widersacher ihr Verfolger der stets hinter ihnen drein schrie: „Chlonnenchltrählche, süsses Rosinerl, Krinolineline!“, der Held Fritzl natürlich — geboren, zwar nicht im Stalle zu Bethlehem, aber beinahe in einem Stalle und beinahe von einer Jungfrau — sich schon in der ersten Schule, also mit sechs Jahren, seinen speziellen Freund erwählt den hinkenden Maxl.
Und damit tritt der dritte Held auf (o armseliger Held!) — wenn wir die Krinolineline nicht etwa auch als Heldin rechnen wollen — der hinkende Maxl von der Paradeisgass. Dem hinkenden Maxl war es nicht an der Wiege gesungen worden dass er dereinst im Jünglingsalter die Glockenstränge in der Pfarrkirche seiner Vaterstadt ziehen und sich an die Stricke die von den widerspenstigen Blasebälgen der grossen Orgel herabbaumelten würde hängen müssen. Denn er war aus adligem Geblüt und ein paar Stunden lang — oder war es nur eine Viertelstunde? — ausersehen, Herr von Lohberg auf Lohhof zu werden.
Sohn einer bildhübschen Wäscherin und des schon etwas ältlichen Barons von Lohberg, träumte seine Mutter die ausschweifendsten Zukunftsträume für ihn und für sich, denn der Baron, über alle Massen verliebt, hatte ihr so etwas wie die Ehe versprochen.
Aber wie es so geht „wie der Teufel seine Hand im Spiele hat“, wie die kleine Wäscherin sagte, kam es ihr in den Sinn, dem Maxl noch einen Bruder zu schenken, ehe die Ehe mit dem Baron geschlossen, während dieser, um vorher noch einmal seine Freiheit zu geniessen auf Reisen war, und — — — aus war der Traum mit der Baronin.
„Mein liebes Kind nun ist die Chose zwischen uns selbstverständlich ex“, sagte der Baron merkwürdig frostig für ihr Empfinden und sehr Herr der Situation.
Die kleine Wäscherin verstand zwar die Worte nicht ganz genau, Wohl aber den Sinn, und da sie im Augenblick etwas „baff“ war, heiratete sie Hals über Kopf den Schuster, der ihr dazu verholfen hatte, dem Maxl einen Bruder schenken zu können.
Meister Knieriem hatte weiter keine Hochachtung vor dem adligen Sprössling, er behandelte sein eigen Fleisch und Blut nicht gerade zart und passte gleich gar nicht auf wohin die Hiebe fielen, wenn sich’s um den unerwünschten Mitesser adliger Abstammung handelte.
Als ganz kleiner Junge war der Maxl einmal, in heilloser Furcht vor den Hieben des Vaters flüchtend, über das Podium auf dem der Meister thronte, ungeschickt gestürzt, hatte über den Schmerz, den ihm der Sturz verursacht geschwiegen und war nur ein paar Wochen zwischen den Kissen geblieben, weil er nicht laufen konnte. Einen Arzt zu holen, fiel niemanden ein; der Maxl selber hätte sich gewiss nicht getraut, auch nur einen Muckser deshalb zu tun. Als er aufstand, war er der hinkende Maxl und der blieb er all sein Lebtag.
Viel Wesens wurde aus der Hinkerei nicht gemacht, der Alte lachte ihn aus und die Mutter war verwundert.
„Schau schau, jetzt hinkst ja gar“ meinte sie, dann ging man wieder zur Tagesordnung über. Da schon drei Rangen umherliefen und ein Kleines in der Wiege schrie hatte niemand Zeit, sich um solche Lappalien zu kümmern, denn jedes hatte alle Hände voll zu tun. Der Meister musste den ganzen Tag hämmern und klopfen, um die Mäuler all der Menschen und Menschlein zu stopfen, und die Frau musste sich tummeln, um sie leidlich zu waschen und zu bekleiden. Zum ganz Bekleiden langte es sowieso nicht, besonders bei Maxl. Wer würde sich denn auch besonders um den Maxl kümmern?
Er war zwar der Mitverdiener, denn das Kostgeld, das der Baron schickte, war reichlich und traf prompt ein. Aber es kam hauptsächlich den andern zugute, für den Maxl reichte es immer nicht mehr recht.
Von „Montur“ war schon gleich gar keine Rede. Wenn’s nur am Körper hielt, das war das Ausschlaggebende. Ob’s lang oder kurz, dünn oder dick, ganz oder zerrissen war, beschwerte die Gemüter der Eltern nicht; es fiel auch in der Paradeisgass durchaus nicht auf, und dem Maxl selber kam schon gar kein Gedanke darüber. Er wusste ja von nichts anderem, und die übrigen Rangen, die mit ihm im Staub herumkrochen oder im Sand wühlten, oder die hordenweise die Paradeis- und die benachbarte Lange Gasse unsicher machten, sahen um kein Haar anders aus als er; die grössere Anzahl war sogar gekleidet richtig wie im Paradiese, besonders zur Sommerszeit.
Wäre das Gezänk der Weiber und das Geschrei der wilden Paradeishorden nicht gewesen, man hatte wirklich an eine paradiesische Idylle glauben können. so unberührt von dem Leben in den Strassen draussen blieb das kleine Gässchen, an dessen Ende das graue Tor mit dem grotesken Spitzdach stand, flankiert von den Stadtmauern mit ihren Schiessscharten und alten Kugelnarben Ueber die Mauern schauten die grünen Alleebäume; es sah aus, als ob es immer so weiter ginge im Grünen. Von fern hörte man das Gemurre des Stadtbaches an dem Wehr der Obermühle, ein Wagen kam nie durch die Gasse, dazu war das Pflaster zu holperig und der Weg zu eng. Wie in einem Dorf, so leer und still konnte es zu Zeiten aussehen, wenn die Kinder des Paradieses gefüttert wurden und die Megären, die die Wächter dieses Edens ohne flammende Schwerter darstellten, auch mit dem Munde etwas anderes zu tun hatten als einander oder einen ahnungslosen Fremdling, der sich hineinverirrte, durchzuhecheln.
Die Tage glichen sich, und der Anblick eines fremden Gesichtes, sei es Mann, Weib oder Kind, versetzte die ganze Paradeisgasse in Aufruhr.
Wie gross war erst der Aufstand, als einmal am Eingang der Gasse ein Wagen hielt und Versuche machte, in das enge, gewundene Gässchen mit seinem buckligen Pflaster einzudringen! Nicht nur ein Wagen war’s, en gewöhnlicher Wagen, nein, eine Herrschaftskutsche mit einem Wappen an der Tür, einem feinen Kutscher auf dem Bock und einem Diener, der einen rehfarbenen Rock anhatte bis auf den Boden hinunter, der den Wagenschlag öffnete und ein „Buckerl“ machte so tief, wie man’s gewiss nur vor „Heil unserm König Heil“ tat!
Im Nu wimmelte es wie in einem Ameisenhaufen in dem engen Gässchen, im Nu waren alle Fenster geöffnet, obwohl es schon herbstlich kühl war und der Wind die dürren Blätter von den Bäumen herein bis vor die Türschwellen wehte.
„An Eklibasch,“ schrien die Rangen und tanzten auf und ab, und die phantasiereicheren riefen: „A königliche Eklibasch!“ Alle Fenster waren besetzt, ungewaschene alte und junge Weiber mit strähnigem Haar hingen heraus, sämtlich in farbigen Nachtkitteln, wer zur Hautvolée des Paradieses gehörte, wohl auch in weissen, was immer etwas gemissbilligt wurde, weil es Ueberhebung anzeigte.
Wie ein Lauffeuer ging es durch die Gasse: „Zum Schuaster Greiner wollen’s!“, denn nach dem hatte der Bediente gefragt, und da einer der Buben des Meisters gerade auch anwesend war, lief der wie besessen die Gasse hinunter, heim, und schrie gleich zur Haustür herein: „Laou dir sag’n, Vater, an Eklibasch kimmt zu uns!!“
Der Meister, der der Märe nicht traute, trat kopfschüttelnd vor das Haus, aber die Mutter, ahnungsvoll, käsweiss vor Aufregung und gerade in keiner Verfassung, die sie zur Hautvolée der Paradeisgasse stempelte, kriegte den überraschten Maxl beim Grips, zog ihn aus dem Laden in die Nebenstube, wo sie zuerst ganz entgeistert hin und her rannte und ihm nur immer mit ganz veränderter, fast heiserer Stimme zurief: „Maxl, jetza nimm di z’samm, jetza nimm di z’samm!“
Der Maxl, verschüchtert durch das aufgeregte und ungewohnte Wesen der Mutter, stand steif wie ein Opferlamm, liess sich die Kleider stückweise vom Leibe reissen — allzuviel waren es ja nicht —, liess sich die Sonntagshose des kleineren Bruders anziehen, er selbst besass keine, in die Joppe einpressen, die ihm am Halse mit fieberhaften, aber dennoch resoluten Fingern zugehakt wurde, obwohl es viel Kraft kostete, denn der Stehkragen war zu eng, und der Hals ergab sich erst, nachdem er einige Falten gemacht. Freilich fuhr der Maxl sofort mit zwei Händen nach oben, aber die Mutter drohte: „Du untersteh di nur!“, ganz leise sagte sie’s, den draussen hörte man schon fremde Stimmen, aber ihre Augen sahen dabei aus, als wollten sie den Maxl an die Wand nageln.
Dann wurden ihm die „Haferlschuh“ eben desselben Bruders an die Füsse gezwängt, dass die groben, grauen Wollstrümpfe mit zwei traurigen Blasen über den Rand der Schuhe standen. Die Mutter erwischte in ihrem Hin- und Herlaufen einen Lappen, mit dem sie ihm übers Gesicht fuhr, wobei sie besonders die Nase aufs Korn nahm. Da aber durch irgendeinen Zufall der Lappen voll Sand war, protestierte der Marl was leider zur Folge hatte, dass nur noch hingebender gescheuert wurde, bis ein seltener und intensiver Glanz auf seiner graugelben Haut erschien. Ferner schwebte noch, zwar kein Damoklesschwert, aber ein grobzähniger Kamm über seinem Haupte, dessen Zähne sich mit solcher Vehemenz in seine sarblosen schütteren Haare eingruben, wie wenn sie Furchen im Kopf zu hinterlassen bestimmt wären
Da ward auch die Tür schon aufgetan und Meister Greiner mit rotem, konfusem Gesicht und zerwühltem Haar darüber rief herein:
„Den Marl möchten die Herrschaften sehen, tua ihn ausser, Lieserl!“
Das Lieserl die Meisterin, schob den Marl vor sich her und getraute sich in der Stube gar nicht, die Augen aufzuschlagen. Nur von unten her warf sie die Blicke nach der anwesenden stattlichen Dame, deren Röcke bei jeder Bewegung wie Seide knisterten, während sie doch erstaunlicherweise nur ein hellgraues Wollkleid trug: noch ängstlicher schaute sie auf den Herrn, den sie beinahe nicht mehr erkannt hätte, dessen Haar schon dünn und dessen Bart grau geworden war.
„Ach Gott! Ach Gott!“ Die Tränen stürzten ihr aus den Augen und fieberisch und dabei unbeholfen, in Seelennot und Spannung wischte sie Stuhl um Stuhl mit der Schürze ab, in fliegender Hast und in der Pose: „O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehest unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort“, doch niemand machte Miene die Stühle benutzen zu wollen, und niemand achtete ihrer, nachdem die Baronin einmal einen kleinen malitiösen Seitenblick nach ihr getan.
Vor der Tür stand der Bediente Schildwache, damit die Menge, die die vornehmen Herrschaften bis dahin begleitet hatte, nicht hereinflute.
Der Meister hatte jetzt ganz die Stellung eines Impresario angenommen, gefasst, würdig, fast überlegen, seit er sich von der tadellosen Equipierung des Maxl überzeugt hatte.
Maxl selbst, der Held des Ganzen, stand mit einer Armensündermiene mitten in der Stube vor der seidenrauschenden Dame und dem fein duftenden Herrn; er hatte das deutliche Gefühl, dass man ihm im nächsten Augenblick die Joppe aufknöpfen und dass dann sein wüstes, schmutziges und zerschlissenes Hemd offenbar würde.
Darum starrten seine wasserblauen Augen angstvoll auf die grosse, starke Dame, während die roten, knotigen Kinderhände mit den knochigen Gelenken, die viel zu weit aus den kurzen Joppenärmeln heraussahen, sich hilflos an der Hose einzuhalten suchten.
Die stattliche Baronin ging wortlos um ihn herum.
Ja, da stand er, recht wie ein verscheuchtes, verprügeltes Hündchen, das verkauft werden soll und das man gern besser machen möchte, als es wirklich ist. Er senkte wie schuldbewusst den schmalen, melancholischen Kopf.
„Listig, feige, verschlagen“, konstatierte die Baronin, und „Aehnlichkeit?“ — sie zuckte die Achseln und, ihr langstieliges Lorgnon vor die Augen haltend, tippte sie mit der linken Hand auf Maxls Schulter, ein paarmal, ermunternd zuerst und dann energisch, dass er sich drehen möge.
Ungeschickt, hinkend und humpelnd tat er’s endlich, da brach sie in ein belustigtes Lachen aus, denn sie war eine Dame von Humor, schüttelte amüsiert den Kopf, prustete noch ein bisschen und sagte dann:
„Edgar, ich bitte dich, schau ihn doch genau an! Das ist Rasse! Hast du noch Lust?“
Der Baron machte eine geringschätzige Bewegung mit der rechten Hand, deren Fläche er etwas nach aussen hob nachdem er einen Anlauf, die Achseln zu zucken, aufgegeben hatte, verzog den Mund, ohne ihn zu öffnen und ging, seinen Hut etwas mehr in die Stirne rückend. Das war sein Abschiedsgruss dem Meister und der Meisterin gegenüber, während die Baronin da Lorgnon fallen liess, das fette weisse Kinn auf die Brust drückte und lächelnd, ein paarmal nickend, an dem Bedienten vorbei, der mit unergründlichem Gesicht die Schusterstür offen hielt wie die eines Salons, rauschend und grüssend abzog, durch das Volk des Paradieses, das vor ihr fast Spalier gebildet hatte und hinter ihr drein lief, bis sie in dem dunkelblauen Wagen mit dem feurigroten Wappen verschwunden war; fast hätte man ihr noch ein „Hoch“ nachgerufen.
Drinnen schüttelte sie amüsiert, ein bisschen spöttisch dazu den Kopf. Die Adoption war also gründlich misslungen und sie wollte eben dem Gatten eine scherzhafte Bemerkung darüber machen, als sie sah, dass er die Augenbrauen finster und geärgert zusammenzog; da schwieg sie, denn sie war nicht nur eine Dame von Humor, sondern auch von Takt, und die Hände in den tadellosen grauen Dänen faltend, legte sie sich im Coupé zurück, gähnte ein paarmal und blieb im Halbschlaf, bis der Wagen wieder hielt.
*