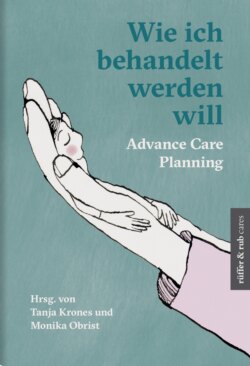Читать книгу Wie ich behandelt werden will - Andreas Weber, Anna Gerber - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAuch unser
Tipi ist ein
guter Ort zum
Sterben
Von Christina Buchser
Nein, bei mir wurde keine lebenslimitierende Krankheit diagnostiziert. Ich bin gesund, stehe mitten Leben. Warum schenke ich mir eine ACP-Beratung, obwohl kein äußerer Anlass besteht? Auf eine Geburt bereitet man sich vor. Warum nicht auch aufs Sterben und den Tod? Solche Gedanken gehen mir durch den Kopf, wenn ich mir die Zeit nehme, um über das Leben nachzudenken. Wenn ich mir Zeit nehme festzuhalten, wo ich stehe, was ich mir wünsche und welches meine Werte sind, sodass sie im Fall der Fälle nachzulesen sind. Mache ich das aus Angst? Nein, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Vielmehr halte ich meinen mutmaßlichen Willen fest, weil mir die Erfahrung zeigt, wie wichtig das Wissen darum für andere – Angehörige und Freunde – ist.
Vita brevis
»Du weißt, dass du morgen stirbst. Was fühlst du bei diesem Gedanken?« Diese Frage schon bald nach Beginn der ACP-Beratung geht ans Eingemachte. Das gefällt mir. Vita brevis, denke ich. Das Leben ist kurz. Das erste Gefühl: Trauer. Das zweite: Neugier. Trauer darüber, alles loslassen zu müssen. Das fällt mir tatsächlich nicht leicht. Und doch ist da auch diese mir angeborene Neugier. Ich wollte – seit ich weiß – den Dingen auf den Grund gehen, wollte, und will noch heute, wissen, was ist. Sterben und Tod sind davon nicht ausgenommen. Ist Sterben ein unbewusster Prozess wie geboren werden? Oder kann man Sterben bewusst erleben, ja gar gestalten? Ist der Tod das Ende der Fahnenstange? Meine Erfahrungen mit Sterbenden sind positiv, was mir die Angst nimmt, mich mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Mir ist aber durchaus klar, dass nicht alles planbar ist. Das Leben steckt voller Überraschungen, und denen will ich auch genügend Raum lassen. Wenn ich aber meine Wünsche und Bedürfnisse in Sachen Sterben äußern und festhalten kann, so will ich das tun.
Vorwürfen ausgesetzt
Ich erinnere mich gut daran, als mein Vater – müde vom strengen Arbeiten und langen Leben – aufgrund eines Sturzes mit einer Rückenverletzung im Spital lag. Ein junger, engagierter Chirurg drängte, diese Verletzung unbedingt zu operieren. Meine Nichte, diplomierte Pflegefachfrau, entgegnete mutig, dass man diese Verletzung durchaus konservativ behandeln könne. Der Arzt deckte uns, meine älteste Schwester und mich, reichlich mit Vorwürfen ein, was wir für schlechte Töchter und dem Vater nicht wohlgesinnt seien. Da standen wir nun und wussten nicht, wie wir »richtig« handeln sollten. Vom Vater wussten wir, dass er sehr müde war. Seit dem Tod meiner Mutter fünf Jahre zuvor war er zwar nicht mehr aktiv dem Leben zugewandt, aber keineswegs war er suizidal. Er war einfach altersentsprechend müde. Er hatte eine Patientenverfügung. Darin war aber einzig zu lesen, dass er keine lebensverlängernden Maßnahmen wünsche. Was nun?
»Falls ich ein Pflegefall werden sollte …«
Ein anderer, prägender Moment in meinem Leben war vor wenigen Jahren. Das Haus voller Freunde, ließ mich mein Mann mit unseren Gästen allein, legte sich aufs Sofa und sagte: »Ich fühle mich so erschlagen, ich muss mich hinlegen, mein Schädel zerplatzt nächstens.« Außergewöhnlich für meinen sonst so schmerzresistenten Mann! Vielleicht eine Grippe? Tags darauf – natürlich war es ein Sonntag – handelte ich: Ich fuhr mit Adrien in den Notfall, obwohl er partout nicht wollte. Meningitis? Herpes? Oder was? Die Symptome waren vielfältig, die Unsicherheit groß. Die Diagnosestellung ließ lange auf sich warten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hing Adriens Leben an einem seidenen Faden. Etwas, dass nur uns beiden bewusst war. »Geh jetzt bitte, ich halte vor lauter Schmerzen niemanden aus«, schickte mich Adrien nach Hause. Und: »Du weißt, falls ich jetzt sterbe, ist das okay.« Ein Abschied. Für immer? Ein Moment, kaum aushaltbar.
Er überlebte die Nacht, aber es dauerte bis Donnerstag, bis die Diagnose klar war: FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) aufgrund eines Zeckenbisses. Adrien konnte nicht mehr richtig gehen, schreiben ging gar nicht mehr, seine Kommunikation war die eines anderen, nicht von dem Mann, den ich kannte. Würde er genesen, würden Schäden, würden Persönlichkeitsveränderungen bleiben? Die Zukunft war ungewiss. Hatten wir, außer dem tiefen Vertrauen, dass sich alles – auch Sterben – zur rechten Zeit ereignet, etwas Schriftliches? Irgendetwas, wo er – nicht nur für mich, sondern auch für seine Töchter, Schwestern und Eltern – seine Wünsche und Werte geäußert hätte? Nein, nur Adriens mündliche Anmerkung an mich: »Falls ich je ein Pflegefall werden sollte, so habe ich keine Ansprüche an dich, dass du mich pflegen musst. Du kannst mich in ein Pflegeheim geben. Und, falls ich sterbe: Bitte bleib nicht lange allein. Such dir wieder einen Mann, gehe wieder eine Partnerschaft ein.«
Weil ich eine Familie habe
Ich selbst trug mich schon seit Längerem mit dem Gedanken, eine Patientenverfügung zu verfassen. Doch alle Verfügungen, die mir bisher bekannt waren, entsprachen nicht meinen Vorstellungen. Für mich waren sie zu wenig differenziert, zu wenig persönlich. Wo konnte ich meine Wünsche so festhalten, dass sie verständlich und vor allem auch rechtskonform sind? Nicht dass ich eine pathetische Seite hätte, aber es liegt mir tatsächlich am Herzen, wie ich mein Leben in seinen letzten Zügen gestalten möchte. Auch die Verbindlichkeit und Umsetzbarkeit sind eine nicht zu vernachlässigende Sache, ich habe sowohl in meinen beruflichen Funktionen als auch privat zu viele nicht wirklich verbindliche Patientenverfügungen gesehen, und was daraus resultiert: Unsicherheit. Und dies nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für die Fachleute. Es muss also eine verbindliche Lösung geben, die dennoch meine persönliche Handschrift trägt.
Im Sommer 2018 las ich erstmals von Advance Care Planning, und je mehr ich darüber las und mit Leuten sprach, die eine ACP-Beratung in Anspruch genommen hatten, desto mehr kam ich zum Schluss: Das passt, das mache ich auch. Denn zusätzlich zu diesen beiden einschneidenden Erlebnissen häuften sich auch zahlreiche Todesfälle in meinem unmittelbaren Umfeld. Das führte mir vor Augen: Man weiß nie, wann man stirbt. Warum also zögern? Und so machte ich mir die ACP-Beratung zum Geschenk. Auf die Frage, warum ich – gesund, wie ich bin – eine ACP-Beratung in Anspruch nehme, kommt mir das Zitat von Dr. Ira Byock in den Sinn: »I have a healthcare directive not because I have a serious illness, but because I have a family.« Ich habe ein Patientenverfügung – nicht weil ich ernsthaft krank wäre, sondern weil ich Familie habe.
Ohne schriftliche Handhabe war nichts dagegen zu machen
Mit Unterstützung des Hausarztes brachten wir unseren Vater vom Spital zurück ins Pflegeheim. Ich war sehr froh, den Hausarzt an unserer Seite zu haben. »Ich hätte Ihren Vater schon viel früher wieder verlegt. Das Spital ist nicht der Ort, wo er sein möchte«, brachte er es auf den Punkt. Der Hausarzt kannte meinen Vater schon viele Jahre. Daher wusste er auch um die zahlreichen Zwischentöne, die zwischen »gesund«, »krank«, »lebensmüde« und »sterben« in der Biografie meines Vaters mitschwangen. Während mich mein Vater im Spital noch erkannt, ja sogar noch das eine oder andere Wort mit mir gewechselt hatte, zog er sich – wieder im Pflegeheim – immer mehr in sich zurück. Er war sterbend. Für mich passte das so, wir hatten zuvor alles besprochen, Worte waren nicht mehr nötig. Wir sprachen mit unseren Herzen. Doch was tun, wenn sich Familienangehörige über Vaters expliziten Wunsch, keinen Pfarrer an seinem Sterbebett haben zu wollen, hinwegsetzen? Diesen Wunsch hatte er nur mündlich uns Kindern gegenüber geäußert. Das sind Momente, die vermutlich etliche kennen: In solchen Ausnahmesituationen benehmen sich Menschen nicht immer so, wie sie es eigentlich könnten, sondern handeln oftmals wenig klar und ihren eigenen Gefühlen ausgeliefert. Aber trotzdem!, dachte ich damals. Es wäre schon schön gewesen, seine Wünsche zu achten und zu befolgen – aber ohne schriftliche Handhabe war da nichts zu machen.
»Gell, wir können nichts tun? Nun, aber beten können wir«
Einer der schwierigsten Momente war für mich, Adriens Familie klarzumachen, dass er keinen, aber auch wirklich keinen – auch mich nicht! – sehen wollte. »Bitte halte mir alle vom Leib«, war seine große Bitte an mich. Er hatte während des Spitalaufenthalts noch stärkste Schmerzen, sodass ihm am wohlsten alleine war. An Adriens Wunsch, allein zu sein, sollte sich auch während des anschließenden sechswöchigen stationären Reha-Aufenthalts kaum etwas ändern. Was für mich, seine Eltern und seine Geschwister leistbar war, war für seine erwachsenen Töchter kaum auszuhalten. Vor allem für seine jüngere Tochter nicht, sie arbeitete ja in genau dem Spital, in dem ihr Vater Patient war. Sie besuchte ihn täglich, bis ich einschritt und auf Adriens Autonomie pochte, die gewahrt werden sollte: Kein Besuch! Mir war in diesem Moment bis ins Innerste bewusst, dass ein Schwerkranker so sehr ausgeliefert ist, dass andere – in diesem Falle ich – für ihn und seine Bedürfnisse einstehen müssen. Dass ich Adriens zweite Frau und nicht die Mutter seiner Töchter bin, machte die Situation nicht einfacher. Denn so sehr ich den Wunsch der Töchter nach Nähe zum Vater verstand, so sehr verstand ich Adrien, dass er alleine sein wollte. Wie froh wäre ich um etwas Schriftliches gewesen! Konflikte ließen sich in solchen Ausnahmesituationen schnell entschärfen. Was mir in dieser Zeit enorm half, war die tägliche Mediationspraxis. Als praktizierende Diamantweg-Buddhistin habe ich über die Jahre gelernt, meinen Geist weit werden zu lassen und so bestmöglich nicht auf die aufsteigenden Gefühle aufzuspringen, sondern sie vorbeiziehen zu lassen. Dieses Aushalten, wenn man nichts tun kann, außer abwarten, ist eine große Herausforderung. Die Worte von Adriens Mutter diesbezüglich waren Balsam: »Gell, wir können nichts tun? Nun, aber beten können wir.« Sie verstand es als eine der wenigen, das in klare Worte zu fassen, um was es ging. Grenzerfahrungen bieten viel Erfahrungsspielraum für Spiritualität. Heute weiß ich, dass auch eine erweiterte Patientenverfügung Raum dafür bietet, das festzuhalten, was man sich in Grenzmomenten wünscht.
Wo ACP draufsteht, soll auch ACP drin sein
Bei der Suche nach der passenden ACP-Beratung war mir vor allem wichtig, dass sie von einer qualifizierten Fachperson gemacht wird. Ich wollte keine »verwässerte« oder »leicht adaptierte ACP«, sondern dass »wo ACP draufsteht, auch ACP drin ist«. Ich habe recherchiert und mich umfassend informiert. Fündig wurde ich bei palliative zh+sh, genauer gesagt bei ihrer Geschäftsführerin Monika Obrist. Mit ihr habe ich die Fachperson gefunden, die meinen Anforderungen entspricht: Auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, engagiert und vernetzt mit weiteren Fachleuten und gesegnet mit einer großartigen Beratungskompetenz. Sehr wichtig war mir auch, dass ich alles fragen kann, was mich beschäftigt oder wo ich Unklarheiten habe. Fragen wie zum Beispiel »Wie stirbt man an einer Lungenentzündung?« Meine Erwartungen in der Beratung bei Monika Obrist wurden vollumfänglich erfüllt. Kein einziges Mal hat sie Suggestivfragen gestellt und kein einziges Mal hat sie meine Antworten kommentiert oder gewertet. Vielmehr hat sie einfach das entgegengenommen, was ich gesagt habe, es aufgeschrieben oder nachgefragt, bis sie meine Antworten richtig verstanden hatte und entsprechend in der Patientenverfügung erfassen konnte. Das sei in einer ACP-Beratung so üblich, erklärte sie mir auf mein Nachfragen hin. Was ich an dieser Patientenverfügung «plus» sehr gut finde, ist, dass ich darin meine Werte festhalten und dass ich an ihr jederzeit Änderungen oder Anpassungen vornehmen kann. Auch schätze ich, dass die Fragen nicht auf Ja oder Nein ausgerichtet sind, sondern dass sie der Ambivalenz, die mit dem Sterben einhergehen kann, genügend Raum lassen, ohne dass deswegen meine Aussagen unbrauchbar wären. Das zeichnet die Patientenverfügung «plus» aus, das macht es möglich, dass sich darin mein Wille ganzheitlich widerspiegelt.
Er habe keine Angst gehabt
Mein Vater starb altershalber knapp einen Monat nach der Diagnose seiner Rückenverletzung. Wir hatten uns gegen eine Operation ausgesprochen und beschlossen, ihn konventionell behandeln zu lassen, mit Schmerzlinderung als oberstes Gebot. Sein Hausarzt unterstützte uns, ebenso das Team des Pflegeheims. Diese Tage waren äußerst wertvoll für mich. In seiner zweitletzten Nacht wachte ich an seinem Bett. Er erkannte mich nicht mehr. Ich schlief wenig, schaute dann und wann zu ihm, saß einfach da und formulierte in meinem Inneren gute Wünsche für ihn. Zwischendurch kam eine Pflegefachfrau und wollte dies und das wissen, ansonsten war es still. Ich war froh um diese Stille – Abschiednehmen geht leichter, wenn es ruhig ist. Er lebte noch eine weitere Nacht, bevor er am 30. Juli just zum 11-Uhr-Glockenschlag aufhörte zu atmen. Er war nicht alleine, eine feinfühlige Pflegefachfrau war bei ihm, begleitete ihn still und leise – er habe keine Angst gehabt, hat sie mir gesagt.
Für uns Töchter wäre einfacher gewesen, wenn wir klarere Anweisungen seitens des Vaters gehabt hätten. Dieses sich für den Vater wehren müssen, Mutmaßungen anstellen, was wohl das Richtige ist und was nicht, ist überaus anspruchsvoll und ungewiss. So haben wir vor allem auf unsere Herzen gehört, um den mutmaßlichen Willen des Vaters umzusetzen. Rückblickend kann ich sagen: Es ist uns gelungen. Doch immer muss man das Schicksal ja nicht herausfordern.
So viel Freiheit wie möglich, so wenig Begrenzung wie nötig
Adriens Genesungsprozess dauerte zwei Jahre. Er kann wieder in einer Führungsposition tätig sein. Kleinste gesundheitliche Beeinträchtigungen sind geblieben. Diese kommen aber nur bei Übermüdung zum Vorschein, und nur wir beide erkennen sie als solche. Wie viele andere Paare haben auch wir aufgrund von Adriens Erkrankung eine enorm intensive Phase hinter uns. Während Adrien wieder bei Kräften ist, bin ich noch immer etwas müde. Die Anstrengungen waren groß. Im Rückblick kann ich aber sagen: Es steht außer Frage, ich würde erneut so handeln, wie ich es tat. Für mich selbst habe ich zusätzlich entschieden, meine Wünsche und meinen Willen festzuhalten. Die Erfahrung zeigt, dass vage und vor allem nur mündliche Bekundungen nur wenig nützlich sind. Zu viele schwierige Entscheidungen bleiben den Angehörigen überlassen. Dass man nicht alles ins kleinste Detail regeln kann, ist mir bewusst und aus meiner Sicht auch nicht nötig. Dem Leben soll ja immer genügend Platz eingeräumt werden – und dieses ist bekanntlich nicht immer gradlinig. So viel Freiheit wie möglich, so wenig Begrenzung wie nötig. So stelle ich mir den Inhalt meiner Patientenverfügung vor.
Ideen, wo ich sterben könnte
Die Differenziertheit, mit der wir in der ACP-Beratung die drei möglichen Situationen der Urteilsunfähigkeit bei einem Notfall, schwerer Krankheit oder chronischer Krankheitssituation angegangen sind, hat mich beeindruckt. Und auch hier: Kein verwundertes Nachhaken, als ich sagte, dass es meine Haltung ist, dass man auch mit einem versehrten Körper ein ganzer Mensch ist, dass jeder Lebensmoment wertvoll ist und man jeden nutzen kann, um Sinnvolles zu tun. Auch die Frage, wo ich sterben möchte, gefällt mir. Ich habe Ideen, wo das sein könnte: Zum Beispiel zu Hause im Wohnzimmer mit Blick auf die Toggenburger Berge. Der Blick in die Weite ist mir wichtig. Oder in unserem Tipi, irgendwo in den Schweizer Bergen, abseits aller Touristenströme. Sollte das dereinst nicht möglich sein, so will ich meinen Angehörigen und Freunden das Leben nicht schwer machen, sondern es soll einfach alles im Rahmen des Möglichen geschehen: Ein Spital, ein Pflegeheim oder ein Hospiz passen für mein Sterben ebenfalls. Denn ich weiß, dass da engagierte Menschen arbeiten und ihr Bestes geben. Auch ich werde dereinst mein Bestes geben.