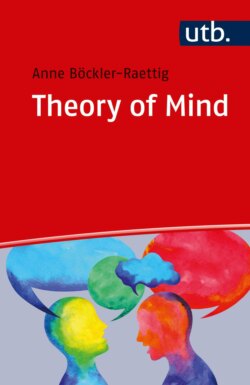Читать книгу Theory of Mind - Anne Böckler-Raettig - Страница 9
ОглавлениеHauptteil
Was ist Theory of Mind?
1
Theory of Mind, das Nachdenken über die mentalen Zustände unserer Mitmenschen, ist ein zentraler Aspekt sozialen Erlebens und Handelns. Das folgende Kapitel zeichnet die Entwicklung des Theory of Mind-Begriffs in der empirischen Forschung nach und grenzt ihn von verwandten sozialen Funktionen wie Empathie, Mitgefühl, räumlicher Perspektivübernahme und Metakognition ab. Der aktuelle Forschungsstand zu den neuronalen Grundlagen und den an Theory of Mind beteiligten kognitiven Prozesse wird zusammengefasst. Abschließend soll ein Überblick über persönliche und situative Faktoren gegeben werden, die mit der individuellen Motivation und / oder Fähigkeit zu Theory of Mind in Zusammenhang stehen.
Lebewesen zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, mit ihrer Umwelt zu interagieren. Die Umwelt von uns Menschen besteht nun maßgeblich aus anderen Menschen; Gelegenheiten – und die Notwendigkeit – zu sozialer Interaktion sind also allgegenwärtig. Wenn wir mit Anderen kommunizieren und kooperieren, sei es beim gemeinsamen Tragen eines Sofas während unseres Umzugs oder beim Planen eines Urlaubs, spielen nicht nur unsere eigenen Gedanken, Absichten und Überzeugungen eine Rolle, sondern auch die des Anderen. Weiß meine Bekannte, dass ich das Sofa kippen will, bevor wir das enge Treppenhaus betreten? Bedenke ich, dass mein Partner wegen seines Heuschnupfens lieber im Herbst verreisen möchte? Was vermutet meine Mutter, dass ich über ihre Meinung zu meiner Berufswahl weiß?
Der Versuch, die mentalen Zustände Anderer zu erschließen und über diese nachzudenken, wird als Theory of Mind (ToM) bezeichnet. Um die verschiedenen Facetten dieses Begriffes besser verstehen zu können, werden im Folgenden die Hintergründe der psychologischen Forschung zu ToM aufgezeigt.
Hintergrund und Definition
Die empirische Forschung zu ToM hat ihren Ursprung in der Frage, welche Lebewesen sich selbst und Anderen überhaupt mentale Zustände zuschreiben. In diesem Zusammenhang bezeichnet ToM das Verständnis, dass Individuen geistige Zustände haben, z. B. Überzeugungen und Absichten, die zum einen ursächlich für ihr Verhalten sind und die sich zum anderen zwischen Individuen unterscheiden können. Eine Person hat also eine ToM, wenn sie versteht, dass der Student, der die Dozentin im Büro vermutet, und die Studentin, die die Dozentin in der Kantine vermutet, jeweils an unterschiedlichen Orten nach ihr Ausschau halten werden (unabhängig davon, wo sie sich tatsächlich aufhält). Die ersten Untersuchungen zielten darauf ab, herauszufinden, wer dieses Verständnis, also eine ToM, besitzt. Premack und Woodruff (1978) erforschten beispielsweise, ob Schimpansen bei Menschen mentale Zustände erkennen und deren Verhalten entsprechend vorhersagen können (siehe Studienbeschreibung Premack / Woodruff 1978).
Studie
„Does the chimpanzee have a Theory of Mind?“
(Premack / Woodruff 1978)
In ihrem Artikel „Does the chimpanzee have a Theory of Mind?“ gingen David Premack und Guy Woodruff der Frage nach, ob Schimpansen Menschen Absichten zuschreiben können. Dafür zeigten die Autoren der 14-jährigen und bei Menschen aufgewachsenen Schimpansin Sarah kurze Videosequenzen, in denen Menschen mit verschiedenen Problemen konfrontiert waren, u. a. mit außer Reichweite befindlichen Nahrungsmitteln, mit abgeschlossenen Türen oder mit nicht angeschlossenen elektrischen Geräten. Unmittelbar nach jedem Video legten die Forscher der Schimpansin mehrere Fotos vor, wobei nur eines der Fotos den zur Lösung des Problems notwendigen Gegenstand abbildete. Die Ergebnisse zeigten, dass Sarah überzufällig häufig das jeweils richtige Foto auswählte. Premack und Woodruff schlussfolgerten, dass Schimpansin Sarah den in den Videos abgebildeten Personen Handlungsabsichten zuschrieb und so deren Verhalten entsprechend vorhersagen konnte (Premack / Woodruff 1978).
Ganz ähnlich war auch die Forschung zu ToM bei Kindern zunächst auf die Frage ausgerichtet, ob und in welchem Lebensalter Kinder die Einsicht erlangen, dass andere Personen mentale Zustände haben, die von ihren eigenen mentalen Zuständen abweichen können (Perner / Wimmer 1985). Diese Art der Fragestellung sieht ToM als eine Reihe von Konzepten und Kenntnissen, die man entweder hat oder nicht hat.
Nachdem hier spannende Einsichten gewonnen wurden (siehe auch Kapitel 3 und Kapitel 6), hat sich der Fokus wissenschaftlicher Forschung zunehmend auf die Frage gerichtet, wie das Verstehen der mentalen Zustände anderer Individuen eigentlich funktioniert. Welche kognitiven Prozesse laufen ab, während wir erschließen, was Andere denken, wissen, wollen und mögen? Vor diesem Hintergrund wird ToM also weniger als etwas verstanden, das man hat, sondern vielmehr als etwas, das man tut. Die Definition von ToM als der Versuch bzw. der Prozess, die mentalen Zustände Anderer zu erschließen, hat inzwischen relativ breite Akzeptanz gefunden (Apperly 2012). Dieser Ansatz bietet die Grundlage für Untersuchungen von ToM über die komplette Lebensspanne hinweg und erlaubt die präzise Erforschung der neuronalen, kognitiven, situativen und persönlichen Faktoren, die beim Verstehen anderer Menschen eine Rolle spielen.
Definition
Theory of Mind ist der Versuch, zu verstehen, was Andere denken, wissen, glauben, wollen, planen oder mögen. Theory of Mind bezeichnet also den Prozess, die mentalen Zustände Anderer zu erschließen und über diese nachzudenken.
Gängige synonyme Bezeichnungen für ToM in der wissenschaftlichen Literatur sind Mentalisieren (mentalizing) und kognitive Perspektivübernahme. Umgangssprachlich beschreiben auch die Termini „sich in jemanden / jemandes Lage hineinversetzen“, „jemandes Blickwinkel einnehmen“ oder „sich in jemandes Schuhe stellen“, was wir unter ToM verstehen.
Das Erschließen der mentalen Zustände unserer Mitmenschen ist in vielfältigen sozialen Konstellationen relevant und spielt z. B. eine Rolle für
■ Ironie (Hier müssen wir verstehen, dass eine Person etwas anderes denkt, als sie sagt.)
■ Small Talk (Hier müssen wir verstehen, dass unser Gegenüber nicht die ehrliche, sondern die einfache und / oder unterhaltsame Antwort auf ihre Fragen erwartet.)
■ Taktgefühl (Hier müssen wir verstehen, worüber unser Gesprächspartner lieber nicht sprechen oder was er nicht hören möchte.)
■ Verhandlungen (Hier müssen wir verstehen, zu welchen Kompromissen unsere Verhandlungspartnerinnen bereit sind und mit welchen Zugeständnissen von unserer Seite sie zufrieden wären.)
■ Bluffen (Hier müssen wir im Bewusstsein halten, dass die getäuschte Person etwas glaubt, von dem wir selbst wissen, dass es nicht wahr ist.)
■ das Führen eines Teams (Hier müssen wir u. a. verstehen, wer wodurch motiviert werden kann und wie viel Freiraum bzw. Anleitung die verschiedenen Mitarbeiter benötigen.)
■ das Eingehen und Aufrechterhalten von Beziehungen (Hier müssen wir nachvollziehen, was das Verhalten unserer Freundin über ihre Ansichten und Absichten aussagt und welche Auswirkungen unser eigenes Verhalten auf unsere Freundin hat.)
Die Komplexität der ToM-Anforderungen kann natürlich je nach Situation variieren und man spricht häufig von verschiedenen Stufen oder Levels der kognitiven Perspektivübernahme. Die erste Stufe beschreibt dabei das Nachvollziehen eines mentalen Zustandes der Form „A glaubt (oder weiß, will, plant, etc.) x“. Die zweite Stufe hat entsprechend die Form „A glaubt (...), dass B möchte (oder weiß, will, plant, etc.), dass x“, die dritte Stufe beschreibt „A glaubt (...), dass B möchte (...), dass C denkt (oder weiß, will, plant, etc.), dass x“ und so fort (siehe Abbildung 1). Im Durchschnitt können Erwachsene derartige Aussagen bis zur vierten Stufe relativ problemlos nachvollziehen (Kindermann et al. 1998).
Abb. 1: Beispielhafte Darstellung von ToM der Komplexitäts-Stufen 1, 2 und 3
Abgrenzung
Während unserer vielfältigen und allgegenwärtigen Interaktionen nutzen wir nicht nur ToM, sondern auch andere Zugänge, um das Verhalten unserer Mitmenschen zu deuten und unsere eigenen Handlungen entsprechend anzupassen. Es ist daher sinnvoll, diese Prozesse (beispielsweise Empathie und räumliche Perspektivübernahme) kurz zu benennen und vom ToM-Begriff abzugrenzen. Dabei gilt es zu bedenken, dass in der reichhaltigen Literatur zu sozialer Kognition unterschiedliche Definitionen und Kategorisierungen der Mechanismen sozialen Verstehens existieren. Die folgende Klassifikation ist also eine gängige, aber nicht die einzige. Zudem ist es wahrscheinlich, dass die unterschiedlichen sozio-emotionalen und sozio-kognitiven Prozesse nicht strikt getrennt voneinander ablaufen, sondern auf vielfältige Weise miteinander interagieren können (Kanske et al. 2016).
Empathie
Wenn es darum geht, unsere Mitmenschen zu verstehen, spielen neben dem kognitiven Zugang, der ToM, vor allem auch emotionale Prozesse eine Rolle. Ein intuitives Verständnis dafür, wie es Anderen geht, erlangen wir durch Empathie (Lipps 1907). Wenn wir sehen, wie andere Menschen körperlichen Schmerz erleiden, spüren wir diesen förmlich am eigenen Leib. Ebenso fühlen wir uns direkt und ohne bewusste Anstrengung in Personen ein, die Trauer, Wut oder Freude zeigen. Dieses unmittelbare Teilen der körperlichen, sensorischen oder emotionalen Zustände anderer Menschen wird als Empathie bezeichnet (De Vignemont / Singer 2006).
Definition
Empathie ist ein emotionaler Zustand, der durch denselben Zustand einer anderen Person ausgelöst wird und bezeichnet das unmittelbare Einfühlen in die körperliche oder emotionale Lage Anderer.
Mitgefühl
Die Beobachtung oder Vorstellung von körperlichem oder psychischem Leid führt nicht nur dazu, dass wir uns direkt in die Betroffenen einfühlen und deren Leid teilen, sondern kann auch einen weiteren emotionalen Zustand auslösen, das Mitgefühl, oder compassion (Batson et al. 1987). Im Gegensatz zur Empathie bezeichnet Mitgefühl ein positives Gefühl des Wohlwollens und der Wärme für unsere Mitmenschen.
Definition
Mitgefühl oder compassion beschreibt das positive Gefühl des Wohlwollens und der Wärme für andere Lebewesen.
Räumliche Perspektivübernahme
Wenn wir miteinander interagieren, treten häufig Situationen auf, in denen wir aus unterschiedlichen räumlichen Perspektiven auf Objekte oder Szenen schauen. Beim gemeinsamen Tragen eines Klaviers haben wir unterschiedliche Blickwinkel, sowohl auf das Klavier als auch darauf, was sich hinter dem jeweils Anderen befindet. Für die erfolgreiche Koordination von Handlungen ist es wichtig, dass wir die (unterschiedliche) Perspektive Anderer miteinbeziehen, ein Prozess, der als räumliche Perspektivübernahme bezeichnet wird und den Menschen sowohl absichtlich als auch relativ automatisch ausführen können (Samson et al. 2010; Böckler et al. 2011). Im Unterschied zu ToM gibt es bei der räumlichen Perspektivübernahme häufig einen direkten und sichtbaren Zugang zur Perspektive des Anderen, während die mentalen Zustände Anderer nicht sichtbar sind.
Definition
Räumliche Perspektivübernahme bezeichnet das explizite Erschließen oder das implizite Miteinbeziehen der (unterschiedlichen) visuell-räumlichen Perspektive Anderer.
Metakognition
Natürlich interessieren wir uns nicht nur dafür, was in unseren Mitmenschen vorgeht, sondern auch für die geistigen Prozesse, die bei uns selbst ablaufen. Die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Zuständen, also beispielsweise damit, was und wie wir denken, erinnern, wollen, wahrnehmen und wissen, wird als Metakognition bezeichnet (Flavell 1979). Dieses Denken über das eigene Denken ist ein aktiver Vorgang, der beispielsweise beim Lernen eine Rolle spielt oder dann, wenn wir Tagträume (mind wandering) beiseiteschieben, um uns auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Während der Gegenstand von Metakognition per Definition ein anderer ist als von ToM, nämlich die eigenen mentalen Vorgänge statt die mentalen Vorgänge eines Anderen, scheinen sich die kognitiven und neuronalen Grundlagen von Metakognition und ToM teilweise zu überlappen (Lombardo et al. 2010).
Definition
Unter Metakognition versteht man das Nachdenken über die eigenen geistigen Vorgänge wie beispielsweise die eigene Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Einstellungen, das eigene Gedächtnis oder Wissen.
Merksatz
Gelungene zwischenmenschliche Interaktionen setzen ein gewisses Maß an sozialem Verstehen voraus, also einen Zugang dazu, was andere Menschen wahrnehmen, fühlen und denken. ToM bezeichnet das Nachdenken über mentale Zustände Anderer, also einen kognitiven Zugang zu anderen Menschen. Unter Empathie verstehen wir hingegen das Sich-Einfühlen in Andere, also den emotionalen Zugang zu unseren Mitmenschen. Räumliche Perspektivübernahme beschreibt schließlich den Zugang dazu, was Andere sehen oder nicht sehen, also zu deren visueller Wahrnehmung. Das Nachdenken über eigene mentale Zustände wird als Metakognition bezeichnet.
Zu Beginn dieses Kapitels wurde bereits darauf hingewiesen, dass die empirische Forschung zunehmend der Frage nachgeht, wie ToM eigentlich funktioniert. Welche kognitiven Prozesse sind beteiligt, wenn wir versuchen, die Absichten, Gedanken oder Überzeugungen unseres Gegenübers zu erschließen? Diese Frage nach den kognitiven Teilprozessen ist eng verknüpft mit der Erforschung der neuronalen Korrelate von ToM.
Neuronale Grundlagen
Die sozialen Neurowissenschaften widmen sich der Untersuchung der neuronalen Grundlagen sozialen Verstehens und Verhaltens. Dabei werden verschiedene Methoden genutzt, um die Bedeutung bestimmter Hirnregionen für soziale Funktionen wie Empathie oder ToM zu beleuchten. Für die Untersuchung von ToM ist die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) ein gängiges Verfahren. Um die Ergebnisse der entsprechenden Untersuchungen einordnen und interpretieren zu können, ist es wichtig, das Prinzip zu verstehen, auf dem diese Methode beruht (siehe Exkurs fMRT).
Exkurs
Funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT): Bei der Untersuchung im Magnetresonanztomographen liegt die Versuchsperson auf dem Rücken und bekommt Reize dargeboten, z. B. Bilder, Filme oder Töne, auf die sie reagieren soll. Während der Reizpräsentation wird nun die Durchblutung des Gewebes im Gehirn gemessen. Diese Messung beruht auf den magnetischen Eigenschaften von Wasserstoff-Kernen (Protonen), die durch kurze Impulse abgelenkt werden und sich dann wieder am starken Magnetfeld des MRT-Geräts ausrichten. Die Energie, die die Protonen dabei abgeben, wird als Magnetresonanz bezeichnet und vom MRT-Gerät erfasst. Um nun zu messen, welche Regionen während der Verarbeitung eines Reizes oder der Bearbeitung einer Aufgabe besonders durchblutet sind, wird die Tatsache genutzt, dass der Blutfarbstoff Hämoglobin andere magnetische Eigenschaften hat, wenn er sauerstoffreich ist als wenn er sauerstoffarm ist. Nervenzellen in aktiven Hirnregionen benötigen mehr Sauerstoff, deshalb fließt mehr sauerstoffreiches Blut in diese Regionen. Dieser Unterschied wird als Blood-Oxygenation-Level Dependent (BOLD)-Effekt bezeichnet. Auf diese Weise kann die fMRT millimetergenau erfassen, wo eine durch Nervenzellenaktivität ausgelöste erhöhte Durchblutung stattgefunden hat. Es muss dabei berücksichtigt werden, dass die Veränderung des Hämoglobins nicht zeitgleich mit der neuronalen Aktivität auftritt, sondern erst einige Sekunden später. Es ist außerdem wichtig zu bedenken, dass unser lebendes Gehirn nicht nur dann durchblutet ist, wenn wir bestimmte Aufgaben bearbeiten, sondern zu jedem Zeitpunkt. Um also sinnvolle Aussagen über die Bedeutung spezifischer Hirnareale für psychologische Prozesse zu erhalten, muss man die Durchblutung während des interessierenden Prozesses (Versuchsbedingung) mit der Durchblutung unter maximal ähnlichen Bedingungen vergleichen, aber ohne den interessierenden Prozess (Kontrollbedingung). Die entsprechenden Unterschiede in der Magnetresonanz werden dann farbig auf dem Bild des Gehirns abgetragen.
Auf der Basis von fMRT-Untersuchungen wurden mehrere Hirnareale identifiziert, die während der Bearbeitung von ToM-Aufgaben besonders aktiviert sind und die auch als ToM-Netzwerk bezeichnet werden (Frith / Frith 2006; Saxe / Kanwisher 2003). Dazu gehören (siehe Abbildung 2)
■ die temporo-parietale Junktion (TPJ),
■ der mediale präfrontale Kortex (mPFC),
■ der Precuneus (PRE),
■ der posteriore cinguläre Kortex (PCC),
■ der posteriore superiore temporale Sulkus (pSTS) und
■ die temporalen Pole (TP).
■ Manche Untersuchungen zählen außerdem den anterioren superioren temporalen Sulkus (aSTS) und die Amygdala hinzu.
Abb. 2: Schematische Darstellung der Hirnareale, die bei der Bearbeitung von ToM-Aufgaben besonders aktiviert sind (linke Hemisphäre): medialer präfrontaler Kortex (mPFC), Precuneus (PRE) / posteriorer cingulärer Kortex (PCC), superiorer temporaler Sulkus (STS), temporo-parietale Junktion (TPJ) und temporale Pole (TP)
Merksatz
Während der Bearbeitung von ToM-Aufgaben besonders aktivierte Hirnregionen sind die temporo-parietale Junktion (TPJ), Teile des superioren temporalen Sulkus (STS), die temporalen Pole (TP) und mediale Regionen wie der mediale präfrontale Kortex (mPFC), der Precuneus (PRE) und der posteriore cinguläre Kortex (PCC).
Die Vielzahl der beteiligten Areale lässt bereits vermuten, dass ToM keine einfache und eng umschriebene Funktion ist wie beispielsweise das Bewegungssehen, sondern dass es sich vielmehr um einen komplexen kognitiven Vorgang handelt, der verschiedene Teilprozesse beinhaltet. Besonders interessant werden die neurowissenschaftlichen Befunde also vor allem dann, wenn sie dabei helfen aufzuklären, welche spezifischen Prozesse am Mentalisieren beteiligt sind.
Teilprozesse von ToM
Die Erforschung der geistigen Vorgänge, die ToM zugrunde liegen, ist in vollem Gange und es werden in der Literatur einige Prozesse und Fertigkeiten diskutiert, die zum Tragen kommen, wenn wir versuchen, uns in Andere hineinzuversetzen.
Self / other distinction: Ausschlaggebend dafür, andere Menschen verstehen zu können, ist das Wissen um die Trennung zwischen Selbst und Anderen bzw. der Prozess des Auseinanderhaltens eigener und fremder Zustände: die sogenannte self / other distinction. Wenn wir einen Freund nach einer Prüfung, die wir selbst noch ablegen müssen, weinen sehen, haben wir sowohl eine mentale Repräsentation der Erfahrung unseres Freundes (nämlich „traurig“ und „Prüfung abgelegt“) als auch, zeitgleich, eine mentale Repräsentation unseres eigenen Zustandes (nämlich „nervös wegen bevorstehender Prüfung“). Diese beiden Repräsentationen müssen wir auseinanderhalten – nur so gelingt es uns, mentale Zustände bei Anderen anzunehmen und nachzuvollziehen, die wir (momentan) nicht teilen. Neurowissenschaftliche Studien legen nahe, dass die TPJ eine für diesen Prozess relevante Hirnregion ist (Steinbeis 2016).
Beurteilung psychologischer und sozialer Eigenschaften: Das Erschließen und Erkennen mentaler Zustände basiert auch darauf, dass wir anderen Menschen stabile Persönlichkeitsmerkmale zuschreiben. Die Repräsentationen dieser emotional und sozial bedeutsamen inneren, von der sichtbaren Welt entkoppelten Eigenschaften beruhen auf unserer Lebenserfahrung, also auf unserem autobiografischen Gedächtnis, und scheinen mit einer besonderen Aktivierung des mPFC einherzugehen (Schurz et al. 2014).
Mental imagery: Sich in Personen hineinzuversetzen, deren Situationen und Perspektiven sich von den unseren unterscheiden, bedarf einer gewissen kognitiven Flexibilität und Vorstellungskraft. Der als mental imagery bezeichnete Prozess des Sich-Vorstellens bestimmter, der direkten Wahrnehmung nicht zugänglicher Zustände wird von neurowissenschaftlichen Studien mit dem Precuneus in Zusammenhang gebracht (Schurz et al. 2014).
Verarbeitung von Blicken, biologischen Bewegungen und Handlungen (gaze, biological motion and agency): Wenn wir zu erschließen versuchen, was Personen denken, wollen oder planen, nutzen wir dafür bestimmte soziale Informationen, z. B. deren Blickrichtung, deren Bewegungsmuster und deren Handlungen. Wohin jemand schaut kann Aufschluss darüber geben, was sie interessiert, was sie tun oder haben möchte. An der Art der Bewegungsabläufe erkennen wir, ob jemand gerade vorsichtig oder selbstsicher ist, traurig oder fröhlich, zielgerichtet oder unentschlossen. Und von den Handlungen eines Menschen schließen wir auf dessen Absichten und Pläne. Auf die effektive und zuverlässige Verarbeitung dieser sozialen Reize ist unser Gehirn hochspezialisiert. Vor allem die temporalen Hirnregionen wie der STS scheinen dabei eine wichtige Rolle zu spielen (Frith / Frith 2003).
Kontextuelle Einbettung: Um menschliches Verhalten richtig deuten zu können, gilt es, den Kontext, in dem es stattfindet, zu beachten. Wir brauchen also Kenntnisse darüber, wie man sich typischerweise in den verschiedensten (sozialen) Situationen verhält. Das semantische Wissen über diese sogenannten sozialen Skripte basiert auf unseren eigenen Erfahrungen in der sozialen Welt. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass die temporalen Pole beim Abrufen sozialer Skripte und bei der kontextuellen Einbettung von beobachtetem Verhalten beteiligt sind (Frith / Frith 2003).
Merksatz
An ToM beteiligte kognitive Prozesse sind u. a. das Auseinanderhalten eigener und fremder Zustände (self / other distinction), die Repräsentation nicht direkt beobachtbarer persönlicher Eigenschaften, mental imagery, die Verarbeitung von Blicken, biologischen Bewegungen und Handlungen und das Abrufen unseres semantischen Wissens über soziale Skripte.
Natürlich hängen die spezifischen kognitiven Prozesse, die am Verstehen der mentalen Zustände anderer Personen beteiligt sind, von der konkreten Situation und deren jeweiligen Anforderungen ab. Je nach Gegebenheit müssen nicht notwendigerweise all diese Prozesse ablaufen, wenn wir uns in andere Menschen hineinversetzen. Entsprechend zeigen empirische Studien unterschiedliche Muster neuronaler Aktivierung und kognitiver Teilprozesse, je nachdem, welche Aufgabe zur Erfassung von ToM genutzt wird (Frith / Frith 2003; Schurz et al. 2014) (siehe auch Kapitel 2).
Interindividuelle Unterschiede und Stabilität
In späteren Kapiteln soll aufgezeigt werden, dass die Fähigkeit, mentale Zustände anderer Menschen zu erfassen, über die Lebensspanne hinweg variiert (Kapitel 3) und in verschiedenen Psychopathologien vermindert sein kann (Kapitel 4). Doch unterscheiden sich auch gesunde Erwachsene systematisch in ihrer Fähigkeit und / oder Motivation, zu mentalisieren? Diese Frage ist eng verbunden mit der Erforschung der Stabilität von ToM. Hat jemand tatsächlich eine Begabung für ToM, sollte sich diese immer wieder und bei verschiedenen Gelegenheiten zeigen.
Während unsere Alltagserfahrung nahelegt, dass Menschen unterschiedlich motiviert, bereit oder in der Lage sind, die Perspektive anderer Menschen einzunehmen, ist diese Frage empirisch nicht so einfach zu beantworten. Die meisten Aufgaben zur Erfassung von ToM (siehe Kapitel 2) sind für gesunde Erwachsene relativ einfach zu lösen. Für die zuverlässige Untersuchung der Fähigkeit zu ToM braucht man jedoch Aufgaben, die schwierig genug sind, um eventuell bestehende Unterschiede zwischen Personen aufzeigen zu können. Die Erforschung der Stabilität der ToM-Tendenz erfordert zudem Messinstrumente, die man bei denselben Personen wiederholt anwenden kann, ohne dass sich Lerneffekte zeigen. Dennoch geben erste Untersuchungen Hinweise darauf, dass sich die Tendenz, schwierige ToM-Aufgaben zu lösen, tatsächlich zwischen gesunden Erwachsenen unterscheidet und dass dieser Unterschied über die Zeit hinweg stabil ist (z. B. Kanske et al. under review; für Stabilität von ToM im Säuglings- und Kleinkindalter siehe Aschersleben et al. 2008).
Persönliche Faktoren
In Zusammenhang mit der Erforschung interindividueller Unterschiede interessiert nun, welche persönlichen Merkmale und Fertigkeiten für die ToM-Fähigkeit förderlich sind. Einige in der Literatur diskutierte Faktoren werden im Folgenden kurz vorgestellt. Hierbei gilt zu beachten, dass es sich meist um korrelative Zusammenhänge handelt, die keine Aussagen zu einer Wirkrichtung zulassen.
Geschlecht: Während Studien, die ToM über Fragebögen erfassen, zum Teil berichten, dass Frauen häufiger angeben, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, gibt es für Geschlechtsunterschiede bei der tatsächlichen Leistung in ToM-Aufgaben kaum Indizien. Forscher vermuten daher, dass die Unterschiede bei den Selbstberichten vor allem auf die Erwartungen zurückgehen, die gesellschaftlich an Frauen bzgl. ihrer sozialen Kompetenz und sozialen Orientierung gestellt werden.
Empathie: Auch hier zeigt sich ein positiver Zusammenhang zu ToM nur, wenn die Tendenzen zu Empathie und ToM über Fragebögen erfasst werden. Verhaltensbasierte Untersuchungen legen nahe, dass Menschen, die dazu neigen, sehr empathisch zu reagieren, nicht notwendigerweise besser oder weniger gut darin sind, sich kognitiv in andere Menschen hineinzuversetzen (Kanske et al. 2016). Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass das Sich-Einfühlen und das Sich-Eindenken in andere Menschen auf interindividueller Ebene relativ unabhängige Fertigkeiten sind.
Exekutive Funktionen: Die kognitiven Funktionen, die der intelligenten Steuerung von Verhalten zugrunde liegen, werden als exekutive Funktionen bezeichnet und scheinen mit der Leistung in ToM-Aufgaben zusammenzuhängen. Vor allem die Fähigkeit, Impulse oder Handlungstendenzen zu unterdrücken, (Inhibition) sagt nicht nur im Entwicklungs- und klinischen Kontext, sondern auch bei gesunden Erwachsenen die ToM-Kompetenz vorher (z. B. Carlson et al. 2004; Ozonoff et al. 1991). Möglicherweise beruht dieser Zusammenhang darauf, dass Inhibitionsprozesse auch für erfolgreiches Mentalisieren notwendig sind, beispielsweise wenn die Repräsentationen eigener mentaler Zustände zugunsten der Repräsentationen der mentalen Zustände Anderer unterdrückt werden müssen (Apperly 2012).
Beispiel exekutive Funktionen und ToM
Frau Weiner ist 48 Jahre alt und Hausfrau. In ihrem Bekanntenkreis fällt sie durch ihr enthemmtes Mitteilungsbedürfnis, auch über intime Angelegenheiten, auf. Frau Weiner hat einen Hauptschulabschluss und arbeitet nicht mehr; sie berichtet, dass ihr Stillsitzen und konzentriertes Arbeiten schon immer schwerfielen. Ehemalige Kollegen beschreiben sie als sehr gesprächig und erinnern sich, dass sie Andere oft missverstand und sich provoziert fühlte. Psychologisch-diagnostische Untersuchungen zeigen Beeinträchtigungen in exekutiven Funktionen, beispielsweise bei Aufgaben, in denen Frau Weiner Abläufe planen („Planungsfähigkeit“), Regeln identifizieren („Problemlösen“) oder zwischen verschiedenen Antwortstrategien hin und her wechseln muss („kognitive Flexibilität“). Besonders schwer fällt ihr, begonnene Handlungen oder verbale Ausführungen zu unterbrechen, auch wenn diese nicht zielführend sind („Inhibition“). Die zuständige Psychologin bemerkt außerdem, dass Frau Weiner die Absichten ihrer Mitmenschen oft nicht versteht und deren Verhalten daher nicht nachvollziehen kann. Ebenso scheint sie sich keine Gedanken darüber zu machen, was ihr oft grenzüberschreitendes Verhalten bei Anderen auslöst. Es liegt neben den verringerten exekutiven Fähigkeiten also auch eine Beeinträchtigung der Tendenz und / oder Fähigkeit zu ToM vor.
Metakognition: Vergleichbar mit ToM beinhaltet Metakognition das Erschließen von und Nachdenken über mentale Zustände (beispielsweise Absichten, Überzeugungen und Wissen) – allerdings handelt es sich dabei um die eigenen mentalen Zustände. Neben Hinweisen auf überlappende neuronale Grundlagen von Metakognition und ToM (Lombardo et al. 2010) zeigen erste Studien inzwischen, dass eine Verbesserung im Erkennen und Differenzieren der eigenen Gefühls- und Gedankenmuster mit einer verbesserten ToM-Fähigkeit einhergeht (Böckler et al. 2017).
Räumliche Perspektivübernahme: Wie ToM bedarf auch die Fähigkeit, die räumlich-visuelle Perspektive anderer Menschen einzunehmen, das Abstrahieren von einem eigenen Zustand (der eigenen Wahrnehmung), um sich den Zustand (die Wahrnehmung) der anderen Person zu vergegenwärtigen. Entsprechend gibt es Hinweise, dass die Leistung in Aufgaben, die räumliche Perspektivübernahme erfassen, positiv mit der Leistung in ToM-Aufgaben korreliert ist. Weitere Forschungsergebnisse legen nahe, dass dieser Zusammenhang auf die Bedeutung inhibitorischer Prozesse für räumliche sowie für kognitive Perspektivübernahme zurückzuführen ist (Qureshi et al. 2010).
Situative Faktoren
Neben persönlichen Faktoren können auch situative Gegebenheiten unsere Motivation und unsere Fähigkeit beeinflussen, die Annahmen, Absichten und Gedanken anderer Personen einzuschätzen. Vor allem der momentane emotionale Zustand spielt hier eine Rolle. Empirische Befunde zeigen, dass die Aktivierung der für ToM relevanten Hirnareale sowie die Leistung in anspruchsvollen ToM-Aufgaben während akuter negativer emotionaler Stimulation und in stressauslösenden sozialen Situationen reduziert sein kann (Kanske et al. 2016; Smeets et al. 2009). So verstanden manche Probanden beispielsweise vor allem in solchen Erzählungen die mentalen Zustände ihrer Gesprächspartner weniger gut, in denen es um emotional belastende Erlebnisse ging. Im sozialen Kontext könnte das also bedeuten, dass unsere ToM-Fähigkeit gerade dann eingeschränkt ist, wenn wir sie besonders dringend benötigen, nämlich in emotional schwierigen und konfliktreichen Situationen.
Merksatz
Die Motivation und / oder die Fähigkeit zu ToM scheinen sich systematisch zwischen Menschen zu unterscheiden. Auf der Seite persönlicher Faktoren zeigt hierbei vor allem die Fähigkeit zu inhibitorischer exekutiver Kontrolle einen positiven Zusammenhang zu ToM. Situative Faktoren, die die ToM-Leistung beeinflussen können, sind negativer Affekt und Stress.
Eine spannende und relevante Frage für zukünftige Forschung ist, ob die beobachtete interindividuelle Varianz in ToM sich auf unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeiten zurückführen lässt, oder ob sich eher die Motivation und / oder die spontane Tendenz unterscheiden, mentale Zustände anderer Menschen miteinzubeziehen.
Die folgenden Internet- und Literaturquellen geben ausführlichere Einblicke in die Forschung zu ToM und bieten die Möglichkeit, die Begriffe und Bedeutungen sowie die Grundlagen von ToM vertiefend zu studieren.
Internet
TED talk von Rebecca Saxe zu Theory of Mind: www.ted.com / talks / rebecca_saxe_how_brains_make_moral_judgments
Literatur
Apperly, I. (2012). What is “theory of mind”? Concepts, cognitive processes and individual differences.
Förstl, H. (2012). Theory of mind: Neurobiologie und Psychologie sozialen Verhaltens.