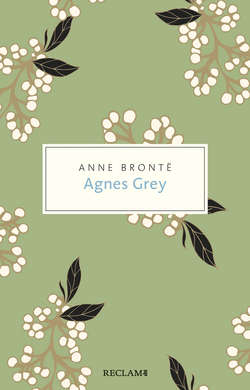Читать книгу Agnes Grey - Anne Bronte, Anne Brontë, The Bronte Sisters - Страница 6
Kapitel 2
ОглавлениеErste Lektionen in der Kunst des Unterrichtens
Als wir so dahinfuhren, hob sich meine Stimmung wieder, und ich wandte mich der Betrachtung des neuen Lebens zu, das ich nun beginnen würde. Aber obwohl die Septembermitte gerade erst überschritten war, machten die schweren Wolken und ein scharfer Nordostwind den Tag äußerst kalt und ungemütlich; auch erschien mir die Reise sehr lang, denn, wie Smith feststellte, die Straßen waren »sehr schwer«; sein Pferd war mit Sicherheit auch »sehr schwer«: Es schleppte sich die Hügel hinauf, schlich sie wieder hinunter und ließ sich nur dazu herab, in Trab zu fallen, wenn die Straßen völlig eben oder nur ganz leicht abschüssig waren, was in dieser rauen Gegend nur selten vorkam. Und so war es fast ein Uhr, als wir unseren Bestimmungsort erreichten. Doch als wir endlich das steil aufragende Eisentor passierten, gemächlich die glattgewalzte, zu beiden Seiten von grünen Rasenflächen und jungen Bäumen gesäumte Auffahrt hinauffuhren und uns dem neuen, doch stattlichen Herrenhaus von Wellwood näherten, das aus einem hochaufgeschossenen Pappelhain auftauchte, verließ mich der Mut, und ich wünschte, meilenweit weg zu sein. Zum ersten Mal in meinem Leben musste ich für mich selbst einstehen; es gab kein Zurück mehr. Ich musste dieses Haus betreten und mich mit seinen fremden Bewohnern bekannt machen. Aber wie machte man das? Sicher, ich war fast neunzehn, aber ich wusste sehr wohl, dass viele Mädchen von fünfzehn Jahren oder weniger über ein fraulicheres Benehmen und eine größere Ungezwungenheit und Selbstsicherheit verfügten, als ich sie aufgrund des zurückgezogenen Lebens und der schützenden Obhut von Mutter und Schwester besaß. Wenn Mrs. Bloomfield jedoch eine freundliche, mütterliche Frau war, würde ich auf Dauer schon Erfolg haben; mit den Kindern würde ich natürlich bald gut Freund sein und mit Mr. Bloomfield hoffentlich nur wenig zu tun haben.
»Nur ruhig, nur ruhig, egal, was kommen mag«, sagte ich mir im Innern und hielt mich so getreu an diesen Entschluss und war derart damit beschäftigt, meine Nerven zu beruhigen und das unbotmäßige Klopfen meines Herzens zu beschwichtigen, dass ich, nachdem ich in die Halle und zu Mrs. Bloomfield geführt worden war, beinahe vergaß, ihren höflichen Gruß zu erwidern. Erst später ging mir auf, dass ich meine wenigen Worte wie im Halbschlaf gesprochen hatte. Auch die Lady hatte ein etwas frostiges Verhalten an den Tag gelegt, wie ich nachher feststellte, als ich Zeit zum Nachdenken hatte. Sie war eine große, reservierte, stattliche Frau mit dichtem schwarzen Haar, kalten grauen Augen und ausgesprochen ungesunder Gesichtsfarbe.
Mit gebührender Höflichkeit zeigte sie mir jedoch mein Zimmer und ließ mir Zeit, mich etwas zu erholen. Beim Anblick meines Spiegelbildes war ich entsetzt: Durch den kalten Wind waren meine Hände angeschwollen und gerötet, meine Haare aufgelöst und zerzaust und mein Gesicht leicht purpurn gefärbt; zu allem Überfluss war mein Kragen schrecklich zerknittert, mein Kleid schlammbespritzt, und meine Füße steckten in einem Paar derber, neuer Stiefel; und da man die Koffer noch nicht heraufgebracht hatte, konnte dem allem auch nicht abgeholfen werden. Als ich mein Haar, so gut es ging, gebändigt und meinen widerspenstigen Kragen mehrmals zurechtgezupft hatte, machte ich mich daran, in den beiden Treppenfluchten meinen Weg zu suchen, wobei ich vor mich hin grübelte. Mit einiger Schwierigkeit fand ich den Raum, in dem Mrs. Bloomfield mich erwartete.
Sie führte mich ins Esszimmer, wo der Familientisch gedeckt war. Man setzte mir Beefsteak und ein paar lauwarme Kartoffeln vor. Während ich saß, saß sie mir gegenüber, beobachtete mich, wie es mir vorkam, und gab sich Mühe, eine Art Gespräch in Gang zu halten, das größtenteils aus einer Reihe von abgedroschenen Phrasen bestand, die sie mit steifer Förmlichkeit äußerte. Aber das mochte eher mein Fehler als der ihre sein, denn ich war beim besten Willen nicht in der Lage, mich zu unterhalten. In der Tat nahm das Essen meine Aufmerksamkeit fast völlig in Anspruch: nicht etwa wegen meines Heißhungers, sondern weil mir die Zähigkeit des Beefsteaks und meine klammen Finger zu schaffen machten, die fast gelähmt waren, nachdem sie fünf Stunden dem bitterkalten Wind ausgesetzt gewesen waren. Nur zu gern hätte ich die Kartoffeln gegessen und das Fleisch übriggelassen, aber da man mir ein großes Stück davon auf den Teller gelegt hatte, wollte ich nicht unhöflich sein. Nach mehreren ungeschickten und erfolglosen Versuchen, es mit dem Messer zu schneiden, mit der Gabel zu zerreißen oder mit beidem zusammen in kleine Stücke zu zerlegen, nahm ich schließlich – immer der Tatsache bewusst, dass die schreckliche Lady die ganze Prozedur verfolgte – wie ein zweijähriges Kind verzweifelt Messer und Gabel in beide Fäuste und machte mich mit all meinem bisschen Kraft ans Werk. Dies nun verlangte eine Entschuldigung, und mit dem schwachen Versuch zu lachen, sagte ich: »Meine Hände sind so taub von der Kälte, dass ich kaum mit Messer und Gabel umgehen kann.«
»Ich dachte schon, Sie fänden es kalt«, antwortete sie mit einer kühlen, stets gleichbleibenden Würde, die nicht gerade dazu angetan war, mich zu beruhigen.
Als die Zeremonie beendet war, führte sie mich ins Wohnzimmer zurück, wo sie läutete und nach ihren Kindern schickte.
»Sie werden feststellen, dass sie in ihren Kenntnissen nicht sehr weit fortgeschritten sind«, sagte sie, »denn ich hatte so wenig Zeit, mich selbst um ihre Erziehung zu kümmern, und wir dachten bis jetzt, sie seien noch zu klein für eine Gouvernante; aber ich glaube, es sind intelligente Kinder, sehr bereitwillig zu lernen, besonders der kleine Junge: Er ist, wie ich meine, der Beste von allen – ein großzügiger, edel gesinnter Knabe, der geführt, doch nicht angetrieben werden muss und der ausnahmslos die Wahrheit spricht. Betrug scheint er zu verachten.« (Nun, das hörte man gern.) »Seine Schwester Mary Ann braucht etwas Aufsicht«, fuhr sie fort, »obwohl sie im Großen und Ganzen ein sehr liebes Mädchen ist, aber ich möchte, dass sie so weit wie möglich aus dem Kinderzimmer ferngehalten wird, denn sie ist jetzt fast sechs und könnte die schlechten Angewohnheiten der Kindermädchen annehmen. Ich habe angeordnet, ihr Bett in Ihrem Zimmer aufzustellen, und wenn Sie so freundlich wären, sie beim Waschen und Anziehen zu beaufsichtigen und ihre Kleidung in Ordnung zu halten, braucht sie in Zukunft nichts mehr mit dem Mädchen zu tun zu haben.«
Ich erwiderte, dass ich das gern tun wolle, und im gleichen Augenblick betraten auch schon meine kleinen Schüler zusammen mit ihren beiden jüngeren Schwestern das Zimmer. Master Tom Bloomfield war ein hochaufgeschossener Knabe von sieben Jahren, mit drahtigem Körperbau, flachsblondem Haar, blauen Augen, einer kleinen Stupsnase und zartem Teint. Auch Mary Ann war groß, dunkelhaarig wie ihre Mutter, hatte aber ein rundes, volles Gesicht und hochrote Wangen. Die nächste Schwester war Fanny, ein sehr hübsches kleines Mädchen; Mrs. Bloomfield versicherte mir, dass sie ein besonders sanftes Kind sei und etwas Ermunterung brauche: Sie hätte bis jetzt noch gar nichts gelernt, würde aber in einigen Tagen vier Jahre alt und solle dann mit dem Lernen des Alphabets beginnen und mit den anderen ins Schulzimmer gehen. Blieb noch Harriet, ein kleines, rundes, fröhliches, verspieltes Ding von knapp zwei Jahren, zu dem es mich mehr als zu allen anderen hinzog – aber ausgerechnet mit ihr hatte ich nichts zu tun.
Ich sprach mit meinen kleinen Schülern, so gut ich konnte, und versuchte, mich liebenswürdig zu geben, aber, wie ich fürchte, ohne großen Erfolg, denn die Anwesenheit ihrer Mutter machte mich auf unangenehme Weise befangen. Ihnen dagegen ging jede Schüchternheit ab. Anscheinend waren es kecke, lebhafte Kinder, mit denen ich hoffentlich bald auf freundschaftlichem Fuße stehen würde, vor allem mit dem kleinen Jungen, von dessen vielversprechendem Charakter ich seine Mutter ja hatte sprechen hören. Mary Ann hatte ein gewisses affektiertes Lächeln und den ausgeprägten Wunsch nach Beachtung, was ich mit Bedauern registrierte. Aber ihr Bruder beanspruchte meine ganze Aufmerksamkeit für sich. Er stand, die Hände auf dem Rücken, kerzengerade zwischen mir und dem Kamin, plauderte unaufhörlich wie der größte Redner und unterbrach seinen Redefluss nur gelegentlich, um seinen Schwestern einen scharfen Tadel zu erteilen, wenn sie zu viel Lärm machten.
»O Tom, was für ein Schatz du bist!«, rief seine Mutter. »Komm her und gib deiner Mama einen Kuss. Und willst du dann nicht Miss Grey euer Schulzimmer und eure schönen, neuen Bücher zeigen?«
»Ich will dir keinen Kuss geben, Mama, aber ich will Miss Grey mein Schulzimmer und meine neuen Bücher zeigen.«
»Und mein Schulzimmer und meine neuen Bücher, Tom«, sagte Mary Ann. »Sie gehören genauso mir.«
»Sie gehören mir«, antwortete er entschieden. »Kommen Sie, Miss Grey, ich begleite Sie.«
Nachdem Schulzimmer und Bücher vorgeführt worden waren – nicht ohne Streitereien zwischen Bruder und Schwester, die beizulegen und zu schlichten ich mir die größte Mühe gab –, brachte mir Mary Ann ihre Puppe und begann, weitschweifig über deren vornehme Kleider, ihr Bett, ihre Kommode und sonstige Ausstaffierung zu schwatzen. Doch Tom hieß sie, den Mund zu halten, damit Miss Grey sich sein Schaukelpferd ansehen könne, das er unter großem Getöse von seinem Platz in der Ecke bis in die Mitte des Zimmers zog, wobei er mich mit lauter Stimme aufforderte, nun gut achtzugeben. Dann befahl er seiner Schwester, die Zügel zu halten, bestieg das Pferd und ließ mich volle zehn Minuten dastehen und zusehen, wie beherzt er mit Peitsche und Sporen umging. Während dieser Zeit bewunderte ich allerdings Mary Anns hübsche Puppe samt allem Zubehör; danach versicherte ich Mr. Tom, dass er ein ausgezeichneter Reiter wäre, aber hoffentlich Peitsche und Sporen bei einem echten Pony nicht so häufig einsetzen würde.
»Und ob ich das tue!«, sagte er und schlug mit noch größerem Eifer drauflos. »Ich werde es ihm geben wie der Teufel. Mein Wort drauf, der wird es spüren.«
Es war ganz abscheulich, aber ich hoffte, mit der Zeit eine Besserung bewirken zu können.
»Jetzt nehmen Sie Haube und Schal«, sagte der kleine Held, »und ich zeige Ihnen meinen Garten.«
»Und meinen«, sagte Mary Ann.
Tom hob mit drohender Gebärde seine Faust; sie stieß einen lauten, gellenden Schrei aus, lief auf meine andere Seite und schnitt ihm eine Grimasse.
»Du würdest deine Schwester doch wohl nicht schlagen, Tom! Ich hoffe, dass ich das nie sehen werde!«
»Das werden Sie aber manchmal: Ich bin gezwungen, es hin und wieder zu tun, um sie im Zaum zu halten.«
»Es ist aber nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie sich ordentlich benimmt, verstehst du, das ist –«
»Nun gehen Sie schon und setzen Sie Ihre Haube auf.«
»Ich weiß nicht – es ist so trüb und kalt, wahrscheinlich fängt es an zu regnen –, und du weißt ja, dass ich eine lange Fahrt hinter mir habe.«
»Das ist egal – Sie müssen mitkommen; ich dulde keine Ausreden«, gab der kleine Gentleman wichtigtuerisch zur Antwort. Und da es der erste Tag unserer Bekanntschaft war, dachte ich, es würde nichts schaden, ihm nachzugeben. Mary Ann der Kälte auszusetzen war zu riskant, und so blieb sie bei ihrer Mama, zur großen Erleichterung ihres Bruders, der mich ganz für sich haben wollte.
Der Garten war groß und geschmackvoll angelegt. Außer mehreren herrlichen Dahlien blühten noch einige andere schöne Blumen, aber mein Begleiter ließ mir keine Zeit, sie genauer anzusehen: Ich musste mit ihm über den nassen Rasen in einen entfernten, abgelegenen Winkel gehen, die wichtigste Stelle des ganzen Geländes; denn sie beherbergte seinen Garten. Dort gab es zwei Beete mit den unterschiedlichsten Pflanzen. In dem einen stand ein hübscher kleiner Rosenstock; ich blieb stehen, um seine lieblichen Blüten zu bewundern.
»Ach, kümmern Sie sich nicht darum!«, sagte er verächtlich. »Das ist nur Mary Anns Garten, schauen Sie, dies hier ist meiner.«
Nachdem ich jede einzelne Blume betrachtet und mir über jede Pflanze eine ausführliche Abhandlung angehört hatte, durfte ich gehen; zuvor aber pflückte er mit großer Geste eine Narzisse und überreichte sie mir, als würde er mir eine ungeheure Gunst erweisen. Ich bemerkte im Gras rings um seinen Garten gewisse Vorrichtungen aus Stöcken und Bindfäden und fragte, was das sei.
»Vogelfallen.«
»Warum fängst du die Vögel?«
»Papa sagt, sie sind schädlich.«
»Und was machst du mit ihnen, wenn du sie gefangen hast?«
»Das ist verschieden. Manchmal gebe ich sie der Katze, manchmal schneide ich sie mit meinem Taschenmesser in Stücke, aber den nächsten will ich bei lebendigem Leibe braten.«
»Und warum hast du etwas so Entsetzliches vor?«
»Aus zwei Gründen: Einmal will ich sehen, wie lange er lebt, und dann will ich wissen, wie er schmeckt.«
»Aber weißt du nicht, dass es sehr böse ist, so etwas zu tun? Merk dir: Vögel können genauso fühlen wie du, und überleg mal, wie dir das gefallen würde.«
»Ach, das macht nichts! Ich bin kein Vogel und kann auch nicht spüren, was ich mit ihnen mache.«
»Aber eines Tages wirst du es spüren, Tom: Du hast bestimmt schon gehört, wohin böse Menschen gehen müssen, wenn sie sterben, und wenn du nicht aufhörst, unschuldige Vögel zu quälen, vergiss nicht, dann musst auch du dorthin und das Gleiche erleiden, was sie deinetwegen erlitten haben.«
»Pah! Das werde ich nicht. Papa weiß, wie ich sie behandle, und schimpft niemals deswegen mit mir; er sagt, dass er als Junge dasselbe gemacht hat. Letzten Sommer hat er mir ein Nest mit jungen Spatzen gegeben und zugesehen, wie ich ihnen Beine, Flügel und Köpfe abgerissen habe, und er hat nichts dazu gesagt, nur dass es ekelhafte Biester wären, und ich solle mir nicht an ihnen die Hosen schmutzig machen. Und Onkel Robson war auch dabei; der hat gelacht und gesagt, ich wäre ein feiner Kerl.«
»Aber was würde deine Mama dazu sagen?«
»Ach, der ist das egal! Sie sagt, es sei schade, die schönen Singvögel zu töten, aber mit den frechen Spatzen, mit Mäusen und Ratten könne ich tun, was ich will. Also, Miss Grey, Sie sehen, dass es nicht böse ist.«
»Ich glaube immer noch, dass es das ist, Tom, und vielleicht würden deine Eltern das genauso sehen, wenn sie einmal gründlich darüber nachdächten. – Aber«, fügte ich in meinem Innern hinzu, »sie können sagen, was sie wollen, ich für meinen Teil habe beschlossen, dass du nichts Derartiges mehr tust, solange es in meiner Macht steht, das zu verhindern.«
Als Nächstes führte er mich kreuz und quer über den Rasen, um mir seine Maulwurfsfallen zu zeigen, dann in den Heumietenhof, um mir die Wieselfallen zu zeigen, von denen eine zu seiner großen Freude ein totes Wiesel enthielt, und schließlich in den Stall, nicht etwa um mir die edlen Kutschpferde, sondern ein kleines, struppiges Fohlen zu zeigen, das, wie er mir mitteilte, extra für ihn gezüchtet worden war und das er reiten solle, sobald es gut genug zugeritten wäre. Ich versuchte, dem kleinen Burschen eine Freude zu machen, und hörte all seinem Geplapper geduldig zu; denn ich hatte mir vorgenommen, falls es in seinem Wesen überhaupt so etwas wie Zuneigung gab, diese zu gewinnen und ihm dann allmählich die Fehler in seinem Verhalten zu erklären. Aber nach der großzügigen, edlen Gesinnung, von der seine Mutter gesprochen hatte, suchte ich vergebens; wobei ich allerdings schon erkannt hatte, dass er ein gewisses Maß an Aufgewecktheit und Verstand besaß, wenn es ihm beliebte, diese zu gebrauchen.
Als wir ins Haus zurückkamen, war es beinahe Teezeit. Master Tom sagte mir, dass er, ich und Mary Ann zur Feier des Tages den Tee gemeinsam mit seiner Mama einnehmen würden, weil sein Vater nicht zu Hause war; denn bei solchen Gelegenheiten aß sie immer mittags mit ihnen statt um sechs Uhr. Schon bald nach dem Tee ging Mary Ann zu Bett; Tom aber beehrte uns mit seiner Gesellschaft und Unterhaltung bis um acht. Nachdem er gegangen war, klärte mich Mrs. Bloomfield weiter über Anlagen und Fähigkeiten ihrer Kinder auf, darüber, was sie lernen sollten und wie ich mit ihnen umzugehen hätte, und sie schärfte mir ein, etwaige Schwächen nur ihr gegenüber zu erwähnen. Meine Mutter hatte mich dagegen davor gewarnt, gerade ihr allzu viel darüber zu sagen, da niemand gern von den Fehlern seiner Kinder höre, und ich beschloss also, vollkommenes Stillschweigen darüber zu bewahren. Gegen halb zehn lud mich Mrs. Bloomfield zu einem bescheidenen Abendessen ein, das aus kaltem Fleisch und Brot bestand. Ich war froh, als es vorüber war, sie ihre Kerze für die Nacht ergriff und sich zur Ruhe begab. Denn obwohl ich sie gern als angenehm empfunden hätte, war ihre Gegenwart doch äußerst ermüdend für mich, und ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass sie kalt, ernst und abweisend war – das genaue Gegenteil der freundlichen, warmherzigen Frau, wie ich sie mir in meinen Hoffnungen ausgemalt hatte.