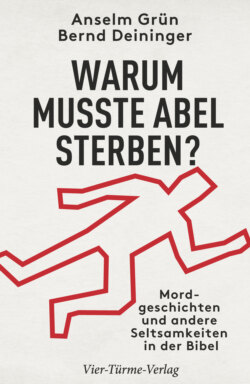Читать книгу Warum musste Abel sterben? - Anselm Grün - Страница 7
ОглавлениеBernd Deininger
Bedingungsloses Vertrauen auf Gott · Genesis 22,1–19
Nur wenige Geschichten in der Bibel sind so gut erzählt, aber auch so bedrückend wie die Szene, als Abraham mit seinem Sohn Isaak am Berg Morija steht. Die Geschichte mit dem zentralen Thema der Opferbringung wird auch in der Malerei stark rezipiert. Erstaunlich ist, dass die Verteilung der Rollen im Wesentlichen klar zu sein scheint: Abraham ist das Subjekt der Handlung, Isaak das Objekt. Unschlüssigkeit gibt es lediglich hinsichtlich des Alters des Sohnes. Einmal wird von ihm als Kind, dann als Jüngling, später als erwachsenem Mann berichtet.
Die rabbinische Literatur, die vom ersten nachchristlichen Jahrhundert bis zum achten Jahrhundert datiert, eröffnet verschiedene Lesarten dieses Kapitels. Insbesondere darauf bezogen, wer eigentlich das Opfer ist, gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Einmal ist Abraham das Opfer, dann Sara, die Ehefrau Abrahams und Mutter Isaaks, in anderen Schriften ist es Isaak im Sinne einer Selbstopferung. Im Judentum lautet der traditionelle Titel der Erzählung: »Die Bindung Isaaks«. Versucht man aber nun eine Gesamtschau auf das Geschehen, so beherrscht Abraham als Zentralfigur die Szene, wohingegen Isaak eher benutzt wird und dem Vater ausgeliefert ist. Die Bereitwilligkeit, mit der Isaak den Anordnungen seines Vaters folgt, scheint im Alter Isaaks begründet zu liegen. Das Lebensalter Isaaks wird daraus abgeleitet, dass Sara ihn in ihrem 90. Jahr empfangen hat und im Alter von 127 Jahren starb. Nachdem Sara unmittelbar nach der Nachricht, dass Isaak nicht geopfert wurde, stirbt, wäre er also bei seiner Bindung am Berg Morija 37 Jahre alt gewesen. Dies würde dafür sprechen, was die rabbinische Tradition immer wieder betont, dass Isaak durchaus freiwillig gehandelt hat und als erwachsener Mann auch Möglichkeiten gehabt hätte, die Bindung zu verweigern. Die rabbinische Überlieferung betont zudem, dass beide, Abraham und Isaak, einmütig gehandelt haben. Vater und Sohn gehen gemeinsam entschlossen den Weg – Abraham, um zu binden, und Isaak, um gebunden zu werden.
1843 erschien unter dem Titel »Furcht und Zittern« eine Schrift von Sören Kierkegaard, die die Szene auf dem Berg Morija zu beschreiben versucht. Dabei geht es Kierkegaard wesentlich darum, durchzuspielen, welche Reaktionen im inneren Erleben von Menschen möglich sind, wenn sie sich ganz auf diese Geschichte einlassen. Der Auftrag Gottes, der völlig außerhalb jedes Denkhorizonts zu liegen scheint, lautet: »Geh und opfere deinen Sohn.«
Wäre es nicht denkbar, so konstruiert Kierkegaard, dass Abraham vermutet, Gott könne so etwas gar nicht von ihm fordern, also sei es eine Versuchung, der es zu widerstehen gilt. Wenn dies so wäre, dann wäre Abraham nicht so mächtig in die Geschichte des Alten Testaments eingegangen und nicht der Stammvater des Glaubens geworden. Für Kierkegaard erscheint es wesentlich, die Bibel so zu lesen, dass sich jeder Mensch, der sich mit diesen Texten befasst, existenziell betroffen fühlt. Er versucht sie in das innere Erleben der Menschen hineinzuziehen, weshalb die wichtigste Frage für ihn ist: Was bedeutet das, was da steht, wenn es dir persönlich gesagt würde und was spielt sich in deinen Gefühlen und Gedanken ab, wenn du die Worte so hörst, als ob sie direkt zu dir gesprochen würden? Kann es sein, dass sich an dieser kleinen biblischen Erzählung erklären lässt, was oder wie Gott ist? Und weiter: Was wäre das für ein Gott, der damit droht, ganz wesentliche menschliche Beziehungen, also die zwischen Vater und Sohn, in dieser Art zu zerstören? Beschreibt uns die Bibel hier tatsächlich einen Gott, der Gehorsam befiehlt bis hin zu Sadismus und zur Grausamkeit? Sollte diese Opferung tatsächlich der Wunsch Gottes gewesen sein, dann wäre es das existenziell Bedrohlichste, was möglich wäre, um Gott zu gehorchen. Dann wäre dem Sadismus und der Gewalt im Namen Gottes Tür und Tor geöffnet.
Es ist deshalb eine zentrale Frage, die sich jeder religiöse Mensch zu stellen hat, was Gehorsam gegenüber Gott ist. Und wenn wir diese Frage nicht wirklich beantworten, dann verstehen wir etwas Wesentliches in der Bibel nicht. Am einfachsten wäre es, wenn wir uns unserer individuellen Verantwortung nicht stellen wollen, die Frage an die soziale Gruppe oder an das Kollektiv zu delegieren. In der Regel wäre es dann die Gruppe, die Gemeinde der Gläubigen bzw. die Kirche, die sagt, wie ein entsprechender Gottesbefehl auszulegen ist. Im christlichen Abendland hat aber gerade dieses Vorgehen eine lange und schlimme Tradition: zu gehorchen, wegzuschauen, den Kopf in den Sand zu stecken und sich zu weigern, eine eigenständige Position zu entwickeln. In der Kirchengeschichte gibt es unzählige Beispiele von blindem Gehorsam, die viel Unheil angerichtet haben. Insbesondere nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus muss uns ein solcher blinder Gehorsam unheimlich geworden sein.
Wir wünschen uns heute in den Schulen für unsere Kinder eine Pädagogik, die Mut macht, an sich selbst zu glauben und die Sensibilität für eigene Entscheidungsfähigkeit einübt. Wir wünschen uns, dass jeder Mensch zu den Dingen Zugang findet, an denen er wachsen und reifen kann. Menschliches Lebensglück ist davon abhängig, ob dies in den entscheidenden ersten zehn Lebensjahren gelingt. Aber, so könnte man einwenden, besteht dann nicht die Gefahr, dass eine solche Perspektive den Egoismus fördert? Selbstfindung und Selbstverwirklichung kann durchaus auch heißen, auf die Umwelt und Mitwelt nur bedingt zu reagieren. Jeder Mensch muss jedoch auch lernen, sich in seinem erwachsenen Leben in unterschiedlicher Weise auf Situationen einzulassen und sie auszuhalten bzw. Opfer zu bringen.
Wenn wir einen Blick auf die Kulturen und Religionen der Welt werfen, wird in vielen sehr genau beschrieben, wie Opfer gebracht werden müssen, um Glück zu gewinnen. Bei den Azteken waren Menschenopfer nötig, um die Sonne zum Leuchten zu bringen. In der griechischen Antike beschreibt der Dramatiker Aischylos, dass Agamemnon seine Tochter Iphigenie zu opfern habe, damit die Windstille beseitigt werde, um die Schiffe vor Troja in Fahrt zu bringen. Im Buch der Richter im Alten Testament wird erzählt, dass Jiftach auszieht, um Israel gegen den Angriff der Feinde zu verteidigen, und er verspricht, dass er bei einem Sieg aus Dankbarkeit für das Glück im Kampf seine eigene Tochter opfern wird. So altertümlich und legendenhaft das klingt, ist es nicht dennoch ein Teil unserer Wirklichkeit?
Wenn wir uns in unserer unmittelbaren Nähe oder in unserer Gesellschaft umblicken, gibt es viele Menschen, die glauben, etwas opfern zu müssen, um Größeres zu erreichen. Eltern erklären auch heute noch ihren Kindern, dass sie Verzicht üben müssen, bevor sie »richtig leben« können: Erst muss ein Haus gebaut werden, erst muss die wirtschaftliche Lage gesichert sein. Bevor etwas angeschafft wird, muss gespart werden. Das Leben vertröstet sich auf morgen, und ein Tag nach dem anderen wird für eine Zukunft geopfert, die möglicherweise nie eintritt.
Wie viele von uns hatten schon den Gedanken: Diese Situation muss ich jetzt aushalten. Ich muss mich ein- und unterordnen, mich unter Umständen auch quälen und missbrauchen lassen, damit ich in eine bessere Zukunft komme. Das Gefühl, Opfer bringen zu müssen, um sich im Leben und in der Gesellschaft einen angestrebten Platz zu erwerben, scheint für viele Menschen normal zu sein. Ohne Schmerz gibt es kein Glück. Das heißt aber auch, dass eine Form des verinnerlichten Sadismus zu den Selbstverständlichkeiten unseres Lebens gehört. Wenn wir das auf die Religion übertragen, sehen wir, dass es noch immer viele gibt, die glauben, näher bei Gott zu sein, indem sie ihre Triebregungen, ihre Neigungen, ihre Vorstellungen und Fantasien, die sie als unmoralisch empfinden, opfern.
Versuchen wir nun die Geschichte Abrahams und Isaaks auf eine andere Weise zu verstehen und an die Stelle des Gehorsams und des Opfers einen anderen Blick zu setzen. Abraham wird von Gott in eine Lage gebracht, in der er nicht einmal seiner Frau Sara erklären kann, welchen Befehl er erhalten hat. Ethisch betrachtet ist das, was er tun soll, ein Verbrechen. So versucht der Patriarch die argwöhnische Frau und Mutter zu hintergehen. Er sagt zu Sara: »Bereite uns Speise und Trank, wir wollen essen und fröhlich sein!« Als sie dann mitten im Essen waren, sagte er: »Du weißt, dass ich im Alter von drei Jahren meinen Schöpfer erkannt habe; der Knabe ist nun groß und ist nicht eingeweiht. Es gibt aber einen Ort, nicht sehr weit von uns, wo selbst die Knaben eingeweiht werden. Ich will ihn nehmen und dort einweihen.« Sie antwortet: »Gehe in Frieden.« Er brach schon morgens früh auf, da er Angst hatte, dass seine Gemahlin Verdacht schöpfen könnte, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Angst, die Sara um ihren Sohn hat, zeigt sich dann später in der fürsorglichen Liebe des Sohnes zu seiner Mutter. Diese kommt in der letzten Bitte Isaaks bei seiner Bindung zum Ausdruck: Er fürchtet, die Nachricht von seiner Opferung könnte die Mutter zu einer tödlichen Kurzschlusshandlung veranlassen. Tatsächlich ist es dann auch so, dass Sara im Folgekapitel stirbt, möglicherweise als Reaktion auf Isaaks Bindung, wenngleich die Opferung nicht vollzogen wird.
Insofern wäre der Tod Saras durchaus auch als ein Gradmesser der latenten Grausamkeit des göttlichen Befehls und väterlichen Gehorsams zu verstehen. An dieser Stelle ist es nun aber wichtig zu fragen, wie von Gott gesprochen wird. Wenn wir uns fragen, was Gott will, so könnten wir darauf verweisen, dass es wichtig wäre, die Zehn Gebote einzuhalten. Es ist nötig, zumindest die Bergpredigt zur Kenntnis zu nehmen, um danach zu leben. Dies wären zumindest zwei wichtige Aspekte, die aus der Bibel direkt herauszulesen sind. Für viele Menschen spricht Gott aber auch dadurch, wie Theologen und die Kirche ihn auslegen, also durch eine Gruppe. Für den Einzelnen ist nichts weiter vorgesehen, als sich daran zu halten. Entscheidend müsste aber doch eigentlich sein, in Gott eine Person wiederzufinden, die unserer menschlichen Person etwas zu sagen hat. Das heißt, Gott müsste sich im Dialog, im direkten Gespräch, im Gebet einem Menschen zuwenden und mit ihm ihn Kontakt treten. Daraus könnten sich dann Wahrheiten entwickeln, die nur im Einzelfall gelten und die in der Außenwelt nicht mehr zu rechtfertigen wären. Es gibt viele Menschen, die nur darauf warten, dass sie aus ihrer Einsamkeit heraus einmal darüber sprechen können, wie sie sich fühlen und wie sie die Welt, in der sie leben, empfinden. Dabei geht es nicht darum, eine Erklärung zu finden, warum etwas Tragisches oder Schlimmes passiert ist, sondern häufig nur darum, dass da jemand ist, der sagt: »Ich möchte bei dir sein, ich möchte dich verstehen.«
Viele befinden sich in ausweglosen Situationen und müssen Entscheidungen treffen, die schwierig sind, die aber das Leben ihnen abfordert. So erzählte mir ein Mann, wie sehr er darunter leidet, seine Frau und seine Kinder verlassen zu haben. Er spürte, dass seine Wesensart sich nicht mit den Vorstellungen vertrug, die seine Frau von ihm hatte. Gleichzeitig hing sie aber sehr an ihm und konnte ohne ihn nur in Panik und Angst leben. Auch seine Kinder schienen nur schwer zu verstehen, dass er sie verließ. Und dennoch, so meinte der Mann, war es das Beste, was er tun konnte. Wäre das nicht ein Beispiel, um zu begreifen, was es bedeutet, alles abgeben zu müssen, damit es im Leben gut weitergehen kann? Wenn das so wäre, dann sind wir ganz nahe bei der Geschichte von Abraham. Ich meine, man muss sie so verstehen, dass ein Mensch sich ganz in das Gefühl hineinbegibt, was Gott sein könnte. Das ist der ganz unmittelbare Dialog zwischen Gott und einem Individuum. Da steht ein einzelner Mensch vor seinem Gott, und nur in dieser Beziehung entwickelt sich etwas, was passend und richtig ist. Daraus ließe sich folgern, dass das Ende all der Vorstellungen gekommen ist, in der wir den göttlichen Willen in das Ethisch-Allgemeine aufheben und Religion für eine Funktion der Moral erklären. Der Einzelne vor seinem Gott würde heißen, dass die Personalität Gottes und unsere eigene Person ins Zentrum des Geschehens rücken. Das ist doch aber auch das Großartige an Abraham, dass er das Äußerste wagte und sich in seinem Glauben verankert wusste. Glauben, das ist die Verheißung Gottes an Abraham aus dem zwölften Kapitel der Genesis, ein zahlreiches Volk zu werden. Abraham hörte nicht auf, an Gott zu glauben für dieses Leben, das er zur Verfügung hatte. Das ist die Größe dieses Mannes. Zeichnet das nicht einen gläubigen Menschen aus, dass er hofft, dass Gott ihm alles zurückgibt, was er im Begriff war wegzugeben? Ist es nicht ein ungeheurer Gedanke, sich Gott so anzuvertrauen und sich tragen zu lassen, bis zum Wiedererhalt von allem, was verloren schien?
Abraham steht mitten im Leben, als ihm am Berg Morija zugemutet wird, seinen eigenen Sohn zu opfern. Das scheint mir wie ein Bild für das, was wir lernen müssen: Der Glaube Abrahams beginnt gerade damit, dass in seiner Person etwas Besonderes ist mit einer großen Zukunft, die ihm gilt. Seine Größe wird die eines Stammvaters sein. Was der Gott der Bibel will, ist ein Vertrauen auf das Individuelle in unserer Person. Darum geht es an dieser Stelle und viel weniger um Isaak als um Abraham selbst. Er muss lernen zu sein, selbst wenn sein Sohn nicht wäre. Nur er selbst mit seinem Leben ist gemeint. Es gibt viele Eltern, die ihre Kinder hinaus in eine Zukunft gehen lassen müssen, die sie nicht kennen. Für sie ist es, als ob ihr Sohn oder ihre Tochter ihnen stürben. Sie müssen lernen, dass die Freiheit eines anderen Menschen wichtiger ist, als das Liebste bei sich behalten zu wollen. Kinder finden zu ihrem eigenen Leben nur, wenn die Eltern lernen, selbst zu sein. Dieses Moment einer radikalen Herauslösung aus dem Verband der Generationenkette geschieht hier, indem Abraham Gott zurückgibt, was er von ihm bekam. Dann ereignet sich das Wunder des wiedergewonnenen Lebens. Es kann sein, dass Kinder im eigenen Haus bleiben, gerade weil man sie freigelassen hat. Es ist möglich, dass sie gerne wieder zu Besuch kommen, einfach weil sie spüren, dass ihre Eltern ihre Angst um sie durch Vertrauen besiegt haben. Für Eltern ist es wichtig zu spüren, dass ihre Kinder nie ihr Besitztum sind. Sie wurden lediglich geliehen, wie ein Geschenk, das zurückgegeben werden soll in die Hände dessen, der es gab. Aber das ist nicht das Ende, das ist nicht der Tod, sondern das ist das wirkliche Leben.
Wenn wir die Erzählung von Abraham so lesen, dass sie der Selbstfindung und dem durchaus irdischen Glück dienlich statt widersprechend wird, dann öffnet sie sich auch zu der Interpretation des Jesus von Nazaret über das Heilige Buch seines Volkes. An vielen Stellen des Alten Testaments hören wir, dass Opfer darzubringen sind als Rituale der Versöhnung. Und immer bleibt dann das Gottesbild zwiespältig zwischen Grausamkeit und Mitleid, zwischen Sadismus und Erbarmen, zwischen Strenge und Gnade. Wir haben Mühe, damit zurechtzukommen. Ein solches Gottesbild würde von uns Dinge verlangen, die möglicherweise unmenschlich sind, da wir uns in Pflichten verstricken auf Kosten der unmittelbaren Mitmenschlichkeit.
Genau das wollte Jesus verändern. Er wies immer wieder darauf hin, dass die Zwiespältigkeiten nicht in Gott liegen, sondern in uns selbst, in unserer eigenen seelischen Struktur. Sie spielen sich in uns ab. Niemals dürfen wir sie in Gott hineinprojizieren.
Zum Schluss noch ein Gedanke von Eli Wiesel, dem bedeutenden jüdischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, der die Geschichte Abrahams und Isaaks als ein Modell der Leidensbewältigung für das jüdische Volk verstand. Er formulierte in etwas so, dass die Erzählung in ihrer Zeitlosigkeit von höchster Aktualität sei. Er meint: Wir kannten Juden, die – wie Abraham – ihre Söhne haben umkommen sehen im Namen dessen, der keinen Namen hat. Wir kannten Kinder, die – wie Isaak – dem Wahnsinn nahe, den Vater auf dem Altar haben sterben sehen in einem Feuermeer, das bis zum höchsten Himmel reichte. Als Identifikationsfigur für Verfolgte überdauert die Bindung Isaaks Jahrhunderte und sie umfasst die gesamte jüdische Geschichte. Als wandelten Abraham, Sara und Isaak noch auf der Erde.