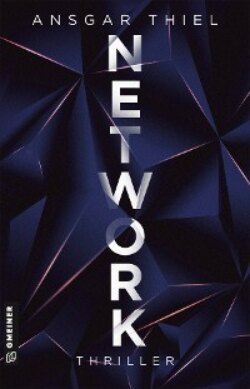Читать книгу Network - Ansgar Thiel - Страница 8
Der Fall
Оглавление1.12.2046
Kriminaloberrat Detlef R. Burger machte Bürogymnastik, während er nachdachte. In Polizeikreisen galt der operative Leiter der SBBK trotz seines mit 45 Jahren noch relativ jungen Alters bereits als lebende Legende, nachdem er, noch vor seinem Wechsel zur SBBK, beim Morddezernat der Stadtpolizei die höchste Aufklärungsquote der letzten 50 Jahre erzielt hatte.
Wie Di Marco war auch er ein Studienabbrecher. Burger hatte bis zu seinem 18. Geburtstag sowohl die amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besessen. Er hatte in den USA studiert, wo er die ersten Initiativen für eine globalpolitische Wachstumsbeschränkung internationaler Unternehmenskonsortien mitinitiiert hatte, was natürlich einem Kampf gegen Windmühlen gleichgekommen war. Von der politischen Machtlosigkeit und dem Desinteresse der Bevölkerung ernüchtert, war er dauerhaft nach Deutschland gezogen und hatte seinen Aktionsraum verlagert. Die Polizei, die damals aufgrund diverser Menschenrechtsverstöße gegen Einwanderer für Schlagzeilen sorgte, schien ein fruchtbares Feld für seine neuen Ziele. Seine Vergangenheit als politischer Aktivist hatte ihm karrieremäßig eher Respekt eingebracht als geschadet.
Tatsächlich war es ihm gelungen, modifizierte Verhörroutinen, eine verbesserte Unterbringung nach der Verhaftung sowie die Anschaffung einer für 20 Sprachen anwendbaren Übersetzungssoftware durchzusetzen. Es hatte jedoch nicht lange gedauert, bis er auf die Position eines Hauptkommissars im Morddezernat weggelobt worden war. Die Beamten des Morddezernats waren froh über einen fähigen, liberalen Vorgesetzten, die ehemaligen Vorgesetzten der Stadtpolizei über einen lästigen Unruhestifter weniger.
Als auf politischer Ebene der Plan gefasst wurde, eine neue Spezialeinheit zur Verbrechensbekämpfung einzurichten, die auch virtuelle Kriminalität ins Visier nehmen sollte, fiel sehr bald die Entscheidung, ihm den Aufbau dieser Einheit zu übertragen, nicht nur wegen seiner Erfolge bei der Mordkommission, sondern vor allem, weil er sich in seiner Zeit als politischer Aktivist den Ruf eines äußerst beweglichen Hackers erworben hatte.
Jetzt gerade war Burger extrem nervös, ein Zustand, der eigentlich nicht typisch für ihn war. Er hielt noch immer sein Visiophone in der Hand, obwohl er das Gespräch mit dem deutschen Regionaldirektor der Europäischen Bundespolizei bereits beendet hatte. Was war das für ein Tag heute! Jetzt kam auch noch die gestrige Geiselnahme zu Mallmanns Ermordung hinzu.
Gleich würden die Berliner Stadtpolizeidirektorin und die Regierende Bürgermeisterin erscheinen. Die Bürgermeisterin! Normalerweise ließ sie die Leute im Rathaus antanzen. Ihr Besuch hier unterstrich die Brisanz des Falls.
Burger deckte den Besprechungstisch, eine seiner vielen Eigenarten, die seine Mitarbeiter so an ihm schätzten. Er ließ solche Aufgaben nicht durch Untergebene oder Servanten erledigen, sondern kochte – wenn er Zeit dazu hatte – Tee und Kaffee selbst, meist Laos Wild Phoingsali und Kona Blend, besorgte dazu vegane Früchtemakronen oder Kokos-Reis-Plätzchen und brachte beides den Mitarbeitern zuweilen sogar an den Schreibtisch.
Die Tür wurde aufgerissen.
Die Bürgermeisterin, bekannt für eine Neigung zu Arroganz und Jähzorn, die es selten versäumte, ihren über 20 Generationen zurückreichenden Stammbaum zu erwähnen, hielt sich nicht mit Anklopfen auf. In ihrem Gefolge: die Polizeidirektorin und ein Zwei-Meter-Hüne in blauem Nadelstreifenanzug, offensichtlich ihr Bodyguard.
»Burger, ist dieser Raum abhörsicher?«, polterte die Bürgermeisterin, noch während Burger seine Gäste einlud, am Besprechungstisch Platz zu nehmen, und Tee und Kaffee einschenkte. Die Polizeidirektorin verdrehte die Augen. Keine Antwort abwartend, legte die Bürgermeisterin los. »Ist Ihnen allen klar, was die Ermordung Mallmanns bedeutet?« Sie blickte fragend in die Runde. Keiner reagierte, nicht einmal ihr Bodyguard.
»Ist Ihnen das klar?«, wiederholte die Bürgermeisterin. Ihr Kopf rötete sich angesichts der ihr entgegenschlagenden Ignoranz. Die Polizeidirektorin nickte stellvertretend für alle.
»Arthur Mallmann ist heute sicher nicht mehr der, der er mal war, aber er ist noch immer ein Spitzenmann«, fuhr die Bürgermeisterin in Anspielung auf den Rückzug des Politikers aus seinen Regierungsämtern und seinen Einzug in die Regionalpolitik fort. »Wir haben morgen Staatsbesuch aus allen Bundesstaaten Europas, sogar die Außenministerin der USA wird erwartet.«
Die Bürgermeisterin wischte sich mit einem seidenen Taschentuch, auf dem ihr goldenes Monogramm aufblitzte, den Schweiß von der Stirn. »Das braucht Sie zwar nicht zu kümmern, aber wir müssen das hier geradebiegen. Wir müssen zeigen, dass wir alles im Griff haben.«
Ein weiterer Blick in die Runde, doch noch immer kam keine Reaktion. Die Bürgermeisterin versuchte es mit einer anderen Strategie. Sie setzte ein Lächeln auf, das sie für wohlwollend hielt, und gab damit den Blick auf ihre weißen, mit modernster Technik hergestellten, perfekt geformten Zahnkronen frei. Sie zeigte gerne ihre Zähne. Zähne waren heute ein Statussymbol, noch distinktiver als früher der große Mercedes. An ihnen sah man, wer reich oder gebildet war oder wer auf sich achtete – und wer nicht. Sie ekelte sich jedes Mal, wenn sie in den Dokumentationen auf CNN die Networker lächeln sah, ihre Münder entweder von billig gemachten Goldkronen der vietnamesischen Bader oder von braunschwarzer Fäulnis entstellt.
»Weshalb sind wir hier, Frau Polizeidirektorin?«, fragte sie in Oberlehrermanier.
»Wir werden wohl eine Sondereinsatztruppe bilden müssen«, beeilte sich die Polizeidirektorin zu antworten, die zwar Sympathien für Burgers Renitenz hegte, es selbst aber immer nur ansatzweise schaffte, Widerstand zu zeigen.
»Exakt.« Die Bürgermeisterin schenkte sich Kaffee nach und schob zwei Früchtemakronen auf einmal in den Mund. »Wer sind Ihre besten Leute?«, fragte sie Burger kauend.
»Bei allem Respekt, ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen besten Leuten diesen Fall übertragen kann«, erwiderte Burger ruhig.
Die Bürgermeisterin presste die Lippen zusammen. Ihre Gesichtsfarbe wechselte von Rosa über Rot zu Dunkelrot mit bläulichen Flecken – alle Augen waren gebannt auf sie gerichtet, Burger bemerkte, dass ihr Hals tatsächlich im Umfang zunahm – und in einer wahrhaft vulkanischen Eruption brach sich ihr Zorn in einem donnernden »Waaas?« einen Weg heraus.
Zumindest teilweise entladen, nahm die Bürgermeisterin zwei tiefe Atemzüge, während derer ihre Gesichtsfarbe wieder zu Rot zurückwechselte. Um Fassung und Autorität ringend, aber noch immer lautstark, bellte sie: »Ich höre wohl nicht recht. Das ist ein Top-Priority-Fall, dem alles andere unterzuordnen ist!«
Burger, der den Ausbruch mit fasziniertem Interesse verfolgt hatte, war ein wenig enttäuscht ob der schnellen Beruhigung. Er schob der Bürgermeisterin den zweiten Teller Makronen zu und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Bei allem Respekt, Ihnen fehlt eine wichtige Information«, sagte er.
Burger stellte fast jedem zweiten Satz die Phrase »bei allem Respekt« voran. Das war eine Marotte von ihm, die er trotz mehrfacher Bemühungen nicht ablegen konnte. »Meine beiden besten Leute sind gestern in eine Geiselnahme geraten.«
»Haben Sie überlebt, sind sie verletzt oder was?«
Die Bürgermeisterin war noch immer aggressiv.
»Nein, es geht ihnen soweit ganz gut«, entgegnete Burger, »aber …«
»Dann können die beiden auch den Fall übernehmen«, unterbrach ihn die Bürgermeisterin, erhob sich und gab ihrem Bodyguard das Zeichen zum Aufbruch. Am Ausgang drehte sie sich noch einmal um und schnappte: »Ich erwarte Ihren Bericht über die Ermittlungsstrategie morgen früh um 8 Uhr.« Knallend fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.
»Doofe Kuh«, murmelte Burger.
»Ganz meine Meinung, aber sagen Sie es nicht weiter«, pflichtete ihm die Polizeidirektorin bei. »Was machen wir jetzt?«, fragte sie Burger, der sich in seinem Stuhl ausstreckte. »Sind die beiden in der Lage, den Fall zu übernehmen?«
»Bei allem Respekt, zunächst einmal kann es mir egal sein, was die Bürgermeisterin will. Wir sind immerhin eine Bundespolizeieinheit, und was wir machen, geht sie einen Scheiß an!«
Die Direktorin ließ sich 20 Sekunden Zeit, bevor sie eine Antwort gab. Ruhig stand sie auf, nahm die Teekanne und schenkte sich und Burger nach. Bei der Übernahme des Polizeidirektorenpostens war sie weder die Wunschkandidatin der Regierung noch der Opposition gewesen. Wie so oft in solchen Fällen hatte man sich auf sie geeinigt, weil die streitenden Parteien bei einer derart wichtigen Stelle auf keinen Fall die Kandidaten der Gegenseite akzeptieren wollten, aber ohne die Unterstützung der Gegenseite kein Kandidat durchzubringen war. In den anderthalb Jahren ihrer Tätigkeit hatte sie allerdings nicht nur alle politischen Erwartungen übertroffen, sondern sich aufgrund ihrer differenzierten Fachkenntnis und ihres vermittelnden Wesens auch enorme Anerkennung in Polizeikreisen erworben.
»Die Bürgermeisterin hat grünes Licht vom europäischen Innenministerium«, sagte sie ruhig und mit einer beschwichtigenden Geste. »Ich habe bereits einen Anruf erhalten. Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als zu tun, was die Bürgermeisterin will. Also, was ist mit den beiden? Können wir auf sie zählen?«
Burger setzte sich. »Wenn die Wahrheitsfindung es erfordert, natürlich. Prinzipiell können wir sie einsetzen. Di Marco und Hensen sind Elitepolizisten, verfügen über eine überdurchschnittliche Stressresistenz und einen extrem hohen IQ. Aber sie arbeiten zurzeit an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, vor allem seit ich ihnen die Virtual-Capital-Crime-Bekämpfung übertragen habe.«
Auch wenn das sogenannte Virtual Capital Crime nicht in die Zuständigkeit der Stadtpolizei fiel, war der Polizeidirektorin sehr wohl bekannt, dass es sich hierbei um ein gesellschaftlich weit bedeutenderes Problem handelte, als viele Politiker annahmen. Schon nach dem einjährigen Probelauf des World-Wide-Cyber-Reality-Nets und der Freistellung der lokalen Telefonnutzung hatten sich die Virtual Capital Crimes gehäuft, angefangen bei virtuellem Raub über den Eingriff in Netzidentitäten durch Hacken, virtuellen Mord bis hin zur Eliminierung von ganzen VR-Distrikten durch systematisch eingesetzte Computerviren.
Kurz gesagt: Virtuelle Kriminalität brachte Gefahr und Chaos ins virtuelle Leben der Netznutzer. Die Polizeidirektorin war damals selbst Mitglied der Kommission gewesen, die über Strategien einer Regulierung nachgedacht hatte. Der SBBK war dieser Bereich übertragen worden, weil man Spezialisten brauchte, die sowohl außerhalb als auch im Netz operieren konnten und am besten nichts zu verlieren hatten. Hensen und Di Marco gehörten zu dieser Sorte.
»Was heißt das nun?« Die Direktorin bevorzugte klare Antworten.
Burger reagierte nicht, sondern schien nachzudenken.
Merklich ungeduldig begann die Polizeidirektorin, die Teetasse in der Hand, mit dem rechten Fuß zu wippen. Sie schätzte Burgers Abwägen von Problemen im Allgemeinen durchaus, aber jetzt mussten Nägel mit Köpfen gemacht werden. »Das heißt, Sie können es nicht verantworten, die beiden einzusetzen?«, hakte sie nach.
Burger stieß einen leichten Seufzer aus. Wenn er Hensen und Di Marco einsetzte, dann konnte er auch gleich Babic mit dazunehmen, die ja ohnehin mit den beiden zusammenarbeiten sollte. Allerdings hatte er sich wirklich Sorgen um Babic und Di Marco gemacht, als er von Hensen über die Geiselnahme informiert wurde. Vor allem um Babic. Dabei hatte er nicht einmal so sehr befürchtet, dass sie physisch Schaden nehmen könnte. Sie hatte in ihrer Ausbildung beim FBI in San Francisco gelernt, Angreifer notfalls mit der bloßen Hand zu töten, auch wenn sie sich weigerte, diese Fähigkeiten einzusetzen. Er war sich aber nicht sicher, inwieweit sie psychisch schon in der Lage war, eine solche Situation unbeschadet zu überstehen. Und er brauchte sie unbedingt.
Er erhob sich wieder. »In Ordnung, ich werde die beiden einsetzen und ihnen mehrere Leute zur Unterstützung beiordnen. Ich möchte aber auch, dass Mia Babic, eine neue Mitarbeiterin, in die Sondereinheit integriert wird.«
»Babic? Eine Beamtin der SBBK?«
»Ja. Sie war übrigens diejenige, die gestern als Geisel genommen wurde«, erklärte Burger und schüttelte den Kopf.
Die Direktorin machte ein erstauntes Gesicht.
»Sie kommt vom FBI und soll als Analytikerin arbeiten, und zwar nicht nur im normalen Betrieb, sondern auch im Netz.«
Die Direktorin nickte. Sie versuchte, auch in Detailbereichen der Entwicklung ihres Babys, der SBBK, auf dem Laufenden zu bleiben. Im Bulletin, das sie gestern gelesen hatte, war eingehend erläutert worden, dass die SBBK unbedingt Analytiker und Profiler für die Aufdeckung von Verbrechen im Netz brauchte. Gerade hier stand die SBBK vor dem Problem, dass Netznutzer virtuelle Identitäten verwendeten, die meistens erheblich von den physischen und psychologischen Merkmalen ihrer realen Identitäten abwichen. Außerdem konnten diese Identitäten in bestimmten Fällen nicht zu den Ursprungsorten zurückverfolgt werden, was die Aufdeckung virtueller Kriminalität zusätzlich erschwerte.
Auf die Idee, einen Net-Profiler einzuschalten, war Burger gekommen, nachdem er mehrere Vorträge eines MIT-Professors für Cyberpsychologie über »Differenzen im Verhalten von Nutzern archetypischer virtueller Identitäten« und »Korrespondenzen von In- und Out-Net-Identities« beim letzten Kongress Die Wissenschaft der Kriminalistik gehört hatte.
Burger hatte sich mit dem Wissenschaftler unterhalten, und beide waren sich einig gewesen, dass die Klassifikation von Verhaltenstypen virtueller Straftäter in deren realem und in deren Netzleben einen wesentlichen Fortschritt in der Bekämpfung virtueller Kriminalität darstelle. Immerhin würde dies gewissermaßen eine Speicherung von Fingerabdrücken individuellen Verhaltens ermöglichen, die wiederum zur Identifikation unbekannter virtueller Krimineller genutzt werden könnten.
»Mia Babic ist die optimale Kandidatin für den Job. Sie hat Erfahrung als Profilerin in den USA und eine solide Agentenausbildung beim FBI durchlaufen. Sie hat außerdem an verschiedenen Forschungsprojekten zum Thema Netzverhalten mitgearbeitet.« Burger drehte sich zum Fenster. »Wenn ich die Drei zusammenarbeiten lasse, dann können sie Mallmanns Fall und das Netzprofiling auf einmal angehen.«
Für die Direktorin waren die Probleme damit gelöst. Sie nahm ihren Mantel und wandte sich Richtung Tür. »Machen Sie es, wie Sie denken. Ich höre von Ihnen«, sagte sie und verließ den Raum.
*
Babic hatte nach der Szene im Supermarkt überraschend gut geschlafen, tief und traumlos. Den Tag über hatte sie eigentlich nichts Besonderes gemacht. Ein bisschen gelesen, in einer über 50 Jahre alten gedruckten Ausgabe des Klassikers 1984 von George Orwell, der so sehr danebenlag mit seiner Zukunftsvision und doch so weitsichtig war mit der Warnung vor einer Totalüberwachung. Und dann war sie gemeinsam mit Hensen drei Stunden mit dem Rennrad durch die Gegend gefahren, raus in Richtung Wannsee. Sie hatten gar nicht viel geredet, einfach nur das Zusammensein genossen, so wie früher, als sie auch nicht viele Worte brauchten, um sich zu verstehen.
Ihr hatte das gutgetan nach dem gestrigen Tag. Die Situation im Supermarkt hatte sie zunächst weniger belastet, als sie gedacht hatte. Sie hatte den Stress erst gespürt, als sie am Wannsee die Räder abstellten und sich am Seeufer auf eine Parkbank setzten. Doch die Ruhe, der leichte Wind und das Rascheln der Blatter hatten eine regelrecht reinigende Wirkung, und sie konnte sich überraschend schnell entspannen.
Man fragte sie oft, warum sie sich eigentlich nicht häufiger in der virtuellen Welt bewegte, die doch nicht nur Arbeit, sondern auch Zerstreuung und Unterhaltung ohne Ende zu bieten habe. Tja, sie konnte es nicht erklären. Leute wie sie und Hensen waren froh, wenn sie sich so viel wie möglich in der analogen Welt bewegen konnten. Vielleicht war es die digitale Übersättigung, vielleicht war es aber auch das Gefühl, dass buchstäblich alles, was man im Netz machte, überwacht wurde. Da beruhigte sie auch das Gesetz der Digitalen Verhaltensfreiheit nicht, das eine ganze Reihe der Strafrechtsnormen in der digitalen Welt aussetzte.
Sie ging lieber raus, ganz analog, Joggen, Spazieren, Skaten. Wie sie und Hensen waren auch eine Menge andere Leute unterwegs, Real-World-Worker, aber auch Virtual Worker, die sich lieber analog zerstreuten, als ihre Freizeit im Netz zu verbringen.
Als sie wieder zurückkam, machte sie sich frisch. Sie stand noch unter der Dusche, als der Rezeptionist des Hotels, in dem sie vorübergehend untergebracht war, anrief. Genau sieben Minuten brauchte sie, um sich abzutrocknen, anzuziehen und etwas zurechtzumachen.
Das BMW-E-Mobil der SBBK stand direkt vor dem Hoteleingang. Das E-Mobil war ein Dreisitzer, zwei Plätze hinten und ein Fahrersitz vorne.
Di Marco grüßte Babic lächelnd vom Rücksitz aus. Viel Platz war nicht mehr neben ihm.
Babic umarmte Hensen, bevor sie sich neben Di Marco zwängte. Hensen kletterte auf den Fahrersitz, schob sich routiniert den Sprechbügel ihres in die Sonnenbrille integrierten Mobile-Speakers vor den Mund und lehnte sich zurück.
Als sie Di Marco im Rückspiegel sah, der trotz allen Platzmangels zufrieden lächelte, drehte sie sich um und verwuschelte ihm die Haare. »Di Marco, deine Tolle ist immer noch wie frisch vom Friseur, vom Feinsten«, frotzelte sie in Anspielung auf seine Elvis-Obsession.
Di Marco grinste.
Wenige Minuten später fuhren sie über den Ku’damm. Dessen Straßenfläche war nach wie vor für E-Mobile mit Sonderzulassungen reserviert; die breiten Flanier- und Eventstreifen auf beiden Seiten wurden wie immer um die frühe Abendzeit von regelrechten Horden verschiedenster Nationalitäten überflutet: Touristen, Kauflustige, die ihr Bürgergeld verbraten wollten, Skater, Hopper, Chill-Boarder und Biker aller Art, und immer wieder ältere Menschen, die, an die Häuser gedrängt, um Essen oder ein bisschen Geld bettelten.
»Hey, Mia, schläfst du?«, riss Hensen ihre Freundin, die stumm aus dem Fenster schaute, aus deren Gedanken.
»Ich habe Hunger.«
»Gehen wir zu dir nach Hause.«
»Wie, nach Hause? Ich wohne noch im Hotel.«
»Ich meine ins Miles, da warst du bestimmt schon lange nicht mehr. Und du bist bestimmt gespannt, wie das heute aussieht.«
»Definitiv«, sagte Mia und verzog das Gesicht.
Das Miles war früher, als es noch John Babic, Mias Vater, gehörte, ein angesagter Berliner Szeneladen gewesen. Mia war gerade 17 und mit dem Abitur fertig gewesen, als John den Laden an eine Eventagentur verkaufte und in die USA übersiedelte. Seine Tochter hatte keine Lust gehabt mitzugehen, was sollte sie auch in den USA. Vorzeigeschülerin, die sie war – sie hatte den scharfen Verstand ihrer Mutter Marisa, einer Neurologin an der Charité, geerbt – lebte sie die unvermeidliche pubertäre Rebellion gegen den von ihr vergötterten, aber »voll abgefahrenen« Papa mit regelmäßig und gewissenhaft erledigten Hausaufgaben, einem klassenbesten Notendurchschnitt und schließlich der Aufnahme eines Hochbegabtenstipendiums für ein Psychologiestudium an der Europäischen Privathochschule Berlin aus.
Als ihre Eltern Deutschland verließen, blieb sie die ersten Jahre in einem Zimmer über dem Miles wohnen, ging aber nicht mehr in die Kneipe, die sowohl ihren Stil als auch ihre Klientel vollkommen gewechselt hatte und nunmehr zum Schickimicki-Treff der intellektuellen Rich-Young-Urban-Elite, den legitimen Nachfolgern der Yuppies, geworden war.
»Mia, sieh’s positiv. Ich lade dich ein.«
»Können wir da auch über den Fall reden, dessentwegen wir uns eigentlich überhaupt treffen wollten?«
»Klar, außerdem gibt’s ’ne tolle Küche, super Bedienungen, und auch Di Marco lassen sie rein, wenn er so schön lächelt.«
Als sie fünf Minuten gefahren waren, meldete sich Di Marco.
»Leute, ich habe Durst«, sagte er und zeigte auf einen Kiosk.
Hensen hielt, und Di Marco sprang aus dem E-Mobil.
»Was wollt ihr?«
»Mineralwasser.«
»Ich auch.«
Di Marco ging auf einen Bettler zu, der an einer Hauswand saß, und gab ihm High-Five. Der Bettler freute sich sichtlich, ihn zu sehen, offensichtlich kannten sich die beiden. Di Marco drückte ihm einen Geldschein in die Hand und ging weiter Richtung Kiosk, vor dem sich eine längere Schlange reihte.
Hensen und Babic hatten ihn beobachtet.
»Di Marco ist ein echt netter Typ«, begann Richie den Small Talk. Sie drehte sich auf ihrem Sitz herum, um Babic anschauen zu können. »Lass dich von seinem lässigen Auftreten nicht täuschen. Er ist eigentlich ein ziemlich ernsthafter Kerl, klug und belesen. Stipendium für Bioinformatik und Philosophie in Stanford, das er kurz vor dem Masterabschluss abgebrochen hat, warum auch immer. Freiwilliges Engagement in verschiedenen sozialen Brennpunkten in den USA und in Berlin, hat Bildungsprogramme für ökonomisch Benachteiligte mit aufgebaut und war lange Zeit politisch aktiv bei Protesten gegen Maßnahmen zur Totalüberwachung von Netzbewegungen.«
Sie lachte kurz auf. »Bei ihm konnte auch keiner verstehen, dass er sich freiwillig für das Quereinsteigerprogramm der Kripo gemeldet hat, weder seine ehemaligen Mitkämpferinnen und Mitkämpfer noch die neuen Kollegen.« Sie grinste. »Und er sieht nicht schlecht aus, oder?
»Ganz nett. Willst du mich verkuppeln?«
Babic schaute zur Schlange. Di Marco, der bereits bis zur Hälfte aufgerückt war, lächelte ihr zu. Er sah wirklich gut aus.
»Wie steht’s eigentlich bei dir, Richie?«, wandte sie sich wieder an Hensen.
Sie war gespannt, ob sich beziehungstechnisch etwas bei Hensen verändert hatte. Richie Hensen bezeichnete sich selbst als »nur mittelmäßig beziehungsfähig«. Aber seit einer Weile schien sich was mit Burger, ihrem Chef, anzubahnen.
Hensen zögerte.
»Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen soll …«
Babic schwieg, das beste Mittel, um zögernde Menschen zum Weiterreden zu ermutigen.
»Wir haben uns letzte Woche mal getroffen, privat zu Hause, meine ich«, fuhr Hensen schließlich fort.
Hensen blickte zur Schlange. Di Marco stand schon ganz vorne. Wie machte der das?
Sie drehte sich wieder zurück zu Babic.
»Wir haben uns zum ersten Mal richtig ausführlich unterhalten«, sagte sie leise und schaute Babic offen ins Gesicht. »Das war echt …«
Die Fahrertür wurde aufgerissen.
»So, Mädels, euer Wasser.«
*
Auf dem Weg zum Miles passierten sie die Zentrale des militärischen Generalstabs der European Treaty Organization (EUTO), deren Fassade in diametralem Gegensatz zu einigen vom Verfall bedrohten Nachbargebäuden stand. Dann fuhren sie am neuen KaDeWe vorbei, vor dessen Eingang ein ganzes Bataillon von Security-Servanten wachte, und dessen Exklusivität bereits durch das imposante neoklassizistische Eingangsportal weithin demonstriert wurde. Schließlich kamen sie am Café Miles an, das auf den ersten Blick seinen Stil typischer Berliner Szenekneipen des ausgehenden 20. Jahrhunderts beibehalten hatte. Hensen parkte direkt vor dem Eingang auf einem VIP-Parkplatz.
»VIP?« Babic runzelte die Stirn.
»Na klar«, grinste Hensen und ignorierte das digitale Räuspern der vor dem Restaurant postierten Security-Servanten, deren Bestimmung weniger im Abweisen von Gästen lag als in der Vermittlung eines Gefühls von Sicherheit für die Kunden, die es sich leisten konnten. Die hier servierte Küche im Stil der Super-Nouvelle-Cousine war für die meisten Netzarbeiter nicht nur unbezahlbar, sondern auch wenig attraktiv.
Richie Hensen steckte ihren Bankchip in die dafür vorgesehene Öffnung eines auf der rechten Seite des Eingangsbereichs dezent verborgenen Terminals zur Überprüfung der »finanziellen Würdigkeit«, wie es die Restaurants heute nannten. Unter den strengen Blicken des Oberkellners bestand Hensens Chipkarte den Test, und sie wurden an einen Tisch direkt am Ausgang Richtung Toilette geführt.
Ungefähr ein Viertel der Gäste waren die üblichen vermögenden Privatiers, die sich bevorzugt an den teuren Plätzen der Städte aufhielten, wenn sie nicht gerade in den klassischen europäischen Touristenfallen der Reichen unterwegs waren – Sankt Moritz, Genfer See, Gardasee oder Nizza; ältere gepflegte Paare, denen man die Zugehörigkeit zur freien Klasse nicht nur an ihrem betont distinguierten Verhalten, sondern auch an der Kleidung ansah: glitzernde, weit geschnittene Anzüge in gedeckten Farben bei den Herren und enganliegende, die schmalen Hüften und üppigen Brüste betonende Schlauchkleider bei den auf späte Twens gemachten Frauen.
Das Gros der Gäste bestand jedoch aus der Out-of-Net-Worker-Elite: in teure Elite-Worker-Fashion gekleidete Frauen und Männer um die 30, alles erfolgreiche Werber, Anlageberater oder Rationalisierungsconsultants, die mindestens 70 Stunden die Woche arbeiteten und haufenweise Geld verdienten.
Hensen und Di Marco hefteten ihren Blick sofort auf die Speisekarte, die anderen Gäste, die das unpassend gekleidete Trio kritisch beäugten, bewusst ignorierend. Babic musste sich erst orientieren und schaute fast schon hektisch um sich. Draußen hatte sie noch gedacht, alles sei wie früher. Doch jetzt wurde ihr klar, dass von dem Ort, an dem sie aufgewachsen war, in dieser Glitzerwelt aus Silber, dunkelbraunem Tropenholz und blau schimmerndem Marmorboden, nichts mehr übriggeblieben war. Sie warf einer Frau am Nebentisch, die sie kritisch musterte, einen bösen Blick zu und nahm frustriert die Speisekarte in die Hand.
Di Marcos Augen weiteten sich, als Babic der etwas blasierten Kellnerin ihre Bestellung aufgab. Das Miles leistete sich – wie einige der Szenerestaurants, die vor allem von Leuten mit Privatvermögen und Out-of-Net-Workern, wie man die in Lohn und Brot stehenden Einwohner bezeichnete, besucht wurden − noch immer Kellner und Kellnerinnen, statt auf günstigere Service-Servanten umzustellen.
Babic blickte fragend zu Hensen. »Äh, ich glaube, das kostet ein Vermögen?«
Hensen nickte aufmunternd, ein glückliches Grinsen auf dem Gesicht.
Babic zuckte mit den Schultern. »Ich möchte bitte den Cocos-Avocado-Salat als Vorspeise, einmal Ingwer-Curcuma-Spaghetti, dann Esparragos à la Plancha mit Blue-Veltin-Potato-Stripes und zum Schluss noch ein Tiramisu.«
»Mia hat ihr Stipendium in einem Semester aufgegessen«, feixte Hensen, für die die Preise im Miles dank eines dicken großelterlichen Erbes sowie geschickter und glücklicher Aktienspekulationen kein Problem waren. Obwohl sie sich solche Ausschweifungen selten leistete und mittlerweile fast die gesamten Aktiengewinne in Ausbildungsprojekte für Jugendliche aus OON-Familien, aus Familien der Out-of-Net-Gefallenen, steckte.
»Witzbold.«
Als das Essen kam, rang sich Di Marco dazu durch, eine Frage zu stellen, die ihm schon die ganze Zeit auf der Zunge lag.
»Mia, du siehst irgendwie so, ich weiß nicht, so exotisch aus, wie …«, Di Marco zögerte, unsicher, ob er sich gerade lächerlich machte, »ach, ich weiß nicht.«
Hensens Stöhnen sprach Bände.
Babic lächelte schweigend. Sie war es gewohnt.
»Jetzt komm, erzähl schon. Du heißt doch Babic!«
Mia lehnte sich zurück. »Mein Vater ist zur Hälfte Ghanaer, zur anderen Hälfte Bosnier, dazu in Deutschland geboren und von Anfang an mit deutschem Pass. Meine Mutter ist eine Norddeutsche und sieht auch so aus. Und das Ergebnis ihrer Liebe bin ich. Außerdem muss ich solche Fragen ständig beantworten, also mach dir nichts draus.«
Di Marco schaute unglücklich drein, seine Frage schien ihm peinlich zu sein.
»Echt, ist schon okay!«, lächelte sie ihn an.
»Na gut.« Di Marco war nicht der Typ, dem etwas lange peinlich war, und er machte sich über seine vegetarische Moussaka her.
»Du, Di Marco«, auch Babic hatte Fragen, »woher hast du eigentlich im Supermarkt die Informationen über den Geiselnehmer gehabt?«
Di Marco grinste und bewegte seine Finger wie ein Pianist. »Magie!«
»Na klar. Komm, sag schon!«
»Das war eigentlich ganz einfach. 66 Prozent der Bevölkerung leben heute alleine. Wenn man bedenkt, dass der Typ im Supermarkt Dinge durch die Gegend schmiss, anstatt zu Hause seine Familie zu vermöbeln, lag die Annahme, dass er alleine lebt, doch ziemlich nahe.«
»Und dass er Physiotherapeut ist?«
»Hast du seinen Berufsverbandaufnäher an der Jacke nicht bemerkt?« Di Marco schüttelte den Kopf.
»Wie denn? Mein Kopf klemmte unter seinem Oberarm«, entgegnete Babic schnippisch. »Und seine Tante?«, hakte sie nach.
»Educated guess, sozusagen. Fast jeder Dritte hat eine Tante oder einen Onkel in den USA, darüber habe ich letzte Woche eine Studie gelesen. Außerdem lag ich damit ja nicht einmal richtig. Aber das hat er wohl nicht bemerkt.«
»Cool«, sagte Babic anerkennend.
»Wie heißt du eigentlich mit Vornamen, Di Marco?«, hakte sie nach.
Hensen kicherte. »Don Juan«, platzte sie heraus.
Di Marco warf ihr einen bösen Blick zu.
»Echt? Don Juan Di Marco? Feurig, feurig!«, amüsierte sich Babic.
»Quatsch, ich heiß Domuan, was auch immer das für ein Name ist, frag mich nicht. Wahrscheinlich wollten meine Eltern mich Domian nennen und haben sich vertan. Haben sie aber nie zugegeben. Richie Witzbold kam auf die Don-Juan-Idee, und seither muss ich mir diesen Scheiß ständig anhören.«
»Hast du ja auch verdient«, grinste Hensen, schob sich das letzte Blatt ihres kleinen Salats in den Mund, lehnte sich zurück und holte zufrieden eine Schachtel rauchfreier Nikotinsticks aus der Brusttasche ihrer Weste.
Als Babic die letzten Reste ihres Tiramisus vom Teller kratzte, zog Hensen bereits an ihrem zweiten Nikotin-Stick. Es war an der Zeit, Babic in den Fall, an dem sie vor allem arbeiten sollte, einzuweisen. Zwar begann ihre Arbeit offiziell erst morgen, und die Zuordnung von Fällen war eigentlich Burgers Sache, doch Vorinformationen konnten nicht schaden.
*
Exakt zur selben Zeit gab der zuständige Pathologe seinen Medizin-Servanten die Anweisung, dem aus den noch erkennbaren Teilen mühsam rekonstruierten Oberkörper des Jungen aus dem Supermarkt ein weißes Leichenhemd überzuziehen. Der Junge hatte sich als Sohn des amerikanischen Botschafters herausgestellt. Die Servanten hatten in seiner Geldbörse eine goldene Bankchipkarte gefunden und ihn in die pathologische Abteilung der Bundespolizei gebracht, in welcher für privat versicherte Opfer von Gewaltverbrechen eine spezielle Verstorbenen-Kosmetik angeboten wurde.
So sorgfältig sie den Jungen auch wieder hergerichtet hatten, so wenig half dies doch, als seine Mutter den Jungen identifizieren musste. »Das ist er«, sagte sie mit ruhiger Stimme und unbewegtem Gesicht und fiel in Ohnmacht.
Der leitende Untersuchungsbeamte der Stadtpolizei entschied sicherheitshalber, und da er sich angesichts der Herkunft des Jungen nicht traute, eine eventuelle terroristische Motivation des Geiselnehmers auszuschließen, den Fall der SBBK zu übergeben.
*
Hensen wusste von all dem noch nichts. Sie zog an ihrem Nikotinstick und sah Babic an, die sich gerade den letzten Löffel Tiramisu in den Mund schob.
»Was weißt du über Netzidentitäten?«
»Ich weiß, dass jeder über 18 eine Netzidentität braucht und zum normalen Pass einen Netzausweis bekommt.«
Dies geschah automatisch, per Zuteilung eines solchen durch die Bundesstaatlichen Netzverwaltungen, wobei man Wünsche hinsichtlich des Aussehens, des Namens und des Geschlechts äußern konnte. Die Netzidentität war die Grundlage der Virtual Work. Wenn man sich im Netz bewegte, ob man arbeitete oder sich vergnügte, dann im Normalfall mit dieser Identität, mit diesem Aussehen und mit diesem Geschlecht.
»Vor drei Jahren war die Netzidentität für einen Netzarbeitspflichtigen aber noch nicht so wichtig wie heute. Wenn du heute keinen Out-of-Net-Job hast, dann brauchst du die Netzidentität auch für fast alles außerhalb des Netzes, bis hin zum Wählen.«
Dass man nicht nur einen gültigen Pass, sondern auch einen gültigen Netzausweis brauchte, um wählen zu dürfen, war noch das Geringste. Wählen durfte, nach der Umsetzung einer Gesetzesinitiative, die auf eine Idee der europäischen Innenministerin Samira Hossein-Smith zurückging, ohnehin nicht mehr jeder. Wählen durfte nur, wer einen gültigen Wählerführerschein hatte, der vergeben wurde, wenn ein staatsbürgerkundlicher Test, den man alle acht Jahre wiederholen musste, bestanden wurde. Viel wichtiger war, dass man als Netzarbeitspflichtiger eine gültige Netzidentität für den Bezug des Bürgergelds brauchte. Dieses wurde jeden Monat automatisch auf die Konten der Networker überwiesen, und mit dem waren, solange man über kein Privatvermögen verfügte, die Kosten außerhalb des Netzes, wie Miete, Essen, Freizeitgestaltung und dergleichen, zu decken.
Für die Verteilung des Bürgergelds war die Regierung zuständig, die wiederum Steuern für die Netzbetreibung und Netzwerbung erhob, was letztendlich eine indirekte Bezuschussung der Regierung durch die European Assurance, den zentralen Vermarkter des Netzes, bedeutete.
Bürgergeld bezogen alle Menschen, die der Virtual-Work-Pflicht unterlagen, auch jene mit Privatvermögen. Die soziale Ungleichheit zwischen den Networkern, wie sie vor Einführung des Netzes bestanden hatte, war also nicht etwa abgebaut worden. Denn auch wenn es im Netz zumindest theoretisch für alle prinzipiell Chancengleichheit im Zugang zu allen gesellschaftlichen Bereichen gab, blieb außerhalb zumindest der Konsum von alltäglichen Dingen und vor allem von Luxusartikeln von der verfügbaren Geldmenge abhängig.
Hensen machte eine kurze Pause und legte ihren gebrauchten Nikotinstick auf eine Untertasse. Sofort war eine Kellnerin zur Stelle, um diese mit einem leichten Kopfschütteln fortzutragen, Babics leeren Tiramisu-Teller gleich mit.
Di Marco, der lange genug geschwiegen hatte, übernahm.
»Du brauchst die Netzidentität aber nicht nur für das Bürgergeld, wenn du netzarbeitspflichtig bist. Suchst du eine Wohnung und hast keinen Job außerhalb des Netzes, dann will der Vermieter entweder deine Kontoauszüge oder deinen Netzausweis sehen. Hast du keines von beidem, bekommst du kein Bürgergeld, kannst die Miete nicht bezahlen und bekommst deshalb auch keine Wohnung.«
Babic kannte das zum Teil schon aus den USA und den Telefonaten mit Hensen. »In Amerika ist es ähnlich, aber in vielen abgefuckten Gegenden fragen dich die Vermieter nach gar nichts, die rücken dir höchstens mal mit einem Messer auf die Pelle, damit du wenigstens einen Teil deines erbettelten oder erdealten Geldes abgibst.«
»Ist hier nicht anders«, schaltete sich Hensen wieder ein. »Was meinst du, wo die Leute bleiben, die weder Job noch Netzidentität haben? Du hast doch am Ku’damm die vielen Bettler gesehen. Die kriegen nicht mehr wie früher Sozialhilfe. Wenn sie Glück haben, dann dürfen sie eine Weile betteln. Wenn nicht, dann werden sie von Servanten in die Außenbezirke verfrachtet.«
»Diese Ghetto-Stories sind also keine Sozialpropaganda?«, fragte Babic.
»Der Anteil von Leuten ohne Netzidentität ist in Berlin bestimmt noch nicht so hoch wie in London oder Rom, aber groß genug.«
Babic hatte sich durchaus über die aktuellen gesellschaftlichen Zustände in den verschiedenen Hauptstädten Europas informiert. Es war noch immer so, dass die Personen, die keiner Netzarbeit nachgingen, aber nicht unter die Sonderregelungen fielen oder keine Sonderregelung beantragt hatten, im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Netz fielen. Ihnen wurde die Netzidentität entzogen, womit auch jeder Anspruch auf Bürgergeld und Internetnutzung entfiel.
»Haltet mich nicht für naiv, aber die Netzarbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Regierung haben in den letzten drei Jahren doch extrem zugelegt, weshalb gibt’s dann noch immer so viele Bettler auf den Straßen?« Für Babic war dies unbegreiflich. Als sie damals weggegangen war, war gerade mit groß angelegten politischen Programmen versucht worden, sozial Ausgegliederte in einfache Netzarbeiten einzubinden, um ihnen damit wenigstens die Möglichkeit zu geben, ihre Netzidentitäten zu erhalten und um auf die zunehmende Zahl an Bettlern zu reagieren. Angeschlagen hatte das, wie es jetzt aussah, offensichtlich nicht.
Nach der großen Weltwirtschaftskrise und den Energiemangeljahren 2031–33 war das normale Berlin schon in vielen Teilen verfallen. Dass Industrie und Senat kaum mehr in den Erhalt der städtischen Infrastrukturen investierten, sondern stattdessen ihre Gelder in die Netzpflege steckten, machte die Sache nicht besser.
Einige Regionen waren mittlerweile für den Durchgangsverkehr gesperrt und wurden nicht einmal mehr durch die Stadtpolizei, sondern durch Servanten-Patrouillen, zuweilen durch private Sicherheitsdienste sowie gelegentlich durch die politische Sicherheit kontrolliert. In diesen Bereichen wurden heute die als Out of Network klassifizierten Personen untergebracht, die OONs, Menschen ohne Privatvermögen, die, aus welchen Gründen auch immer, ihre Netzidentität und damit ihre Berechtigung zur Virtual Work und zum Bezug von Bürgergeld verloren hatten.
»Tja, die Industrie entzieht die Kohle, Geld wird jetzt mit dem Netz gemacht. Die Leute sind zufriedengestellt, entweder haben sie im oder außerhalb des Netzes Arbeit. Und was scheren einen die, die ganz rausfallen, solange sie nichts bedrohen?« Di Marcos Sarkasmus war nicht zu überhören.
Babic hätte gerne noch länger politisiert. Aber ihr war noch nicht klar, was dies mit ihrem ersten Fall zu tun hatte.
»Wir haben offenbar einen Serienmörder im Netz«, sagte Hensen, als hätte sie ihre Gedanken gelesen.
»Ach so?«, fragte Babic und zog eine Augenbraue hoch.
*
In der Pathologie der Bundespolizei wurden zum gleichen Zeitpunkt drei Leichen auf nebeneinander stehende Bahren gehievt: Arthur Mallmann, der Geiselnehmer David Fuller, dessen Identität der Polizei noch immer unbekannt war, und der Sohn des amerikanischen Botschafters.
»Im Tod sind sie alle gleich«, gab der leitende Pathologiepfleger eine alte Weisheit zum Besten. Der ihm zugeordnete Pathologie-Servant nickte wissend.
*
Hensen versuchte erfolglos, die Kellnerin auf sich aufmerksam zu machen, um sich einen Espresso zu bestellen. Sie zuckte mit den Schultern und wandte sich wieder Babic zu. »Du weißt, wie Serienmörder im Netz arbeiten?«
»Dir stehen im Netz alle Möglichkeiten zur Verfügung, jemanden zu töten«, mischte sich Di Marco ein. »Es funktioniert wie ein normaler Mord draußen, ist halt nur simuliert, also mit virtuellen Messern, Gift, Knarren und so weiter. Umbringen tust du ihn genauso, wie du ihn draußen umbringen würdest.«
Er nippte an seinem Mineralwasser.
»Der Witz an den Morden ist, dass sie reversibel sind. Dein Virtual-Reality-Programm checkt dich nach einer Stunde ohne Netzaktivität automatisch aus, du wachst auf, bewegst dich ein bisschen und trinkst einen, um den Schreck zu überwinden. Du musst den Mord dann bei der Netzverwaltung melden, die schaltet dich irgendwann frei, und danach kannst du wieder reingehen, als sei nichts passiert«, fügte Hensen an.
»Meistens zumindest, denn es kommt vor, dass derjenige, der im Netz ermordet wird, vor Angst auch wirklich stirbt.«
»Das passiert in immerhin 0,01 Prozent der Fälle. Weltweit waren das mehr als 500 Tote letztes Jahr«, kommentierte Babic.
»Natürlich hat Mia dazu ein Paper gelesen«, grinste Hensen.
Babic winkte ab. »Klar, hier wird die Polizei routinemäßig eingeschaltet. Aber das passiert ja nur selten. Wann kommt ihr in den anderen Fällen ins Spiel? Du kannst doch gleich wieder rein ins Netz, wenn du den Mord gemeldet hast?«
»Wir kriegen normalerweise nur was mit, wenn sich die Geschädigten beschweren und eine Ermittlung durch die SBBK fordern.« Di Marco hatte Glück bei der Kellnerin und bestellte zwei Espressi, einen für sich und einen für Hensen.
Er zwinkerte Hensen zu und holte zur Erklärung aus. »Das kommt immer wieder vor. Wenn du im Netz ermordet wirst, musst du einen Antrag auf Wiederauferstehung stellen, wie der Volksmund das nennt. Wenn du genug Geld hast, dann geht dies relativ schnell, wenn du keine finanziellen Mittel hast, musst du warten.«
»Und in der Zeit kannst du keine Netzdienste in Anspruch nehmen und kassierst kein Bürgergeld«, konstatierte Babic.
»Gut, Mia«, grinste Di Marco.
»Mit solchen Sachen haben wir oft zu tun, Leute kommen, beschweren sich, Ermittlungen werden aufgenommen, es wird versucht, den Leuten Übergangsgelder zu bezahlen und so weiter«, schaltete sich Hensen wieder ein. »Aber das ist nicht das Hauptproblem bei unserem Fall.«
Offenbar fühlte sie sich nicht wohl, denn sie rutschte auf ihrem Designerstuhl hin und her.
»Bei unserem Fall wurden in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer wieder Netzidentitäten ermordet, und zwar auf alle möglichen Arten: aufgeschlitzt, überfahren, erschossen, erschlagen. Also ganz normale Netzmorde, die gemeldet werden müssen, und dann bekommen die Leute irgendwann ihre alte Identität wieder.«
Hensen zog an ihrem dritten Nikotinstick.
»So sah es zumindest aus. Einem neuen Kontrolleur in der Netzverwaltung, der gerade erst eine Woche im Job war, kam es zunächst seltsam vor, dass niemand kam, um die Morde zu melden. Die automatische Netzüberwachung gab zwar an, dass die Morde geschehen waren, aber es tauchte eben niemand auf, um eine Wiederauferstehung zu beantragen.«
Sie legte den Nikotinstick beiseite.
»Eingeschaltet wurden wir dann, als die Identitäten plötzlich wieder da waren, ohne dass die Netzverwaltung etwas unternommen hatte. Der Kontrolleur hat das nachgeprüft, bevor er zu uns kam.«
»Hat er euch mitgeteilt, wem die Identitäten gehören? Und habt ihr schon Kontakt mit den Leuten aufgenommen und nachgefragt, was da los ist?«
Babic wusste, dass ihre Frage eine rein rhetorische war, sonst wäre dies wohl kaum ein besonderer Fall gewesen.
Hensen richtete sich auf. »Keines von beidem. Wir haben den Kontrolleur beauftragt herauszufinden, zu welchen Personen die Netzidentitäten gehören.«
»Und?«
Hensen kramte einen mobilen Holografen aus ihrem Rucksack und stellte ihn auf den Tisch. Eine 3D-Darstellung einer spärlich beleuchteten Gasse flackerte auf.
Ein Mann am Nachbartisch räusperte sich missbilligend.
Hensen streckte, ohne hinzuschauen, ihren Dienstausweis in die Luft.
Der Mann schüttelte den Kopf und widmete sich wieder seiner Hummersuppe mit grünem Spargel.
»Zwei Tage später lag er mit durchgeschnittener Kehle in einem Hauseingang in Friedrichshain. Laut den ermittelnden Beamten der Stadtpolizei, das waren übrigens Haak und Strickle, die du ja schon kennengelernt hast, handelte es sich um einen von einer Jugendgang verübten Mord.«
Der Holograf zeigte einen untersetzten Beamten, der sich über eine am Boden liegende Gestalt beugte.
»Haak?«
Hensen nickte und spulte zurück.
»Die Satellitenüberwachung lieferte keine brauchbaren Bilder. Aber wir haben Bilder von einer alten Überwachungskamera. Nur HD-Format.«
Der Holograf zeigte einen knapp 30-jährigen dünnen Mann in Hawaiihemd und Cordhose, der – offenbar leicht angetrunken – durch die Gasse schlenderte.
»Jetzt pass auf!«
Aus dem Halbdunkel eines Hauseingangs trat eine füllige Frau mit kurzem Rock, großer Sonnenbrille und toupierten wasserstoffblonden Haaren.
»Pass auf, die Frau hat wohl gewusst, wo die Kamera installiert ist. Ihr Gesicht ist kein einziges Mal in der Frontaleinstellung zu sehen.«
Die Frau folgte dem Mann. Dieser drehte sich irritiert um. Als er sah, dass es sich bei seinem Verfolger um eine Frau handelte, nickte er ihr freundlich zu. Plötzlich rannte die Frau auf ihn zu und schien ihn zu umarmen. Der Mann brach zusammen, um seinen Kopf bildete sich eine Blutlache.
Hensen zoomte auf den Mann. Seine Augen waren weit aufgerissen, er hatte eine klaffende Wunde am Hals. Die Frau war so schnell verschwunden, wie sie aufgetaucht war.
Hensen stoppte die Aufnahme.
Jetzt räusperten sich schon mehrere der Gäste an den Nachbartischen.
Hensen ignorierte sie. »Und?«, fragte sie Babic.
»Das ist wahrscheinlich keine Frau.«
»Warum? Das Gesicht ist doch kaum zu sehen?«
Babic lehnte sich zurück. »Drei Punkte. Spul mal kurz zurück … Ja, halt.
Schau mal, wie sich die angebliche Frau bewegt. Sie geht breitbeinig. Hier, schau, greift sie sich an den Po, als ob der Rock sie stört. Stopp …«, sagte Babic. Hensen hielt den Film an.
Di Marco kniff die Augen zusammen und nickte dann. »Dass mir das vorher nicht aufgefallen ist.«
Hensen räusperte sich. »Hey, könnt ihr mich mal aufklären?«
Di Marco wandte sich ihr zu. »Schau mal auf die Bewegung der Brust beim Niederbeugen. Das sieht doch nicht echt aus?«
Hensen sah genauer hin. »Tatsächlich.«
Babic fuhr fort: »Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Indikatoren, wie zum Beispiel das Unterschenkel-Hüft-Verhältnis. Aber egal, das ist keine Frau. Außerdem, da ist noch was anderes.«
Sie holte einen bleistiftförmigen Stick aus der Tasche, steckte ihn in den Holografen und gab ein paar Befehle in ihr Visiophone ein. Im Bild erschien ein roter Pfeil, der vom Kopf der Frau zum Seitenrand des Hologramms reichte.
»Passt auf. Es sieht so aus, als ob die Frau immer wieder zur gleichen Stelle schaut.«
Sie schaltete den Film wieder an, und der Pfeil bewegte sich hin und her. Sie wandte sich an Hensen.
»Mit absoluter Sicherheit kann ich das natürlich nicht sagen, weil wir das Gesicht nicht richtig auf dem Schirm haben. Habt ihr Bilder von der Stelle, wohin die Pfeile zeigen?«
»Nein, die müssen irgendeinen Störsender eingesetzt haben, sodass wir in diese Ecke keinen Einblick haben.«
Hensen schaltete den Holografen aus und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück.
»Habt ihr schon herausbekommen, welche Personen hinter den wieder auferstandenen Identitäten stecken?«, fragte Babic.
»Da sind wir gerade dran«, erläuterte Di Marco. »Es gibt aber ein Problem. Die anderen Kontrolleure der Netzverwaltung geben an, dass sich die Gesamtzahl der Netzidentitäten nicht verändert habe, und weigern sich deshalb, Auskunft zu geben, wem die vernichteten Netzidentitäten gehörten.«
»Und warum?« Bei Babic hatte es noch nicht geklickt.
»Wir haben keine Berechtigung, die Identitäten der realen Personen zu erfahren, denen die Netzidentitäten gehörten …«
»… weil die Gesamtzahl der Netzidentitäten ja gleich geblieben ist, das Problem für die Verwaltung somit ein nur bürokratisches ist und die Netzverwaltung deshalb keine Aufhebung des Datenschutzes erlaubt.« Jetzt hatte Babic kapiert, worum es ging.
»Aber wie kann man dann überhaupt herausbekommen, zu wem die Identitäten gehören?«
»Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die erste funktioniert nur, wenn die Netzidentitäten, die ermordet wurden und wieder auferstanden sind, schon mal im Netz straffällig geworden sind«, erklärte Hensen.
Die Netzverwaltung musste gegenüber einem Beamten der Bundespolizei, einem Beauftragten einer staatlichen Organisation oder einem Sicherheitsangestellten der European Assurance die reale Identität eines Networkers trotz Datenschutz dann offenlegen, wenn diese Person im Netz, in ihrer Netzidentität also, einmal straffällig geworden war.
»Also versuchen wir zu überprüfen, ob die ermordeten und wieder auferstandenen Identitäten schon mal im Netz straffällig geworden sind, dann erhalten wir die Namen der Besitzer und können schauen, ob mit der Auferstehung alles koscher war.«
Mia Babic erwärmte sich zusehends für Arbeit, die auf sie zukam. »Aber wenn dies nicht der Fall ist, dann stehen wir auf dem Schlauch. Welche Möglichkeiten gibt es noch?«
»Ins Netz gehen und mit den wiederauferstandenen Netzidentitäten Kontakt aufnehmen, um mehr zu erfahren«, erklärte Di Marco. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dachte er sich und sah Babic an. Sie schien die Geiselnahme gut verkraftet zu haben, ihrem ironischen Lächeln nach zu schließen. Ihre weißen Zähne kontrastierten schön mit dem sonnengebleichten Haar, das ihr ovales Gesicht umrahmte.
»Di Marco, konzentrier dich«, murrte Hensen. »Es gibt eine Sache, die alles noch zusätzlich erschweren könnte.«
»Komm, mach’s nicht so spannend.«
»Die Netzidentitäten könnten alle auch von nicht-netzarbeitspflichtigen Personen stammen.«
»Und die sind anonym«, schloss Babic, die langsam das Gefühl hatte, dass ihre grauen Zellen wieder funktionierten wie früher.
Sie wusste, dass man sich als Arbeitsloser, wenn man über ein entsprechendes Vermögen verfügte, mit der einmaligen Zahlung einer auf 250.000 Euro festgelegten Summe an die Bundesstaatliche Netzverwaltung und mindestens einer 1,000.000 Euro liquidem Privatvermögen, das jährlich nachgewiesen werden musste, von der virtuellen Arbeitspflicht befreien lassen konnte. Man verlor dabei nicht die Berechtigung, virtuell zu arbeiten oder die Möglichkeiten virtueller Freizeitgestaltung zu nutzen. Man wurde aber nicht mehr kontrolliert.
Babic hatte gehört, dass die von der Netzarbeitspflicht befreiten Reichen deshalb regelrechte Narrenfreiheit im Netz genossen. Sie hatten sogar das Recht auf absolute Anonymität. Beantragte eine solche Person beispielsweise eine Netzidentität, um sich im Netz zu amüsieren oder einer virtuellen Arbeit nachzugehen, dann durfte diese Identität nicht mehr zum Besitzer zurückverfolgt werden, außer die Netzverwaltung hob die Immunität auf, was so gut wie nie geschah.
Die Anonymität ermöglichte den Reichen natürlich einen großen Handlungsspielraum zum virtuellen Ausleben sexueller Neigungen und krimineller Energien. Vor diesem Problem stand die SBBK immer wieder, wenn virtuelle Vergewaltigungen, Körperverletzungen oder Belästigungen auftraten, die nicht zu realen Personen zurückverfolgt werden konnten und die daher nach gängigem Recht ungeahndet bleiben mussten.
»Okay«, Babic fasste zusammen, »wenn wir die Namen der Personen nicht kriegen, dann könnten es entweder unauffällige Networker oder aber Netzarbeitsbefreite sein, die sich im Netz amüsieren wollen. Für unsere Ermittlungen wird dies aber wohl bedeutungslos sein. Oder?«
Sie wartete keine Antwort ab, sondern fuhr fort:
»Jetzt ist mir aber eines noch nicht klar.« Sie lehnte sich zurück. »Warum hat die SBBK in Berlin mit der Sache zu tun? Die Inhaber der eliminierten Netzidentitäten könnten doch von überall herkommen, aus der ganzen Welt?« Babic stellte sich vor, was für ein Aufwand es wäre, durch die ganze Welt reisen zu müssen, um die realen Personen zu befragen.
»Das kommt daher, dass die Netzverwaltung zu einem großen Teil automatisch operiert. Auch bei Computern weiß manchmal die linke Hand nicht, was die rechte tut«, erklärte Hensen. »Wenn gravierende Netzverbrechen geschehen, dann meldet die Netzverwaltung diese Verbrechen automatisch an den SBBK-Bezirk, aus dem die realen Identitäten der Opfer kommen.«
»Obwohl die Identitäten wieder auferstanden sind und deshalb die Auskunft der Namen verweigert wird? Mann, ist das ein komisches System.«
»Exakt.« Hensen hatte schon lange aufgehört, sich über die Praktiken der Netzverwaltung aufzuregen. »Wir erfahren zwar nicht unbedingt, wer geschädigt wurde, was wir aber auf jeden Fall gemeldet bekommen, ist der Bezirk, aus dem die Leute stammen.«
»Und die kamen alle aus Berlin und Umgebung?«
»Genau.«
Hensen richtete sich auf.
»Damit unsere Aufgaben klar sind: Zu versuchen, die realen Identitäten über das Strafregister zu ermitteln, ist eine Pflichtaufgabe, die Di Marco morgen bei der Netzverwaltung erledigt. Falls dies ohne Ergebnis bleibt, wirst du das Verhalten der Netzidentitäten analysieren müssen, damit wir ihre Gewohnheiten und Vorlieben kennen und Strategien entwickeln können, um mit ihnen im Netz Kontakt aufzunehmen.«
Hensen wusste, dass sich das nicht schwierig anhörte. Wer allerdings einmal mit dem Gewirr aus Bürokratie, Filz und Behinderungen zu tun gehabt hatte, das sich vor einem aufbaute, wenn man Virtual-Crime-Fälle untersuchte, dem war klar, dass ein verzwicktes Stück Arbeit auf ihn zukam.
Hensen stand auf und zog ihre Jacke an. Di Marco seufzte, nahm noch einen Schluck Wein, auf den er sich schon die ganze Woche gefreut hatte, und stand ebenfalls auf. Babic blieb nichts anderes übrig, als es den beiden gleichzutun.
»Die Rechnung bitte.« Richie Hensen mochte die Lokale der RYUE, der Rich-Young-Urban-Elite, eigentlich gar nicht. Dennoch gefiel ihr, dass man noch so tat, als würde man tatsächlich mit echtem Cash bezahlen. Kein Abfertigen am Ausgang – Chipkarte rein ins Terminal, Drehtür auf – nein: richtiges Bezahlen, mit Kellner, Rechnung, Creditcard abgeben, Trinkgeld angeben und so weiter. Hensen fühlte sich jedes Mal retro wie in den guten alten Zeiten.
Die ersten Takte des Jailhouse Rock-Refrains erklangen.
Di Marco zog sein Visiophone aus der Tasche. »Was gibt’s, Burger?« Er wandte sich von der Kameralinse ab und zwinkerte Hensen grinsend zu.
»Spinner«, murmelte Hensen.
Je länger das Gespräch, zu dem er allenfalls einen Satz beisteuerte, dauerte, desto angespannter wirkte Di Marco. Schließlich gab er Hensen und Babic ein Zeichen, ihre Jacken anzuziehen.
»Wir sind gleich da, wir bringen Babic mit.«
»Was ist los?«, fragte Hensen beim Rauslaufen.
Di Marco wirkte elektrisiert. »Arthur Mallmann ist ermordet worden.«
»Ui.« Babic hatte, als sie zum ersten Mal wählen durfte, mit ihrem Vater diskutiert, ob man die EPD überhaupt wählen könne. Ihr Vater fand es super, dass endlich das Bürgergeld realisiert wurde. Sie selbst war ziemlich skeptisch gewesen. Mallmann wurde damals Arbeitsminister und nach einer Legislaturperiode von den Medien zum Vater der europäischen Virtual Work ernannt.
Kaum bei der Arbeit und schon ein solcher Hochkaräter.