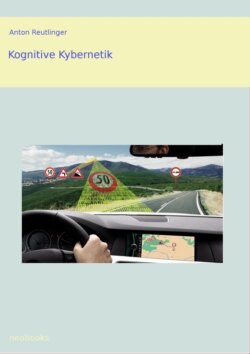Читать книгу Kognitive Kybernetik - Anton Reutlinger - Страница 6
Kognition und Zeichen
ОглавлениеAlles was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, nehmen wir als Formen wahr. Die Sinnesorgane übersetzen die Welt der Wirklichkeit aus Sinnesreizen in die Form von Nervensignalen, mit denen das Gehirn intern arbeitet, um eine subjektive Welt der Vorstellungen zu erzeugen, um die Welt innerlich zu "repräsentieren". Somit sind quasi unendlich viele Formen möglich, die einfach sein können oder aus einfachen Formen zusammengesetzt sein können. Die unendliche Vielfalt der Formen wird reduziert durch Abstraktion, Aggregation und Approximation zu einer handhabbaren Menge von Zeichen, die dem Bewusstsein als Vorstellungen präsentiert werden. Zeichen sind erkennbare, identifizierbare und wiederkehrende Muster, Formen oder Gestalten der Wahrnehmung, denen auf Grund einer Funktion oder eines Zweckes des wahrnehmenden Subjekts eine Bedeutung zukommt oder beigemessen wird, wenn sie in regelmäßigen Zusammenhängen mit anderen Zeichen erscheinen. Unterschiedliche Kontextinformation wie Perspektiven, Formvarianten, Lichtverhältnisse oder andere Wahrnehmungsbesonderheiten können dabei eliminiert, substituiert oder an bekannte Formen approximiert werden. Solche Mechanismen sind aus der Wahrnehmungspsychologie bekannt. Ein eindrucksvolles Beispiel ist der sogenannte Ames-Raum, in dem eine markante Perspektivenverzerrung stattfindet.
Die Zeichen, in der Form von Chiffren, bilden das Material unseres Denkens. Die Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge der Wahrnehmungen und Erfahrungen, die Identitäten und Ähnlichkeiten sowie die Unterschiede der Formen und Bewegungen resultieren in den Funktionen des Denkens wie Identifizieren, Klassifizieren, Generalisieren, Spezialisieren, Aggregieren, Segregieren. Das Denken findet seinen spiegelbildlichen und äußerlichen Ausdruck insbesondere in der Sprache, in den Bedeutungen ihrer Wörter als Begriffe, in ihren grammatischen Formen zur Bildung von Sätzen und Aussagen. In die Sprache eingebettet ist die Logik als Ausdruck einer speziellen Form, des abstrahierenden, verbindenden, ordnenden, urteilenden und schlussfolgernden Denkens. Die materiale Logik, die mit den Bedeutungen von Wörtern operiert, ist nahe der Linguistik, die formale und symbolische Logik, die mit bedeutungslosen Formen, Zeichen oder Symbolen operiert, ist näher zur Mathematik. So ist die Logik über das Denken und die Sinne mit der Natur des Geistes und mit der Natur der Welt verknüpft.
Das bedeutet auch, dass Logik oder Mathematik und Natur kommensurabel sein müssen, wenn man davon ausgeht, dass die Natur nicht ausschließlich chaotisch oder zufällig funktioniert. Die Ursprünge dieses logischen Denkens zeigen sich bei Kleinkindern im Alter von wenigen Monaten, wenn sie erkennen, dass Objekte, die zeitweise verdeckt waren, nicht verschiedene oder neue Objekte sind, sondern dass es dasselbe Objekt ist. Das heißt, es erkennt, dass Objekte nicht plötzlich im Nichts verschwinden und neue Objekte nicht plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Die Erkenntnis von Persistenz und Identität von Objekten und folglich die Erkenntnis von Verschiedenheit und Veränderung bildet die Grundlage des logischen und rationalen Denkens.
Unter der Annahme einer gesetzmäßigen Funktionsweise der Wirklichkeit wie auch der Sinnesorgane gibt es regelmäßige, strukturelle Eigenschaften der Zeichen und Beziehungen zwischen den Zeichen. Der Anblick des Löwen erzeugt das Zeichen "Löwe" und erhält instinktiv die Bedeutung "Gefahr" oder unmittelbar "Flucht" zugeordnet. Neben den durch die Phylogenese natürlich bestimmten und gegebenen Zeichen gibt es als Hervorbringung der Ontogenese und der Ratiogenese die von Menschen gemachten Zeichen wie die Schrift- und Zahlzeichen sowie Zeichnungen, technische und kulturelle Symbole und schließlich die lautlichen Sprachzeichen. Diese Zeichen können dazu dienen, andere Zeichen, besonders die von den Sinnen erzeugten Zeichen, zu vertreten, um somit eine kommunizierbare Welt der Zeichen und Symbole zu erzeugen. Dadurch erst wird es möglich, auf der Grundlage der Unterscheidung von Form und Bedeutung der Zeichen, über Zeichen selber zu reden, eine notwendige Operation des Geistes für Denken und Sprechen und Begründung für das notwendige Vorhandensein eines Formen- oder Zeichengedächtnisses neben dem Gedächtnis für Bedeutungen.
Intern werden nur Zeichen verarbeitet, indem sie in andere Zeichen übersetzt und mit anderen Zeichen verknüpft und in Beziehung gesetzt werden. Diese rekursiven Prozesse sind es, die neue Zeichen schaffen, die die Bedeutungen der Zeichen bestimmen und somit das Verhalten und das Leben insgesamt lenken. Denken geschieht in Zeichen. Die Form der Zeichen spielt dabei keine Rolle, sie sind beliebig. Es können ikonische Zeichen sein wie die Hieroglyphen, Muster wie die chinesischen Schriftzeichen oder abstrakte und kombinierbare Zeichen wie die lateinischen Buchstaben. Die Sprachlaute dagegen sind anatomisch vorgegeben. Bedeutung bekommen die Zeichen erst durch den Gebrauch in der Gemeinschaft. An sich tragen sie prinzipiell keine Bedeutung.
Es ist Aufgabe der Anthropologie, im besonderen der Neuropsychologie, die Funktionen, Eigenheiten und Gesetze der Wahrnehmung aus ihrer Entwicklung heraus zu verstehen und zu bestimmen, um daraus die Anfangsgründe der Erkenntnis, des Denkens und der Vernunft ableiten zu können. Der Entwicklungsgedanke - Phylogenese als Gegenstand der evolutionären Erkenntnistheorie, Ontogenese als Gegenstand der Entwicklungspsychologie und Ratiogenese als Gegenstand der Erfahrung und Pädagogik - und die semiotische Trennung von Form und Bedeutung ist der entscheidende Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Erkenntnis- und Vernunftfähigkeiten.
Man kann also die Semiotik in zwei Bereiche teilen. Ein Teil umfasst die von Menschen willkürlich geschaffenen Zeichen als gestalterische Repräsentation der Bedeutung von Gedanken und Ideen, sowie die aus der sinnlichen Wahrnehmung entstandenen natürlichen Zeichen, die einer Deutung durch Erfahrung oder Erleben und einer daraus folgenden Zuordnung von Bedeutung bedürfen. Die beiden Bereiche willkürlich und natürlich sollen hier als explizite und implizite Semiotik bezeichnet werden. Die Wahrnehmung eines Dreiecks als implizites Zeichen kann die Form eines Vulkankegels oder eines Hausdaches darstellen. In der Mathematik oder als Verkehrszeichen hat das Dreieck als explizites Zeichen eine jeweils festgelegte Bedeutung.
Die von Menschen explizit geschaffenen Zeichen bringen die Welt der Sprache, der Schrift und der Informationen hervor und bilden die Grundlage für die zwischenmenschliche Kommunikation und ebenso für die Anwendung des Computers. Ihr Charakteristikum ist, dass sie auf unterschiedlichen Substraten dargestellt werden können, wie Papier oder elektronisch im Computer und auf dem Bildschirm, weil ihr Zweck davon unabhängig ist. Daraus folgt die irrtümliche Theorie, dass auch die Funktionen des Gehirns auf unterschiedlichen Substraten oder Maschinen realisiert werden könnten, wie sie von verschiedenen Kognitionswissenschaftlern vertreten wird. Irrtümlich ist die Theorie deshalb, weil die impliziten Zeichen der Wahrnehmung von ihrem Substrat abhängig sind, d.h. also von den physiologischen Gegebenheiten des Nervensystems. Somit können sie nicht auf andere Substrate übertragen werden ohne ihre Identität zu verlieren. Es ist selbstverständlich, dass die expliziten Zeichen so gestaltet sein müssen, dass sie wahrnehmbar und identifizierbar sind, analog den impliziten Zeichen, denn beide Zeichenformen unterliegen gleichermaßen den Eigenschaften und Möglichkeiten der Sinnesorgane.
Jedes Zeichen kann mehrere Bedeutungen haben, das heißt, es kann verschiedene Beziehungen zu verschiedenen anderen Zeichen eingehen, die zueinander nicht bedeutungskompatibel sind. Der Grund dafür sind gemeinsame Teileigenschaften oder Teilfunktionen, aus denen sich in einem sich verändernden kulturellen Milieu unterschiedliche Bedeutungen entwickelt haben oder indem neuartige Funktionen ohne eigenes Zeichen einem bereits verfügbaren Zeichen zugeordnet werden. Man nennt dies Polysemie oder auch Homonymie oder man sagt, das Zeichen gehört verschiedenen semantischen Feldern an. Auf einer Bank kann man sitzen oder Geldgeschäfte tätigen, aber nicht beides gleichermaßen; beiden gemeinsam ist die Teilfunktion der Lagerung als Motiv der Mehrfachbedeutung, die auf den Ursprung der Geldgeschäfte an Tischen in den Straßen von Venedig zurückgeht. Die Objektivität begrifflicher Bedeutungen ist daher eine Grundvoraussetzung für die Objektivität wissenschaftlicher Aussagen und Theorien.
Eine Menge von Zeichen als Alphabet und zugehörige Regeln zur Kombination der Zeichen, die dazu dienen, einen begrenzten Ausschnitt der Wirklichkeit zweckmäßig zu beschreiben, zu repräsentieren oder abzubilden, wird als Kode bezeichnet. Kodierung ist die Übersetzung von einem Zeichensystem in ein anderes, wobei die wesentliche Bedeutung erhalten bleiben soll, aber die Form und häufig auch der Zeichenträger verändert wird; oftmals ist das sogar der Zweck der Kodierung oder Transkodierung zur Darstellung, Speicherung und Übertragung der Zeicheninhalte mittels verschiedener physischer Medien. Nichts anderes machen biologische und technische Sensoren. Die Zeichen in der physischen Form werden als Signale bezeichnet. Kodierung kann also sowohl auf der logischen Ebene zwischen Zeichen verschiedener Alphabete als Transkodierung wie zwischen logischen Zeichen und physischen Signalen, als auch zwischen verschiedenen physischen Signalen stattfinden. Kodierung kann auch als regelhafte Darstellung von Bedeutung in einem spezifischen Substrat verstanden werden. Die wahrgenommene Welt ist bereits ein Kode, der durch die physiologische Funktionsweise der Sinnesorgane vorgegeben ist. Das Nervensystem ist ein Signalsystem.
Jede Information, unabhängig von ihrer Bedeutung, ist also bereits kodiert. Das Kodierungssystem Sprache gründet auf dem endlichen Alphabet der Buchstaben und einer großen Menge von Kodewörtern, die im Verlauf der kulturellen Evolution gebildet wurden. Eine Grammatik erlaubt die Kombination der Kodewörter zu einer unendlichen Vielfalt von Sätzen als Informationen, so dass die unendliche Vielfalt der Welt erschöpfend kodiert werden kann. Dieses Kodierungssystem bietet die nötige Flexibilität, um jederzeit neue Kodewörter zu bilden und den Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Erkenntnis und ihrer beständigen Verwandlungen Rechnung zu tragen. Da die Sinnesorgane aller Individuen auf Gund ihrer biologischen Komplexität nicht absolut gleichförmig sind und durch Krankheit und Alterung sich verändern können, ist auch die Kodierung nicht absolut gleich und unveränderlich. Einander sehr ähnliche Zeichen können dann nicht mehr ausreichend oder eindeutig unterschieden werden.
In der Sprache der Semiotik ausgedrückt ist das Signifikat oder die Referenz eines Zeichens - auch das Interpretans in der semiotischen Triade nach C.S.Peirce (1839-1914) - selber wieder ein Zeichen, also auch ein Signifikans. Die Zeichenformen können sich in ihrem Typus unterscheiden - Index, Icon oder Symbol nach Peirce - und in ihrer Bedeutung durch ihre jeweiligen Beziehungen zu anderen Zeichen. Die Zeichnung eines "Weihnachtsbaums" als Signifikans verweist beim Empfänger der Botschaft auf die bildliche Vorstellung von einem Tannenbaum im Wohnzimmer mit Lichterkette, Lametta und Geschenken als Signifikat. Vielmehr jedoch ist zu unterscheiden zwischen Zeichen, die mittelbar auf andere Zeichen verweisen wie das Sprach- oder Schriftzeichen "Weihnachtsbaum", und unmittelbaren Zeichen, also solchen, die von den Sinnesorganen und den körperlichen Empfindungen unmittelbar selber erzeugt werden wie der Anblick eines Weihnachtsbaums als sogenannte Referenten. Die mittelbaren Zeichen ermöglichen die vielfältige Zergliederung und Rekombination der Lebenswelt als Abstraktion, somit die adäquate, reintegrative Repräsentation der Dynamik ihrer Veränderungen durch Unterscheidung von Varianten und Invarianten oder Individuen und Universalien, zum Beispiel die im Namen erhaltene Identität einer Person über die Entwicklung vom Baby zum Erwachsenen. Universalien sind Zeichen für gemeinsame, invariante Eigenschaften oder Merkmale einer Menge von Individuen; sie sind nicht Zeichen für reale Objekte.
Mittelbare Zeichen können augenscheinlich nicht nur über mehrere, letztlich unendlich viele Beziehungsschritte verweisen, bezeichnet als "unendliche Semiose", sondern obendrein Mengen von Zeichen mit bestimmten Beziehungen zueinander zu einem einzigen wirkmächtigen Zeichen aggregieren, wie z.B. "Auto" oder gar das allumfassende "Universum". Die Funktion der Aggregation dient der Ökonomie des Denkens und hat ungeheure Bedeutung für die geistigen Fähigkeiten des Menschen zur Strukturierung seiner Lebenswelt. Digitalcomputer dagegen sind zur Aggregation nicht fähig, sie bleiben immer auf der Bitebene. Um an die Information des aggregierten Zeichens zu gelangen, muss es allerdings stufenweise wieder in seine Bestandteile aufgelöst werden als Disaggregation oder Segregation, z.B. "rotes, kleines Auto mit Fließheck, Schiebedach, zwei Türen" bis zu den Bauteilen im Falle einer Reparatur.
Die Kognition ist ein nach außen abgeschlossenes System, das sich nur mit seinen Zeichen beschäftigt. Es gibt keinen Zugang zur Außenwelt, außer den durch Lernen und Erfahrung gewonnenen Zusammenhang und die Koinzidenz zwischen den Zeichen der verschiedenen Sinnesorgane - in der Gemeinsamkeit von betasten, hören und sehen insbesondere - sowie den Zugang über den angeborenen und den erlernten, physiologisch bestimmten, daher nur schwerlich veränderbaren Zusammenhang zwischen den Zeichen und den motorischen und sekretorischen Signalen des Gehirns, deren Auswirkungen selber wiederum als Zeichen sinnlich wahrnehmbar sind. Daraus folgt, dass Wahrnehmung und Geist sinnlichen Fehlfunktionen, Täuschungen, Illusionen und Halluzinationen ausgesetzt sind, die reflexiv nicht ohne weiteres als solche erkennbar sind und in Einzelfällen medizinische oder psychotherapeutische Maßnahmen notwendig machen können.
Der Physiker Moritz Schlick (1882-1936) hat das Dilemma der rogorosen Trennung von innen und außen in seiner Allgemeinen Erkenntnislehre beschrieben:
"Ein mit Hilfe impliziter Definition geschaffenes Gefüge von Wahrheiten ruht nirgends auf dem Grunde der Wirklichkeit, sondern schwebt gleichsam frei, wie das Sonnensystem die Gewähr seiner Stabilität in sich selber tragend. Keiner der darin auftretenden Begriffe bezeichnet in der Theorie ein Wirkliches, sondern sie bezeichnen sich gegenseitig in der Weise, dass die Bedeutung des einen Begriffs in einer bestimmten Konstellation einer Anzahl der übrigen besteht."
Weiter über die Beziehung zwischen der Wirklichkeit und der Begriffswelt:
"Wir beziehen beide Spären wohl aufeinander, aber sie scheinen gar nicht verbunden, die Brücken zwischen ihnen sind abgebrochen." Und weiter kommt er zu der für die Naturwissenschaft bedeutsamen Schlussfolgerung "alle unsere Wirklichkeitserkenntnisse sind [..] streng genommen Hypothesen."
Als klassischer Physiker und Realist steht er an der Schwelle der alten zur neuen Welt der Erkenntnis. Dagegen steht der Philosoph Ernst Cassirer (1874-1945), für den in seiner Philosophie der symbolischen Formen die Wirklichkeit ein System von Ideen in Form symbolischer Zeichen ist, der also offensichtlich schon von der Semiotik geprägt ist, bereits auf dem Boden der von Planck und Einstein geprägten Physik. Das Kennzeichen der neuen Weltanschauung ist die Ablehnung der Abbildtheorie, d.h. die Zurückweisung der Auffassung von einer naturgetreuen Kopie der Außenwelt in der Innenwelt, die wiederum auf Hermann von Helmholtz (1821-1894) zurückgeht. Cassirer bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt:
"Der wissenschaftliche Verstand ist es, der nunmehr die Bedingungen und Ansprüche seiner eigenen Natur zugleich zum Maß des Seienden macht."
In Anlehnung an H.v.Helmholtz schreibt er:
"Unsere Empfindungen und Vorstellungen sind Zeichen, nicht Abbilder der Gegenstände. Denn vom Bilde verlangt man irgendeine Art von Gleichheit mit dem abgebildeten Objekt, deren wir uns niemals versichern können. Das Zeichen dagegen fordert keinerlei sachliche Ähnlichkeit in den Elementen, sondern lediglich eine funktionale Entsprechung der beiderseitigen Struktur."
Die Welt, die wir wahrnehmen, ist nicht die Welt, die ist. Es gibt viele mögliche Anschauungen der Welt. Unsere sinnliche Erfahrung ist nur eine davon, eine andere ist die wissenschaftlich-rationale Repräsentation. Die Sinneseindrücke aus der Welt werden irreversibel in Nervensignale umgewandelt, nicht als Kopie oder visuelle Repräsentation, sondern als Transformation, die wir nicht kontrollieren können und noch nicht mal vollständig verstehen. Alles was wir wahrnehmen, ist in Wirklichkeit sinnesgeleitete Fiktion, oder Konstruktion unseres Erkenntnisapparates mit dem Resultat einer inneren Weltbeschreibung. Eine Abbildung repräsentiert die Welt, wie wir sie wahrnehmen und erkennen, ein sprachliches Zeichen oder ein Symbol repräsentiert sie, wie wir sie verstehen und deuten. Willkürlich ausgehend von einer Welt physikalischer Atome als kleinste wahrnehmbare Einheit und als annähernd unveränderliche "Präformation", besteht die Welt aus Strukturen von Atomen, die wir gelegentlich über die Sinne wahrnehmen, einschließlich unser Selbst als Gegenständlichkeit. Die mittels elektrischer Ladungen auf ein technisches Gerät wirkenden Elektronen sind dieselben Elektronen, die im Atomverbund mittels der Reflexion von Licht auf unsere Augen einwirken. Das Fenster dessen, was wir wahrnehmen können, ist eng begrenzt auf Strukturen bestimmter Ausdehnung, bestimmter Entfernung, bestimmter Bewegung, bestimmter Lebensdauer, bestimmter Eigenschaften und Verhaltensweisen. Das Fenster ist letztlich begrenzt durch unsere eigene Lebenszeit. Die Strukturen sind in ihrer Abgrenzung und Gestalt nicht eindeutig und nicht unveränderlich, weil sie gemäß den physikalischen Gesetzen in unterschiedlicher Art und Weise beständig aufeinander einwirken, so dass Strukturen von Strukturen erkennbar werden. Die innere Beschreibung der Strukturen wird bestimmt von den Prägungen unseres Wahrnehmungs- und Erkenntnisapparates, die sich als Schablonen der Wahrnehmung im Verlauf der Evolution sowie der individuellen frühkindlichen Entwicklung für die Bewältigung unseres Lebens gebildet haben, von Deutungen, die wir ihnen auf Grund kulturellen Erbes und aus eigener Erfahrung zuordnen, und von Zweckmäßigkeiten für unser Leben, zur Erhaltung unserer eigenen Struktur.
Die Welt ist eine Menge von uns umgebender physikalischer Strukturen, die wir auf Grund ihres regelhaften Verhaltens, wie der Gleichmäßigkeit ihrer Gestalt, ihrer Eigenschaften und ihrer Bewegungen, als Formen und Zeichen einer Wirklichkeit erkennen können, über die wir Erfahrungen sammeln, denen wir Bedeutung zuordnen wenn wir sie verstehen, auf die wir selber als physische Struktur interaktiv und reflexiv einwirken und deren irreversible und periodische Veränderungen wir als Zeit deuten.
Verstehen ist die Übersetzung aus der Sprache der Wahrnehmung in die Sprache der Erfahrung. Die Sprache erweitert die Bereiche der individuellen Wahrnehmung und Erfahrung um die entsprechenden Bereiche der Mitmenschen und eröffnet damit einen unbeschränkten Zugang zur Welt und zu den Menschen. Die für uns erfahrbare Welt ist weder zwingend noch notwendig, sondern der kontingente, gegenwärtige und wandelbare Zustand von Ausschnitten der Wirklichkeit als Modelle: ein Modell der Welt, sowie ein Modell des unmittelbaren Lebensbereiches und ein Modell des Selbst und des Ich, eine "individuelle Welttheorie", wie der Kommunikationsforscher Gerold Ungeheuer (1930-1982) schrieb, oder als "semantische Modelle", wie der Psychologe Kenneth Craik (1914-1945) sie bezeichnete. Die Modelle enthalten als innere Beschreibungen die Namen, die Eigenschaften, die Relationen zueinander und die Verhaltensmöglichkeiten der Elemente des jeweiligen Modellbereiches.
Dreiecke sind Modelle für eine bestimmte Eigenschaft, nämlich die dreieckige Form wirklicher Objekte, indem die idealisierte und symbolisierte Eigenschaft durch ein eigens konstruiertes Objekt namens Dreieck repräsentiert und mit ihm identifiziert wird. Stühle können viele verschiedene Formen haben, können die Form verändern oder auflösen und dadurch ihre Funktion verlieren, oder ihre Formen können anderen Zwecken dienen. Daher sind Theorien über die Welt, zur Anthropologie, zur Psychologie und letztlich zur Philosophie immer so plastisch wie der Mensch in seiner Selbstdeutung. Die Bedeutung, die wir den Dingen der Welt zuordnen, wird im Verlauf des Lebens durch die Erfahrung und die Kommunikation mit der Welt fortlaufend gebildet, zunehmend verfeinert und ihren Wandlungen im Gebrauch angepasst. Sie ist nicht in den Dingen und nicht in den Wörtern, sondern in der Vorstellung und im Bewusstsein jedes einzelnen Menschen. Die Kommunikation zwischen Menschen wird scheitern, wenn die Bewusstseinsinhalte nicht aufeinander abgestimmt sind und Missverständnisse oder Missdeutungen hervorbringen.
Eine Beziehung zwischen Zeichen ist eine Aussage oder Information, wenn sie explizit oder implizit mit einem Wahrheitswert verbunden wird. In der Alltagssprache wird der Wahrheitswert weggelassen, weil man im allgemeinen nur an wahren Informationen interessiert ist und ihre Wahrheit stillschweigend vorausgesetzt wird. Die Aussage "es ist wahr dass, .." ist im Alltagsgebrauch daher redundant und wird nur benötigt, um Missverständnisse zu beseitigen oder der Wahrheit besonderen Nachdruck zu verleihen. Sehr häufig vorkommende Beziehungen sind die "ist"-Beziehung und die "gehört zu"-Beziehung, zum Beispiel "ein Hund ist ein Tier" oder "Schnee ist weiß". Ihre Bedeutung sowie ihr Wahrheitsgehalt können nur wieder über Beziehungen zwischen Zeichen bestimmt werden. Es gibt keine Möglichkeit, Wahrheit als eine Wirklichkeit letztgültig zu erkennen oder nachzuweisen, weil das kognitive System keinen anderen Zugang zur Wirklichkeit seiner Außenwelt hat als über seine Zeichen der Wahrnehmungen, Empfindungen, Erkenntnisse, Vorstellungen und Ideen. Die Welt im Kopf ist die subjektive Beschreibung der scheinbar wirklichen Welt. Nur indirekte Kriterien wie Widerspruchsfreiheit, Logik, Plausibilität, Schlussfolgerungen (Inferenzen) und Kohärenz mit anderen Aussagen, Beziehungen und Zeichen können zur Prüfung und Bestimmung des Wahrheitsgehaltes verwendet werden. Die Wahrheit ist ein notwendiges Beiprodukt der Sprache und ist strukturell eng mit Beschreibung, Bedeutung und Verstehen verbunden als ein subjektives Geflecht von Zeichen und regelmäßigen Beziehungen, indem aus Beziehungen und Beziehungsregeln verwandte Beziehungen erschlossen werden können.
Die Bedeutung einer Aussage oder Beschreibung liegt in ihrer Wirkung auf das Subjekt, gleichwohl als Sprachgemeinschaft wie als Individuum, in der Form von Überzeugung, Erkenntnis, Wissen, Zielsetzung und schließlich Möglichkeit, Absicht und Ausführung von Handlungen und Sprechakten. Die Wahrheit des Satzes "ein Hund ist ein Tier" ist nicht allein aus dem Satz selber oder seinen Teilen zu erschließen, sondern nur dann, wenn die subjektiven Vorstellungen zu den Zeichen Tier und Hund passend sind, d.h. wenn wir zu Tier und Hund gemeinsame wahre Beziehungen herstellen auf Grund von Sinneswahrnehmungen oder Gedanken, wie z.B. "kann sich frei bewegen und selbstständig ernähren". Während Bedeutung also eine Wirkung der Sprache auf das Subjekt ist, ist die Wahrheit eine Wirkung des Subjekts auf die Sprache.
Die Sprache bietet die Möglichkeit, beliebige Zeichen zueinander in Beziehung zu setzen, unabhängig von Wahrheit und Wirklichkeit, unabhängig von Wahrnehmung, Erinnerung und Handlung. Daher sind zur Klarstellung die sprachlichen Wahrheitswerte "ungewiss" und "unbekannt" notwendig, zusätzlich zu den logischen Werten wahr und falsch. Jeder Mensch hat einen Geburtstag und eine Augenfarbe, auch wenn ihr genauer Wert für Andere ungewiss, aber erfahrbar ist, so dass ein Platzhalter vorgesehen werden kann. Dagegen hat nicht jeder Mensch ein Auto oder ein Handy, deren Attribute, wie das Kennzeichen, daher nicht existent und unbekannt sind. Der Informationsgehalt beider Wahrheitswerte ist somit nicht genau gleichwertig, denn "ungewiss" in diesem Sinn beinhaltet die Kenntnis der Existenz, so dass der Informationsgehalt etwas höher ist.
Wegen der Unabhängigkeit der Sprache von sinnlichen Wahrnehmungen kann zwischen einem sprachlichen Konstrukt als Aussage und der Beschreibung einer Wahrnehmung ein Widerspruch entstehen. Das ist die Begründung für die Erfindung des Wahrheitsbegriffes. Wahrheit ist die Äquivalenz zwischen der Bedeutung eines Sprachkonstrukts und der sprachlichen Beschreibung einer Wahrnehmung, Erinnerung oder Handlung zu demselben Sachverhalt. Der Wissenschaftsphilosoph Bas van Fraassen (*1941, The Scientific Image 1980) bezeichnet eine solche Auffassung als "empirische Adäquatheit" im Rahmen des konstruktiven Empirismus. Das Problem dabei ist, dass konkurrierende Theorien zur Erklärung eines Phänomens zwar jeweils empirisch adäquat, aber zueinander inkompatibel sein können, wie Wellen- und Teilchentheorien. Man kennt die Differenzen zwischen Zeugenaussagen zum Hergang von Unfällen oder Verbrechen, weil sie oftmals bereits Deutungen oder Wertungen der Beobachtungen als Theorien beinhalten. Unberücksichtigt bleibt dabei die zusätzliche Möglichkeit der unbewussten Wahrnehmungs- und Erinnerungstäuschungen. Absolute, bedingungslose oder universale Wahrheit ist eine Fiktion oder ein Ideal wie die Unendlichkeit oder die Ewigkeit, ein hilfreiches, aber unwirkliches Produkt des Denkens. Wahrheit besitzt Gültigkeit immer nur in Bezug zu vorausgesetzten Axiomen, Definitionen oder Annahmen.
Daher ist es möglich, auch Zeichen wie "Einhorn" zu akzeptieren und darüber gültige Aussagen zu machen, ohne mit der Wahrheit in Konflikt zu geraten. Der Konflikt kann dann entstehen, wenn die Sinnesorgane, einschließlich der Sinne der Haut wie Berührung, Druck und Temperatur, als Ursprung des Zeichens an der Beziehung beteiligt werden: "ich habe das Einhorn gestreichelt". Der Ausdruck "Das Einhorn ist ein Reittier" ist mit Zeichen zu vergleichen, die ein Einhorn als Reittier abbilden, wobei eine Regel der Beziehung zwischen Einhorn und reiten darin besteht, dass ein Mensch auf einem solchen Tier sitzen können muss. Gibt es ein solches Zeichen, dann ist der Ausdruck wahr, unabhängig von der Wirklichkeit. Dagegen ist kein Zeichen "Einhorn" bekannt im Zusammenhang mit kohärenten Zeichen der anderen Sinne in einer für ein Einhorn geeigneten wirklichen Umgebung. Daher ist die Vermutung berechtigt, dass es das Einhorn nicht in der Wirklichkeit gibt, wohl aber in der Vorstellung geben kann. Da Wahrheit also von subjektiver Erkenntnis abhängig ist, kann sie nicht absolute Gültigkeit beanspruchen, sondern hat immer hypothetischen Charakter. Insofern können auch Glaubenssysteme wie die Theologie konsistent sein, solange sie nicht die sinnliche Wahrnehmbarkeit oder Erfahrbarkeit transzendenter Entitäten behaupten.
Die Schaffung von Zeichen ohne Bezug zu den Sinnen ist eine der herausragenden Leistungen der menschlichen Kognition und hat die Kultur hervorgebracht, hat in der Form politischer Ideologien aber auch viel Unheil angerichtet. Wahrheit ist selber ein Begriff der Sprache ohne Bezug zur Wirklichkeit. Das Leben verlangt nicht Wahrheiten, es begnügt sich mit Argumenten zur Begründung und Rechtfertigung von Sätzen oder Äußerungen. Der Philosoph Hans Albert (*1921) bezeichnet den Letztbegründungsanspruch für Wahrheit, ausgehend von Aggripas Trilemma der antiken Skeptiker, als Münchhausen-Trilemma, weil jeder Versuch der Letztbegründung notwendig in einem infiniten Regress, einem Zirkelschluss oder dem willkürlichen Abbruch enden müsse. Ebenso ist die allmähliche Annäherung von Erkenntnis an Wahrheit im Verlauf wissenschaftlicher Forschung eine Illusion, weil dazu die Wahrheit bereits bekannt oder erkennbar sein müsste. Dann aber wäre eine Annäherung nicht mehr nötig. Dass die Begründung der Wahrheit von Äußerungen im wirklichen Leben oftmals sekundär ist, zeigt die Wirkung von Gerüchten. Dann hängt die Akzeptanz von Botschaften sehr viel stärker von der Verlässlichkeit oder Vertrauenswürdigkeit der Nachrichtenquelle ab als vom Inhalt der Nachricht.
Zusammengefasst lassen sich drei Begründungsschichten von Wahrheit unterscheiden: das rationale Denken, die sinnliche Wahrnehmung, die Bedeutung der sprachlichen Begriffe. Die sprachlichen Begriffe reflektieren das Denken, die Wahrnehmung, die Erfahrungen und das Erleben, sie bestehen also nicht unabhängig. Eine mögliche vierte Schicht zur Letztbegründung wäre die Transparenz oder Selbstoffenbarung und Verlässlichkeit der Erkenntnisquellen. Diese Schicht müsste dann eine überweltliche, gottgleiche Wesenheit sein, so wie Descartes es in seinen Meditationen zur Philosophie annahm. Aus der Wahrheit von Erkenntnis ließe sich dann notwendig die Existenz dieser Wesenheit ableiten.
Von der Wahrheit zu unterscheiden sind Wissen und Kenntnis, weil sie der Möglichkeit des Irrtums ausgesetzt sind. Den Unterschied kann man verdeutlichen anhand der bekannten Fernsehserie "Wetten dass". Die Kandidaten haben ein Wissen als eine Menge von Überzeugungen und Kenntnissen um Sachverhalte, weswegen sie als Kandidaten ausgewählt sind. Wissen stellt eine Beziehung her zwischen dem Subjekt des Wissens - einem Wettkandidaten als Beispiel - und einer Menge zweckmäßiger, handlungsbestimmender Informationen oder Kenntnisse als prozedurales Wissen oder einer Menge von Aussagen oder Propositionen bzw. Informationen oder Überzeugungen als deklaratives Wissen. Der Wahrheitsgehalt des Wissens wird jedoch erst im Verlauf der Wette bestimmt, wenn es darum geht, das Wissen an den Sachverhalten der Wirklichkeit zu prüfen. Die Wirklichkeit ist nur über subjektive Wahrnehmung, Erfahrung und Erleben zugänglich. Daher ist eine Korrespondenz oder Übereinstimmung mit der Wirklichkeit kein verlässliches Wahrheitskriterium.
Wissen ist - wie Informationen - eine Menge von Zeichen und Beziehungen zwischen Zeichen; Zeichen und Beziehungen formen Strukturen. Wahrheit als Merkmal des Wissens dagegen beschreibt die Beziehung zwischen den Zeichen des Wissens und den Zeichen der tatsächlichen Wahrnehmungen durch die verschiedenen Sinnesmodalitäten. Historisches Wissen muss auf Erzählungen von Augenzeugen, meist über mehrere Instanzen, auf Dokumente oder auf archäologische Artefakte bezogen werden, um den Anspruch auf Wahrheit prüfen zu können. Wahrnehmung überhaupt und die Beschränkung auf eine einzige Modalität der Wahrnehmung im besonderen kann leicht zu Täuschungen führen. Wenn man weiß wie Wölfe heulen, kann man Wolfsgeheul akustisch erkennen, aber trotzdem nicht mit dem Anspruch auf Wahrheit behaupten, dass das gehörte Geheul tatsächlich von einem Wolf stammt, denn es könnte von einer Person nachgeahmt sein oder von einem geeigneten Instrument oder Tonträger kommen. Der Wahrheitscharakter der Wahrnehmung ergibt sich aus ihrer Einbettung in ein System vergangener und gegenwärtiger Wahrnehmungen, also Situationen, Erfahrungen und Gewohnheiten und der daraus folgenden Kompatibilität oder aber Widersprüchlichkeit. Wahrnehmung ist nie isoliert oder redundanzfrei, wenn sie zuverlässig ist. Der Wahrheitsbezug von Wahrnehmung, Erfahrung und Erleben ist eingebettet in das Netzwerk von biologischer Evolution, Entwicklung des Individuums und der Kultur mit traditionellen Weltdeutungen, mit Sprachgewohnheiten, Technologien und Kommunikationsformen. Das bedeutet automatisch, dass Wissen, Erkenntnis und Wahrheit immer von Vorwissen oder von Theorien abhängig sind und keine Ewigkeitsgültigkeit beanspruchen können.
Wissen ist auch ohne Wahrheitsanspruch ausreichend für die praktische Lebensbewältigung, solange es keine Gründe gibt, das Wissen zu verwerfen oder zu ersetzen, sei es durch eigene Wahrnehmung und Erfahrung, durch Lernen oder durch Nachrichten von Mitmenschen. Besonders bei Unfällen ist schnelles Handeln meist wichtiger als die letzte Wahrheit um Zustand, Hergang und Ursache. Wissen ist potenzielle Erfahrung. Seine Bedeutung spiegelt sich in der Erwartung von Ereignissen und den Notwendigkeiten, Möglichkeiten und Freiheiten eigenen Handelns. Die Qualität des Wissens offenbart sich in der Kongruenz von Erwartung und Erfahrung und in erfolgreichem Handeln, also in seiner Zuverlässigkeit. Dabei liegt der Wert nicht so sehr in der Zuverlässigkeit der Vergangenheit, sondern im Versprechen der Zuverlässigkeit für die Zukunft.
Damit ist leicht einzusehen, dass Wissen und Wissenschaft entscheidende Voraussetzungen sind für zielorientiertes, erfolgreiches Planen und Handeln zur Bewältigung und Gestaltung des Lebens. Die Menschen erwarten, dass Medikamente und technische Geräte wie vom Verkäufer versprochen sehr zuverlässig funktionieren, nicht nur manchmal, vielleicht, hoffentlich, gelegentlich, zufällig oder nur unter günstigen Umständen. In aller Regel gehört dazu das Wissen um den Grund oder die Ursache des Funktionierens oder der Wirkung. Daraus ergibt sich der Zweck und die Bedeutung der Kenntnis und Anwendung wissenschaftlicher Methodik als Gegensatz zum Glauben, Vermuten und Meinen. Der Unterschied zwischen Wissen und Glauben liegt somit nicht in Wahrheiten oder Beweisen. Wahrheit ist die logisch ableitbare oder die empirisch bestätigte Zuverlässigkeit von Wissen. Schon William James hatte diese als Instrumentalismus oder Pragmatismus bezeichnete Einstellung zur Bedeutung von Wahrheit vertreten. Dabei ist zu bedenken, dass individuelles Wissen nie isoliert bewertet werden darf, sondern als Teilmenge des Weltwissens in inferenziellen Netzwerken von Aussagen und Bedeutungen notwendig zu diesem kompatibel sein muss. Die Inkompatibilität von Relativitätstheorie und Quantentheorie zueinander ist bislang das größte Problem der Physik.
Wörter als Zeichen, sowie Beziehungen zwischen Zeichen bilden das Fundament der Sprache. Die Grundform des grammatikalischen Satzbaus mit Subjekt, Prädikat, Objekt entspricht der Struktur Zeichen-Beziehung-Zeichen genauso wie der Grundstruktur logischer Aussagen mit Subjekt und Prädikat. Das Objekt ist bei einer logischen Aussage implizit oder explizit bereits im Prädikat enthalten. Die Sprache liefert die Möglichkeiten, die Zeichen in komplexere Beziehungen einzubetten wie Zeit und Raum, Ursachen und Wirkungen, Mengen und Elemente, Zwänge und Möglichkeiten, Einzahl und Vielzahl und andere Gegebenheiten der Wirklichkeit und des Denkens.
Da Menschen ein allgemeines und gemeinsames Weltverständnis haben, muss in der Sprache nicht jede Beziehung explizit zum Ausdruck gebracht werden. Schon ein Minimalsatz wie "es regnet" beschreibt ein ganzes Szenarium an Erscheinungen, Gegenständen, Ereignissen und Zuständen in Raum und Zeit. Der Empfänger der Botschaft kann sich auf Grund seiner Kenntnisse, Erinnerungen, Gewohnheiten und Lebenserfahrungen eine Vorstellung davon machen und dem Satz einen Bedeutungsrahmen geben, indem er implizit eigene Zeichen und Beziehungen hinzufügt, von denen er meint, dass sie der Intention des Sprechers genügen. Der Sprachphilosoph Paul Grice (1913-1988) nennt solche Ergänzungen Implikaturen. Es sind unausgesprochene Referenzen zur Welt der Kommunikationspartner, die als bekannt angenommen werden. Dass hierin Quellen für Missverständnisse und Ursachen für das Misslingen der Kommunikation liegen, man denke an die räumliche und zeitliche Verteilung der Kommunikationspartner im Internet, mit diversen Problemen und Fehlermöglichkeiten für die Kognitive Kybernetik als Folge daraus, dürfte klar sein. Berühmt geworden sind die sogenannten "Krisenexperimente" des Soziologen Harold Garfinkel (1917-2011), in denen sowohl die Vagheit der Sprache als auch die für den Erfolg eines Kommunikationsvorgangs maßgeblichen stillen Vorannahmen und Konventionen deutlich gemacht wurden. Für die Kommunikation zwischen Maschinen ist die natürliche Sprache daher nicht geeignet und muss ersetzt werden durch eine formalisierte Sprache.
"Das Pferd ist mein Onkel". Dies ist offenkundig ein sinnloser Satz bzw. eine sinnlose Beziehung zwischen Sprachzeichen. Woran aber ist die Sinnlosigkeit einer Beziehung zu erkennen? Unser Weltwissen sagt uns, dass Verwandtschaftsbeziehungen nur sinnvoll sind zwischen Menschen oder allgemein in einer Population einer Spezies. Auch dieser Satz stellt eine Beziehung dar, hier die Beziehung "ist sinnvoll" zwischen einem Beziehungstyp und einem Objekttyp. Das Problem ist also nicht wirklich gelöst, sondern nur um eine Stufe verlagert, auf eine Metaebene der Sprache, denn das Wissen über die Welt ist letztlich wieder nur durch Sprache darstellbar und vermittelbar. Das kann nur bedeuten, dass zusammen mit dem Erwerb der Sprache das Weltwissen zum Gebrauch der Sprachzeichen mitgelernt werden muss. Die Lösung ist ein Prozess des Bootstrapping zum Spracherwerb, bei dem mit wenigen Zeichen beliebigen Typs - zum Beispiel Bilderbücher - begonnen wird, die dazu benutzt werden, neue Sprachzeichen zu beschreiben und dadurch den Sprachumfang allmählich aus sich selbst heraus auszubauen. Dieser Bootstrapping-Prozess ist möglich durch die riesige Redundanz der sprachlichen Begriffe, Regeln und Ausdrücke, die es ermöglicht, Zeichen mit unbekannter Bedeutung in Beziehung zu setzen zu Zeichen bereits bekannter Bedeutung und ihnen dadurch eine Bedeutung zuzuordnen.
Im Zusammenhang mit Kybernetik und Zeichen sind die Begriffe Daten und Signale zu behandeln, die vielen Missverständnissen ausgesetzt sind. Beide Begriffe beschreiben Teile von Informationen. Als Daten werden die Entitäten bezeichnet, die in der Information zueinander in Beziehung stehen. In dem Ausdruck "A ist Vater von B" sind A und B die Daten, die durch "ist Vater von" zueinander in Beziehung gesetzt werden. In Tabellen tritt die Beziehung, z.B. "ist Vater von", meist als Spaltenüberschrift auf und die Daten erscheinen als Zahlen- oder Zeicheneinträge in einer Zeile.
Ein Signal beschreibt die Festlegung des Wahrheitswerts einer bestimmten Information, insbesondere die Veränderung seines Wahrheitswertes, meist von Falsch nach Wahr oder von Undefiniert nach Wahr. Der Informationsgehalt eines Signals ist also genau ein Bit. Beispiele für Signale sind der Startschuss für ein Sportereignis, das Läuten des Weckers oder die Verkehrsampel. Ein Signal markiert ein Ereignis oder eine Zustandsänderung. Zu beachten ist bei beiden Begriffen, dass der Rest der Information beim Empfänger bereits als Wissen bekannt sein muss. Beim Startsignal weiß der Sportler, was er zu tun hat, auf welche Information sich das Signal also bezieht; oder umgekehrt: einer Information bzw. Handlung kann ein bestimmtes Signal zugeordnet sein. In einem weiteren Sinn bilden Signale die Brücke zwischen Materie und Information oder Körper und Geist, weil sie als bedeutungstragende Wahrnehmung und Transformation materieller oder energetischer Zustände eines Signalträgers verstanden werden können. Selbstverständlich werden Daten und Signale durch Zeichen repräsentiert.
Die Übertragung von Daten und Informationen und darauf aufbauend die Kommunikation setzt sich aus bestimmten, immer wiederkehrenden Prozessen zusammen. Der Sender beginnt mit der Expression seiner Gedanken, Ideen, Gefühle, dessen was er kommunizieren will. Das zu Übertragende wird dabei in Text, Sprache, Töne oder Bilder kodiert. Damit ein Empfänger die Intentionen des Senders verstehen kann, muss die Kodierung festgelegten Konventionen genügen. Die Übertragung auf bestimmten, oftmals mehreren verschiedenen Medien auf dem Übertragungsweg zwischen Sender und Empfänger erfordert jeweils dafür geeignete, spezifische Kodierungen, so dass für die Übertragung insgesamt mehrere Transkodierungen notwendig sein können. Auf der Empfängerseite muss die Information entsprechend dekodiert werden. Schließlich muss der Empfänger die dekodierte Information interpretieren, als Impression auf sich wirken lassen. Am Ende steht die Applikation, die Anwendung der Information als Ausführung einer Handlung oder als Aktivierung einer Maschine.
Ein Komponist drückt seine Ideen in Tönen auf seinem Musikinstrument aus. Die Kodierung erfolgt als Zeichen in dem bekannten Notensystem, wodurch die Musik als Information in Raum und Zeit gespeichert wird. Die Übertragung der Noten an Musiker geschieht über die Papierform oder über elektronische Übertragung im Internet als Bitmuster. Der Empfänger kann die Noten lesen, verstehen, interpretieren und als seine eigene Impression auf seinem Instrument wiederum als Expression spielen, möglicherweise beruflich als Applikation in einem öffentlichen Konzert. Die Übertragung der Musik an sich geschieht im Prinzip auf dieselbe Weise: über die Expression zur Aufzeichnung und Kodierung mittels Digitalisierung als Bitmuster auf CD oder im Internet und die Transkodierung in der Soundkarte des Computers und im Lautsprecher und schließlich den Empfang und die Dekodierung über das Ohr im Nervensystem. Letztlich wirkt die Musik wieder als Impression mit psychophysiologischen Reaktionen auf das Gemüt.
Kybernetik ist als eine organisierte Handhabung ausgewählter Zeichen und Symbole zu verstehen. Der Umfang des Zeichenvorrats, sowie die Schnelligkeit und die Zuverlässigkeit, mit der Zeichen erkannt und zu anderen Zeichen in Beziehung gesetzt werden, ist eine wichtige oder sogar die wichtigste Komponente der Intelligenz. Ein anschauliches Beispiel für die Verarbeitung von Zeichen in einem komplexen Zeichensystem ist die Arbeit der Piloten in den Flugzeugen und die der Fluglotsen in den Kontrollräumen mit einer Vielzahl fachspezifischer Zeichen sehr unterschiedlicher Zeichentypen aus vielen unterschiedlichen Quellen zur dynamischen Steuerung und Kontrolle des Flugverkehrs. Die kybernetische Bedeutung, die hier der zuverlässigen Erkennung, Weitergabe und Verarbeitung der Zeichen zukommt, muss nicht eigens betont werden, sie gilt für die Jäger eines Naturvolkes bezüglich des lebensnotwendigen Jagderfolgs genauso wie für Fluglotsen.