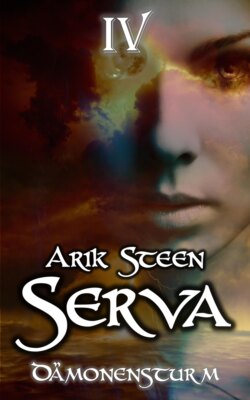Читать книгу Serva IV - Arik Steen - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der 22. Tag
Оглавление1
Insel der Lucrezen,
Tempel von Deux
Der Tempel von Deux war vermutlich eines der ältesten Bauwerke auf ganz Ariton. Er bestand aus einem pyramidalen Unterbau, der sich von unten nach oben verjüngte, aus einem darauf gesetzten viereckigen Tempelgebäude und einem spitzen Dachkamm. Der pyramidenförmige untere Teil des gesamten Baukomplexes barg viele geheime Gänge und Räume. Erreichbar waren sie jedoch nur über das oben aufgesetzte viereckige Gebäude. Eine breite steinerne Treppe führte auf einer der vier Seiten nach oben. Der Weg hinauf war steil.
William, der Barbar, war ein großer, kräftiger Mani. Zum ersten Mal stand er unterhalb des Tempels und blickte nach oben. Er war einer der zwölf Ritter des Lichts. Viele Jahre war er nun in den Bergen südlich der Wüste Gory gewesen und hatte dort eine große Armee von Chimären aufgebaut. Auf ganz Ariton gab es insgesamt sechs sogenannte «Nester». Schließlich war von Medjanagardaz der Auftrag gekommen hinüber zur Insel der Lucrezen zu fahren. Sofort hatte er sich auf den Weg gemacht. Endlich. Nach so langer Zeit gab es etwas zu tun.
«Herr, wir sind bereit!», sagte eine Chimäre: «Was sind Eure Befehle?»
«Bleibt dicht hinter mir!», sagte William. Er schaute zurück. Fast hundert Chimären standen hinter ihm. Es waren flügellose Chimären. Sie konnten deshalb nicht fliegen, waren aber deutlich kräftiger und konnten gut mit dem Schwert umgehen. Drei Jahre züchtete er sie nun in den Bergen, nicht allzu weit weg von der Stadt Thalos. Viele Pravinfrauen hatte er dafür entführen lassen. Er wusste gar nicht mehr wie viele. Als Leihmütter für die ungewöhnlichen Kreaturen. Natürlich hatten die Pravin sich gewundert, dass Frauen verschwunden waren. Vor allem Jüngere. Man erzählte sich Geschichten. Aber keiner konnte ahnen, dass sie in den Bergen gefangen gehalten wurden um Woche für Woche neue Chimären zu gebären. Ein schreckliches Schicksal, das die meisten dieser Frauen nur wenige Monate überlebten. Viele brachten sich selbst um, stürzten sich von den Felsen. Oder aber sie starben an der enormen körperlichen Belastung. Doch meist war Zeit genug, um fast schon im Akkord zahlreiche dieser Monster zu gebären.
Nun hatte William diesen Auftrag und war froh darüber. So lange hatte er darauf gewartet. Drei Jahre hatte er in den gottverdammten Bergen verbracht und auf einen Augenblick wie diesen gewartet. Und nun stand er vor dem Tempel. Bereit ihn einzunehmen. Bereit jeden Priester zu töten, der sich darin verschanzte.
Es würde dem Glauben der Völker eine tiefe Wunde hinzufügen. Das war William klar. Rund zwanzig Priester lebten hier dauerhaft. Ein verschwindend geringer Teil im Vergleich zu den zahlreichen Priestern, die in den Städten ihren Dienst verrichteten. Und doch waren die Priester hier im Tempel das Fundament des Glaubens. Die Hüter der Lybri Deux, der Glaubenslehre aller Völker. Sie fühlten sich hier sicher. Und im Grunde hatte auch noch nie eine Gefahr für den Tempel bestanden.
«Folgt mir!», sagte William und ging dann die Treppen hinauf. Es waren nicht nur die zwanzig Priester, die er erwartete, sondern auch zahlreiche Tempeldiener. Darunter sicherlich auch einige Bewaffnete: «Und keine Gnade. Tötet sie alle!»
Es dauerte nicht allzu lange, bis William und seine Chimären auf die ersten Tempeldiener stießen. Der Schock bei diesen war groß.
Es begann ein Gemetzel, wie es der Tempel von Deux noch nie erlebt hatte.
Pipione war einer der Priester in diesem Tempel. Er starrte auf die Angreifer, die ohne Gnade in den Tempelvorraum eindrangen. Seine Leute verteidigten so gut, wie sie konnten. Doch sie hatten keine Chance. Und Priester Pipione machte das einzig richtige, das er tun konnte. Er rannte zurück in den sakralen Teil des Gebäudes, das eigentliche Herzstück des Tempels. Rasch griff er an einen Hebel. Ein Mechanismus verriegelte den Eingang mit einer großen steinernen Türe. Er wusste, dass er damit seine Priesterbrüder dem Tod geweiht hatte. Aber es gab Wichtigeres. Er musste das Heiligste retten, das es gab.
Schnell rannte er die Säulenhalle entlang und hinauf zum Altar. Er blickte um sich, aber es war niemand zu sehen. Seine Hand zitterte und Schweiß brach auf seiner Stirn aus. Dann schließlich griff er zu und nahm das Amulett. Dieses Schmuckstück konnte alles verändern. Eine fein geschmiedete Sonne aus einem Metall, das wertvoller war als Gold. Der Legende nach kam es von einem anderen Planeten. Einige mutmaßten es kam direkt aus der Sonne.
Im Eingangsbereich hörte man bereits, wie die seltsamen Kreaturen versuchten die verschlossene Türe einzureißen. Mit wuchtigen Schlägen bearbeiteten sie den Stein. Noch nie hatte er Chimären gesehen und so war der anfängliche Schock natürlich groß gewesen. Bei ihm und allen anderen. Er hatte Glück gehabt, dass sein Körper sich aus der Starre befreit hatte.
Er konnte nicht mehr warten. Und deshalb beschloss Pipione zu fliehen. Das Amulett musste in Sicherheit gebracht werden. Von ihm hing so viel ab. Die Zukunft aller Völker. Glaubte man zumindest den Legenden.
Rasch ging er zum hinteren Bereich des Tempelraumes. In der Steinwand war ein Abbild genau der gleichen Sonne, wie sie das Amulett darstellte. Der Priester nahm das Amulett und drückte es in das Abbild. Eine geheime Tür öffnete sich.
Die Hand des Priesters zitterte immer noch, als er das Amulett sorgfältig mitsamt der Kette in einen Beutel tat. Diesen hängte er sich um den Hals und verschwand dann rasch im geheimen Gang.
William, der Barbar, ließ sie alle töten. Mann für Mann fielen. Der Boden der vorderen Tempelräume, wo die Priester und ihre Gefolgsleute lebten, färbte sich rot. Die Chimären gingen brutal vor. Es schien ihnen fast schon Spaß zu machen zu töten. Dafür waren sie gedrillt worden, dafür waren sie erschaffen und erzogen. Schreie hallten durch den Tempel. Schreie der Angst und des Schmerzes.
«Einen brauche ich lebend!», sagte William laut. Eigentlich war es ein Befehl, der seinen Chimären galt. Aber die waren so im Blutrausch, dass er sich selbst einen Priester schnappte. Er hielt ihn am Hals: «Wo ist das Amulett?»
«Fahrt in die Ewige Verdammnis», fluchte der Priester.
William grinste: «Wir werden das Amulett ohnehin finden. Aber Euch brauche ich dennoch. Ihr habt Tauben aus jedem Königreich, richtig?»
Der Priester wollte nicht antworten, aber der Barbar zog sein Messer und ging mit der Spitze direkt an einen der Augäpfel des Geistlichen: «Ihr braucht nur ein Auge um mir nützlich zu sein. Also sprecht lieber und so behaltet ihr beide!»
«Ja, wir haben Tauben aus jeder Hauptstadt!»
«Gut. Dann schickt an jeden König eine Nachricht. Schreibt ihnen, dass der Tempel von Deux gefallen ist. Und das Amulett in den Händen der Ritter des Lichts!»
«Der Ritter des Lichts?», fragte der Priester entsetzt.
William grinste: «Ja. Und du weißt, was das bedeutet. Die dunkle Zeit beginnt! Aber nicht für uns, sondern für die Völker!»
2
Xipe Totec,
Taverne
Die Taverne direkt am Marktplatz der nehatanischen Hauptstadt Xipe Totec war gut gefüllt. Anders als in Hauptstädten wie Hingston in Manis oder Daitya in Shivas waren Gasthäuser hier bei den Nehatanern eher Mangelware. Das Volk der Nehataner war ohnehin nicht allzu fortschrittlich. Völlig volksfremde Regelungen und Ordnungen dienten vor allem dazu die Macht des Königs zu untermauern. Der Genuss von Alkohol war dem Adel und den Soldaten vorbehalten. Allerdings durften ausgewählte Tavernen Alkohol ausschenken. Die Lizenz hierfür kam vom König höchstpersönlich. In Xipe Totec hatte er gerade mal eine Taverne mit Schankerlaubnis ausgestattet. Allen anderen Gasthäusern war der Ausschank von Alkohol verboten.
Die Taverne war ein recht offen gestaltetes Gebäude. Im Grunde bestand sie aus einem großen Innenhof auf dem Tische und Stühle standen. An den Seiten waren zudem weitere überdachte Sitzgelegenheiten. Es regnete in Nehats relativ selten und so war die offen gestaltete Variante einer Gaststätte durchaus sinnvoll.
Die Tische waren gut gefüllt. Zahlreiche männliche Nehataner, bekleidet nur mit ihren typischen Lendenschurzen, saßen auf den Stühlen und tranken ein aus Mais hergestelltes alkoholisches Getränk oder den typischen nehatanischen Wein, dessen dafür notwendige Trauben ausschließlich an der Westküste nahe der Stadt Atla Coya angebaut werden konnte. Die Stadt Atla Coya, deren Name nicht vom jetzigen König Atlacoya stammte, sondern von dessen Urgroßvater Atlacoya, war deshalb die einzige Stadt, die Wein herstellen konnte. Und der wurde dann im ganzen Land verkauft. So auch in Xipe Totec, der Hauptstadt.
An einem der hinteren Tische saßen zwei Gestalten, die so irgendwie gar nicht in das Bild passten. Es waren zwei Männer. Der eine davon war ein Nehataner. Ein für nehatanische Verhältnisse äußerst hagerer Mann mit dem typisch kahlgeschorenen Kopf. Ein sehniger, knöcherner Typ mit eingefallenen Wangen und einem stechenden aufmerksamen Blick. Anders als die anderen anwesenden Nehataner hatte er jedoch nicht nur einen Lendenschurz an, sondern trug eine lederne Hose und ein braunes Hemd. Ungewöhnlich war dies allerdings nicht. In den letzten Jahren hatten sich durchaus auch andere Kleidungsstücke durchgesetzt. Vor allem Kaufleute, Seeleute und Bergleute bedienten sich gerne einer praktischeren und schützenden Kleidung. Gerade weit reisende Nehataner hatten sich von den traditionellen Lendenschurzen verabschiedet. Die überwiegende Mehrheit der Stadtbürger trug jedoch nur den Lendenschurz. Die Frauen lederne Kleider.
Neben dem hageren Nehataner saß ein Mann, der ebenso wenig in das Bild passte. Auch wenn seine Haut durch die Sonne braungebrannt und fast schon gegerbt aussah, so war doch deutlich zu sehen, dass er ein Mani war. Was ihn besonders außergewöhnlich machte, war seine Haartracht. Er trug langes schwarzes Haar und hatte einen langen Bart. Sein kräftiger Körper steckte in einem Jagdanzug aus Leder. Die Weste war vorne offen, so dass man sein außergewöhnliches Brusthaar sehen konnte. Außergewöhnlich, da im Laufe der Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausenden die Körperbehaarung auf Ariton deutlich zurückgegangen war.
Es war schwer einzuschätzen, wie alt der Mani war. Das Leben hatte ihn gezeichnet. Das war in jedem Fall zu sehen.
Der Nehataner neben dem Mani stand auf. Sie wurden nicht bedient und so entschied der hagere Mann sich selbst an die Theke zu begeben um dort nach zwei Bechern Wein zu fragen.
Als er diese schließlich bekam und zurück an den Tisch wollte, stellte sich ihm ein Nehataner in den Weg. Ein großer kräftiger Kerl, der bereits zu viel getrunken hatte. Es war noch recht früh am Morgen, aber der hohe Alkoholkonsum an diesem Tag war nichts Ungewöhnliches. König Atlacoya feierte seinen Geburtstag. Ein Festtag für alle Nehataner. Jegliche Arbeit auf dem Felde, in den Bergwerken oder auch der Handel auf dem Markt war an diesem Tag verboten.
«Zwei Becher Wein nur für dich?», fragte der hünenhafte Nehataner, der sich dem hageren Mann in den Weg stellte.
«Nein!», meinte dieser: «Für mich und meinen Kameraden!»
«Er sieht aus wie ein Mani!»
«Vielleicht deshalb, weil er Mani ist!», sagte der hagere Mann.
«Was wollt ihr hier?», der nehatanische Hüne war ein Söldner. Er war in keiner regulären Armee, sondern heuerte bei Händlern an um Schulden einzutreiben oder sie auf den gefährlichen Fahrten in andere Länder zu begleiten. Fehlte es an Aufträgen, überfielen sie jedoch auch gerne mal den einen oder anderen Händler. Sie schlugen damit zwei Fliegen mit einer Klappe: machten Beute und die Händler überlegten sich zukünftig zweimal, ob sie nicht lieber die Söldner für ihren Schutz bezahlten.
«Wir wollen nur einen Wein trinken. Dann sind wir wieder weg!»
«Einen Wein trinken?», der Hüne lachte und nahm einen der Becher dem hageren Mann ab um ihn in einem Zug zu leeren: «Es reicht, wenn ihr euch einen Becher teilt. Oder etwa nicht?»
«Findest du das fair?», fragte der Hagere.
Der Söldner grinste, beugte sich vor und spuckte in den anderen Becher: «Vielleicht ist es so fairer? Dann bleibt euch beiden mehr!»
Die Kameraden rundherum lachten laut.
«Hört zu!», der Hagere sprach mit ruhigem Ton: «Wir beide möchten keinen Ärger. Wirklich nicht. Ich würde vorschlagen, du gehst zur Theke und holst uns zwei neue Weinbecher. Wäre das nicht eine gute Idee?»
«Sonst was?»
«Wir möchten wirklich keinen Ärger!», meinte der hagere Mann.
«Okay. Du wirkst wie ein Klappergestell. Bist dürr als hättest du tagelang nichts gegessen. Und du drohst mir?»
«Ich mache dir lediglich einen Vorschlag!»
«Bevor ich dich zerquetsche wie ein Insekt, sag mir wie heißt du? Damit ich weiß, wen ich in die Ewige Verdammnis schicke!», meinte der Söldner wütend und baute sich vor dem hageren Mann wie ein Berg auf.
«Man nennt mich den Schakal!», sage der Mann.
«Den Schakal?», der Hüne lachte laut: «Ja, ein räudiger Wüstenhund, das passt zu dir!»
Ein anderer Mann am Tisch daneben sprang auf: «Bei den Göttern. Ihr seid der Schakal?»
«Ja, das bin ich!», meinte der hagere Mann.
Der Nehataner, der gerade aufgesprungen war, ging einen Meter zurück: «Vergebt Ihm, er weiß nicht, was er redet!»
Der Hüne schaute ihn an. Es war klar, dass sie zusammengehörten. Sie waren beide Söldner. Wie auch alle anderen an diesem Tisch: «Du hast Angst vor diesem Kerl?»
«Das ist der Schakal. Weißt du nicht, wer das ist, bei den Göttern?»
«Was interessiert mich das? Er steht im Weg. Und es ist in unserer Taverne. Gäste von außerhalb haben hier nichts verloren. Er und sein manischer Freund sollen verschwinden!»
«Wir sind keine Freunde!», murmelte der Mani im Hintergrund.
«Was?», der Hüne drehte sich um: «Hast du was gesagt, Mani?»
«Ich sagte, wir sind keine Freunde. Der Schakal und ich, wir sind wie Brüder!»
«Toll. Herzlichen Glückwunsch!», der Hüne schüttelte den Kopf.
«Dann seid Ihr ...», der andere Söldner zeigt auf den Mani: «Bei den Göttern, Ihr seid es!»
Doch der Hüne ließ sich davon nicht beeindrucken. Er ging an den Tisch, wo der Mani saß: «Wie ist dein Name?»
«Fick dick!»
«Was? Dein Name ist „Fick dich“?»
«Tu mir den Gefallen und geh mir aus der Sonne!»
«Oh, du möchtest Regnator in der Ewigen Sonne sehen, wenn ich dir das Leben aus dem Leib prügle?», der Hüne grinste: «Das ist kein Problem. Und jetzt nenne mir deinen gottverdammten Namen!»
«Man nennt ihn „Baby“!», sagte der Kamerad des Hünen. Man sah Schweißperlen auf seiner Stirn. Er hatte Angst, das war deutlich zu sehen.
«Ernsthaft? Baby? Warum? Weil er gerne Babys frisst?», der Hüne lachte laut und ging dann noch einen Schritt näher an den Tisch, an dem der Mani saß. Dann wollte er zupacken. Seine kräftigen Arme schnellten nach vorne. Doch keinen Wimpernschlag später hatte der Mani die Hand des Nehataners gepackt. Er drückte die Finger nach hinten: «Mit welcher Hand führst du dein Schwert und besorgst es den Weibern?»
«Fick dich! Verdammt! Fick dich!», sagte der Hüne schmerzverzerrt.
«Ich sagte doch, so heiß ich nicht!», meinte der Mani und brach die Finger mit einer geschickten Bewegung ohne dabei aufzustehen. Es machte ein grausames, deutlich hörbares Geräusch, denn mittlerweile war es still um die beiden herum.
Der Hüne heulte auf und stützte sich mit der anderen Hand auf dem Tisch auf.
«Töte ihn nicht. Bitte!», meinte der Schakal. Es klang müde und so als wüsste er, dass seine Worte ohnehin nicht gehört wurden.
«Du weißt, dass ich gerne töte. Und ich habe es im Griff. Dank dir, mein Bruder!», sagte der Mani leise: «Aber du sagtest selbst, dass ich mein inneres Verlangen nach Blut steuern muss. In die richtigen Bahnen lenken muss, oder nicht?»
«Schon, aber ...»
«Und er ist Böse, oder?», fragte der Mani: «Warum soll ich ihn dann nicht töten?»
«Du verfluchtes Arschloch!», zischte der Hüne unter Schmerzen.
Noch immer saß der Mani, den alle Baby nannten, auf seinem Stuhl: «Siehst du? Ich habe ihm die Finger gebrochen und er beleidigt mich noch immer!»
«Tu es nicht!», sagte der Schakal. Es wirkte müde.
«Herrje, was ist nur los mit dir? Was ist dein Problem, gottverdammt?», der Mani ließ den Hünen los und stand auf. Er ging auf den Schakal zu: «Er vergreift sich an unserem Wein, beleidigt dich, beleidigt mich. Und er beleidigt die Götter!»
«Ich habe die Götter nicht beleidigt!», sagte der Hüne mit schmerzverzerrtem Gesicht. Seine Finger waren tatsächlich gebrochen und standen nach hinten ab. Es war kein schöner Anblick.
«Deine ganze Erscheinung ist eine Beleidigung für die Götter!», sagte Baby.
Der Hüne zog seine Waffe. Ein schmaler Degen, der für die Söldner nicht ungewöhnlich war und stets an einem ledernen Gürtel am Lendenschurz getragen wurde.
«Oh, tu das nicht!», sagte der Schakal: «Das nimmt kein gutes Ende!»
«Der Vorteil ist, dass ich mit beiden Händen kämpfen kann! Links oder rechts, scheißegal.», sagte der nehatanische Söldner.
«Siehst du, Itzli!», meinte der Mani zu seinem Partner, den alle den Schakal nannten: «Ich habe ihm nur die Finger gebrochen. Und das ist der Dank!»
Die Söldner griffen nun allesamt zu den Waffen. Einige von ihnen hatten schon von dem Schakal und dem Baby gehört. Aber der Ehrenkodex verlangte, dass sie zusammen kämpften und siegten. Oder eben starben.
«Okay, mein Bruder. Was nun?», fragte der Mani: «Darf ich töten?»
«Versuche ihn doch einfach nur kampfunfähig zu machen!», seufzte der hager Mann, dessen eigentlicher Name Itzli war.
Baby zog sein Schwert.
«Du brauchst seine Erlaubnis? Ist er deine Mutter?», fragte der Hüne. Sein Gesicht verriet nicht nur Wut, sondern auch Schmerz. Seine Hand tat ihm höllisch weh, was durchaus verständlich war: «Deshalb die Bezeichnung Baby, oder?»
Der Mani grinste spöttisch: «Nein. Aber wir sind im Moment in so einer Phase, wo ich lernen muss meine Gefühle zu beherrschen. Und vielleicht hat er recht. Vielleicht sollte ich dich nicht töten.»
«Nun. Dazu wird es auch nicht kommen. Weil ich dich töten werde!», sagte der Hüne und stürmte los. Von den anderen Männern griff keiner ein. Sie schauten zu.
Der Mani wehrte fast schon mühelos den Angriff ab und ging dann zur Seite. Durch die Wucht des eigenen Körpers stürzte der nehatanische Söldner nach vorne. Er fing sich mit der gebrochenen Hand auf und jaulte wie kleines Kind. Seine gebrochenen Finger schmerzten durch den Aufprall nun noch mehr.
«Glaube mir, ich heiße nicht Baby, weil ich gerne meine Gegner wie ein Baby heulen höre!», sagte der Mani: «Also, bei den Göttern, steh auf und jammere nicht!»
«Im Namen des Königs!», meinte plötzlich eine Stimme. Einige der Söldner verschwanden sofort. Soldaten erschienen und umstellten die kleine private Kampfarena.
«Ernsthaft?», als würde er sich fragen, warum man ihn ausgerechnet jetzt stören musste: «Wer seid Ihr?»
«Ich bin Texcoco der II., Offizier der königlichen Garde, Wächter der Ordnung und des Friedens in Xipe Totec. Bezwinger der Aufständischen bei Oxom Oco. Mein Vater ist der ehrwürdige Onkel von König Atlacoya, dem Herrscher über Nehats!»
«Verpiss dich!», meinte der Mann mit dem Spitznamen Baby.
«Im Namen des Königs befehle ich Euch die Waffen niederzulegen!», meinte der Offizier.
«Und ich sagte „verpiss dich“. Hast du was an den Ohren?»
«Soldaten!», befahl Texcoco: «Anlegen!»
Vier Bogenschützen legten an.
«Es wäre vielleicht günstiger aufzugeben!», meinte der Schakal: «Nur für alle Fälle, dass er vielleicht ernst macht!»
«Ach, du glaubst, er macht ernst? Schau ihn dir doch an. Er sieht aus wie ein Penis mit Ohren. Und will mir sagen, dass ich die Waffen niederlegen soll. Komm schon.»
«Ähem. Sie zielen mit Bögen auf uns!»
«Nein. Sie zielen mit Pfeilen auf uns. Die Bögen dienen nur dazu sie auf uns abzufeuern!»
«Man zielt mit den Bögen!»
«Nein, mit den Pfeilen!»
«Wie auch immer!», meinte der Schakal ein wenig ungeduldig und legte sein Schwert ab: «Wir sollten gehorchen!»
«Einem Peniskopf sollen wir gehorchen? Ernsthaft?»
«Ja, diesem Peniskopf. Und sie zielen dennoch mit den Bögen!»
«Hört auf zu diskutieren!», befahl der Offizier laut und ziemlich angepisst: «Herrgott. Das ist ja schlimm. Legt die Waffen nieder und folgt uns!»
«Hört mal zu, Eure Heiligkeit und Hochwürden von Oxom Oco. Oder woher auch immer du kommst oder welchem Loch gekrochen bist. Wir gehen mit. Aber sag deinen Zahnstocherschützen, sie sollen die Bögen senken. Sie könnten damit noch jemand wehtun!»
«Du gibst also zu, dass sie mit den Bögen auf uns zielen!», meinte der Schakal.
Der Mani hob seine Hand, als wolle er seinem Kameraden eine Ohrfeige verpassen, aber er besann sich eines Besseren: «Nun gut. Lassen wir das!»
«Nehmt sie fest!», befahl der Offizier.
3
Insel der Lucrezen,
Tempel von Deux
Der geheime Gang hinter der Tempelhalle führte weit hinunter in den pyramidalen Bereich des gesamten Gebäudekomplexes. Er musste sich konzentrieren um den richtigen Weg zu finden. Denn die zahlreichen Gänge führten wie Adern tief hinab. Und nur ein einziger Weg führte tatsächlich hinaus in die Freiheit. Ein geheimer Gang, der irgendwo im Dschungel endete. Der Priester beeilte sich, auch wenn er wusste, dass ihm so schnell keiner folgen konnte. Es war fast schon unmöglich die geheime Türe zu finden. Noch viel unwahrscheinlicher war es, dass seine Verfolger sich schnell in diesem Labyrinth zurechtfinden würde.
Es dauerte eine Weile, bis er in einer großen Halle direkt unterhalb der Tempelhalle ankam. Ein gewaltiger Raum, der gut und gerne fünfhundert Meter breit und lang war. Und ganze fünfzig Meter hoch. Hier wurde einem das Ausmaß des gesamten Tempels erst wirklich bewusst. Hier musste der Priester durch. Der Weg hinaus führte durch einen Gang auf der anderen Seite.
Ehrfürchtig blieb Pipione vor dem riesigen Monstrum in der Mitte stehen. Ein großes Schiff. Zumindest glaubten die Priester das. Auch wenn es nicht so aussah. Ein riesiger fünfzig Meter breiter und neunzig Meter langer Koloss aus Stahl. Ja, vielleicht hatten die Hüter des alten Wissens recht. Vielleicht waren die Völker einst von einem anderen Planeten hierhergekommen. Mit diesem Schiff. Falls es ein Schiff war. Niemand hatte es öffnen können. Man hatte es versucht. Aber die Außenwand des Monstrums war härter als jeder Stahl, den man auf Ariton kannte. Nein, in das Innere konnte man nicht gelangen. Und so blieb es wohl auch ein Geheimnis, ob es tatsächlich ein Schiff war.
«Stellt Euch nur vor, wir könnten damit tatsächlich Ariton verlassen. Wir könnten zu der Sonne fliegen um unsere Ahnen zu besuchen und Gott Regnator zu huldigen!», hatte der Völkerpriester, der höchste Priester von ganz Ariton damals gesagt, als er Pipione und anderen Priesteranwärtern dieses Geheimnis gezeigt hatte!»
«Wieso erzählen wir nicht den Völkern von diesem riesigen Teil?», hatte der damals noch junge Pipione gefragt.
«Um die Grundfesten unseres Glaubens zu erschüttern? Nein, Pipione. Das ist unser Geheimnis. Wir wissen ja nicht einmal, was das hier ist und woher es kommt!»
Pipione hatte es damals in Frage gestellt und stellte es auch heute noch in Frage. Warum sollte das Volk nicht erfahren, was hier lag? Weil es bestätigte, was die Hüter des alten Wissens behaupteten? Es stand doch nicht im Widerspruch zum Glauben. Hier auf Ariton gab es andere Götter. Ja, es stimmte, in der Lybri Deux stand, dass die Götter unter Regnator die Völker erschaffen hatten. Aber vielleicht gab es eine andere Erklärung. Dass die Götter Völker mit diesem Schiff hierhergebracht hatten. War es so schwer das Ganze ein wenig offener zu betrachten?
Pipione ging an dem stählernen Kolos vorbei. Ja, er war zwiegespalten. Und damit stand er alleine unter den Priestern. Er war eben nicht einer von denen, die alle Überlegungen der Hüter des alten Wissens als Unsinn und Gotteslästerung verdammten. Vielleicht gab es eine Wahrheit die dazwischen lag.
Er öffnete die Türe, die zum letzten Gang führten, der ihn schließlich in den Dschungel brachte. Mit schnellen Schritten ging er diesen entlang. Bis er schließlich tatsächlich draußen war. Er schaute sich um. Draußen war niemand zu sehen. Sein Blick ging hinauf zum Tempel. Er musste fliehen, das war ihm klar. Er musste weg. Seinen Priesterkollegen konnte er nicht mehr helfen. Jetzt war es wichtig das Amulett in Sicherheit zu bringen. Ein langer Weg erwartete ihn. Sein Ziel war das Festland. Von dort musste es ihm irgendwie gelingen die Könige zu informieren. Alle sieben. Der Tempel von Deux musste gerettet werden.
4
Stadt Xipe Totec,
Königspalast
König Atlacoya schaute mit strenger Miene drein. Recht grob wurde sowohl der Mani als auch der nehatanische Söldner vor den Thron gestoßen.
«Auf die Knie!», befahl der Soldat: «Auf die Knie vor eurem König!»
«Er ist nicht mein König, Arschloch!», sagte der Mani.
«Wie kannst du es wagen?», herrschte ihn der Soldat an und zog sein Schwert.
König Atlacoya stand von seinem Thron auf. Er hob die Hand und gab dem Soldaten zu verstehen, dass er schweigen soll.
«Aber, mein König. Er hat Euch ...»
«Was war los?», fragte Atlacoya ohne auf den Soldaten einzugehen.
«Dieser dreckige manische Verräter hat mich angegriffen!», meinte der nehatanische Hüne, der allerdings vor dem großen, massigen König fast schon schmächtig aussah.
«So, hat er das?», fragte Atlacoya: «Und er wollte dich töten?»
«Ganz genau!», meinte der Söldner.
«Aber er hat es nicht!»
«Nein, aber ...»
Atlacoya hob die Hand: «Schweig! Du bist ein Söldner, richtig?»
«Ja, mein König. Das bin ich. Aber ich bin königstreu!»
«Ich hätte so einen Mann wie dich brauchen können. Im Krieg gegen die Pravin. Stattdessen bist du hier in der Hauptstadt. Zahlt der König an seine Soldaten nicht genug?»
Der Söldner schaute irritiert drein: «Nun ja, ich ...»
Erneut hob der König die Hand und ging dann die Stufen vom Thron hinunter zur Mitte des Saals. Er gab einem Soldaten ein Zeichen und dieser legte einen Hebel um. Sowohl der Mani als auch der nehatanische Söldner starrten auf das Loch, das sich vor ihnen auftat. Zwei Platten schoben sich auseinander.
«Kommt näher. Kommt näher!», sagte der König und winkte die beiden Streithähne her: «Lasst uns ein Spiel spielen!»
Auch Itzli, den Schakal, brachte man nun in den Thronsaal des Königs. Genauso wie die fünf verbündeten Söldner, die man aufgegriffen hatte.
Itzli starrte hinunter in das Loch. Es war in etwa drei Meter tief. Unten befand sich Wasser. Und darin schwammen ... Alligatoren. Der Schakal wischte sich den Schweiß von der Stirn.
«Ein Spiel?», der Mani grinste: «Ich spiele nicht gerne Spiele.»
«Ach tatsächlich?», König Atlacoya seufzte: «Nun. Ihr spielt beide mit. Euer Einsatz sind eure Männer. Du hast deinen ... schmächtigen, hageren Kameraden. Und du ... du hast deine fünf Söldner! Wer die Frage falsch beantwortet, dessen Männer fallen in die Grube.»
«Was für eine Frage soll das sein?», fragte der Söldner irritiert.
«Eine Frage über mich. Über deinen König. Du bist doch königstreu, oder nicht?»
«Natürlich, mein König!», stotterte der Söldner und starrte hinunter in das Loch. Die Alligatoren schwammen aufgeregt hin und her. Sie wussten, dass Fütterungszeit war. Wer auch immer hier das Spiel verlor, er war nicht der erste, der hier diesen Kreaturen zum Opfer fiel.
König Atlacoya ging um das Loch herum und blieb bei Itzli stehen. Er grinste ihn an: «Du bist also der Kamerad dieses Mani?»
«Nun ja ...», stotterte dieser: «Wir sind Gefährten, aber ...»
«Aber was? Du würdest für ihn nicht sterben wollen?»
«Ganz ehrlich, mein König!», meinte der Schakal kleinlaut: «Wer will schon sterben? Und ist er nicht für seine Taten selbst verantwortlich?»
«Itzli, was ist los mit dir?», fragte der Mani: «Wir stehen seit Jahren Seite an Seite und nun kneifst du?»
«Ja, Herrgott. Wir standen Seite an Seite. Und wir haben gekämpft. Aber würdest du für mich da reinspringen?», er zeigte auf das Loch, wo die Alligatoren wie verrückt hin und herschwammen.
«Nein!», meinte der Mani trocken.
«Siehst du!», schrie der Schakal laut und deutlich. Also entschuldige, wenn ich nicht vor Freude einen Furz fahren lasse im Angesicht des Todes!»
«Ihr beide seid so putzig!», sagte König Atlacoya und zeigte dann auf die fünf Söldner. Hinter ihnen standen zehn Soldaten: «Schmeißt sie rein!»
Die Worte kamen so plötzlich.
Ohne viel Zögern schoben die Soldaten die fünf Söldner nach vorne. Der erste stürzte sofort ins Loch. Gierig stürzten sich die Alligatoren auf ihn. Kurz sah man ihn panisch schwimmen, aber lange hielt er sich nicht über Wasser. Dann stürzte der nächste und auch ihn traf das Schicksal.
«Bei den Göttern!», schrie der Söldner neben dem Mani: «Was tut Ihr, mein König?»
Die anderen drei Söldner fielen auf die Knie. Flehten um ihr Leben. Einer hielt sich krampfhaft am Bein eines Soldaten fest. Aber sie hatten keine Chance. Auch sie flogen hinab.
Es war ein grausames Spektakel. Die letzten drei waren nicht mehr ganz so sehr den gierigen Attacken ausgesetzt. Die Alligatoren waren noch mit den anderen beiden Söldnern beschäftigt. Und so schwammen sie um ihr Leben. Sie schrien, paddelten, versuchten an den Wänden irgendwie hochzuklettern. Und schließlich wurden auch sie Opfer der echsenartigen Monster.
Itzli schluckte. Das hatte er nicht erwartet. Angewidert schaute er zur Seite.
«Bei den Göttern, mein König. Ihr hattet keine Frage gestellt!», der Söldner schwitzte. Panik erfasste ihn. Er schaute sich um, sah die beiden Soldaten hinter ihm, die ihn drohend anschauten.
«Nun ja, mein Spiel, meine Regeln!», meinte Atlacoya, ging um das Loch herum und blieb dann neben dem Söldner stehen.
«Aber ... aber das ist nicht gerecht!»
«Nun ja. Was gerecht ist und was nicht gerecht ist, das entscheidet in diesem Land der König. Habe ich recht?», fragte Atlacoya.
«Gewiss, mein König!», sagte der Söldner demütig.
«Es ist schon viele Jahre her!», meinte der König und ging dann hinauf zu seinem Thron. Er setzte sich: «Vor vielen Jahren als mein Vater noch König war. Da gab es eine Gruppe von Söldnern, die überfielen einen manischen Kaufmann. Sie schlitzten ihn auf und vergewaltigen seine Frau!»
Der Söldner stand wie angewurzelt da. Er hörte einfach nur zu.
«Nun!», erzählte der König: «Meinem Vater wäre es vermutlich ganz egal gewesen. Es waren Mani und mein Vater war nie ein Freund dieses bleichen Volkes. Aber dieser Kaufmann war auf dem Weg zum König, zu meinem Vater. Um ihm eine Medizin zu bringen. Denn sein Sohn lag im Sterben! Und nur diese eine Medizin konnte ihm helfen. Und nun rate mal, wer dieser Sohn war ...»
«Ihr, mein König?», fragte der Söldner mit zittriger Stimme.
Atlacoya grinste: «Du bist gar nicht so dumm! Wie auch immer. Mein Vater schickte Männer los um den Mani zu finden. Sie fanden ihn tot. Den Mann ermordet, die Frau geschändet und dann ebenfalls getötet. Die Medizin war weg. Sofort machte man Jagd auf die Mörder. Und man fand sie schließlich. In der Hauptstadt. Sie waren schnell aufgefallen. Denn sie hatten ein Baby dabei. Einen kleinen manischen Säugling, den sie verschachern wollten.»
«Ich verstehe nicht ganz, warum ihr diese Geschichte erzählt, mein König?», fragte der Söldner: «Auch ich bin Söldner, das stimmt. Aber mit diesen feigen Mördern habe ich nichts zu tun. Ihr sagt selbst, es ist viele Jahre her ...»
«Lasst mich doch die Geschichte erzählen!», meinte Atlacoya: «In jedem Fall wurden die Männer hingerichtet. Die Medizin wurde bei ihnen gefunden und ich konnte geheilt werden. Das kleine Baby aber brachte man ebenfalls in den Palast. Und das kleine hilflose Manikind wuchs bei uns in der königlichen Familie auf. Und auch wenn er nun ein kräftiger, kluger und vor allem bärtiger Kerl ist. Den Namen, den wir ihm gaben ist Oxomoco. Aber man nennt ihn immer noch Baby.»
Der Söldner erbleichte und blickte hinüber zu dem Mani. «Er? Er ist dieses ... dieses Kind?»
«Ganz genau!», meinte Atlacoya und stand wieder auf: «Ich habe dir diese Geschichte erzählt, damit du in der Ewigen Verdammnis etwas hast um darüber nachzudenken!»
«Ich flehe Euch an!», sagte der Söldner: «Ich ...»
König Atlacoya packte den eigentlich sehr kräftigen Nehataner am Hals und drängte ihn rückwärts zum Loch. Er schaute hinüber zu dem Mani: « Oxomoco! Willst du ihm noch irgendwas sagen?»
«Ehrlich gesagt würde ich jetzt irgendwann gerne einen Wein trinken und mich nicht über euch schwarze Männer ärgern!», meinte dieser: «Es ist dein Geburtstag. Und ein Nationalfeiertag. Aber was tust du? Du fütterst deine Viecher!»
«Herrgott, Bruder! Du bist in die Stadt gekommen und kommst nicht auf die Idee mich zu besuchen?», die Worte von Atlacoya klangen zornig. Noch immer hielt er den Nehataner fest. Dieser stand bedrohlich nah am Abgrund.
«Nenn mich nicht Bruder, Atlacoya. Wir sind keine Brüder. Wir waren nie Brüder und wir werden nie Brüder sein! Ich habe einen neuen Bruder. Den deine Männer auch verhaften lassen haben. Der Mann dort drüben. Ein Bruder im Geiste.»
«Du bist und bleibst ein wütender Mani, ich weiß! Dabei hat mein Vater doch alles für dich getan!», Atlacoyas Hand klammerte sich noch mehr um den Hals, so dass der Söldner nach Luft schnappte.
«Dein Vater fand es lustig mich wie einen Hund vorzuführen. Ein kleiner Junge aus dem Land der Mani. Ich war ein Sklavenjunge, nicht mehr und nicht weniger!»
«Du tust meinem Vater unrecht. Du saßt bei uns am Tisch, du hast alles bekommen. Du warst mir und Chantico stets ebenbürtig!»
«Das war ich nicht und das weißt du!»
«Chantico hat dich immer geliebt!»
«Ach, verfickte Scheiße. Chantico ist schwach. Er war schon immer schwach. Wo ist er überhaupt? Eine Familienzusammenführung ohne ihn?»
«Er ist im Krieg gegen die Pravin!», sagte Atlacoya: «Herrgott, in welchem Loch hast du dich verkrochen, das du nichts mitbekommen hast?»
«Im Krieg gegen die Pravin?», Baby lachte: «Das war deine glorreiche Idee. Entsprungen aus deiner Machtgier, oder?»
Niemand anderes konnte so mit Atlacoya sprechen. Der Herrscher, der niemals Gnade zeigte. Der König störte sich nicht einmal an den Worten. Er respektierte den Mani. Ja, es stimmte, als Kind hatte er Probleme mit dem weißhäutigen Jungen gehabt. Aber das war vorbei. Sie waren erwachsen. Atlacoya ging in Richtung Ausgang und sprach dabei in ruhigem Ton: «Du hast recht, Baby. Den Krieg habe ich angefangen!»
Er ließ den Söldner los. Dieser stürzte auf die Knie und rang nach Luft.
«Ich wäre schon vorbeigekommen!», meinte Oxomoco: «Ich bin auf der Durchreise!»
«Du gehörst zu unserer Familie, bei den Göttern. Aber wir reden später weiter. Ich habe eine Zeremonie durchzuführen. Das Volk möchte mich feiern. Wenn die Sonne den höchsten Stand hat, dann wollen sie mich sehen!»
«Was wird mit ihm?», fragte der Mani und schaute auf den Söldner.
«Nun. Die Alligatoren scheinen satt. Vielleicht sollte ich ihn zu Ehren meines Geburtstages hinrichten lassen. Das Volk freut sich. Immerhin hat er die königliche Familie beleidigt!»
«Hat er nicht. Und wenn, dann wusste er ja nicht einmal, wer ich bin!»
«Versöhnliche Worte von dir?», Atlacoya lachte: «Du hast nie Gnade gekannt!»
«Er ist auf einem guten Weg!», meinte nun Itzli, den die Soldaten freigelassen hatten.
«Halt die Schnauze!», meinte das Baby.
«Nein, ernsthaft. Er hat seine Gefühle besser im Griff, mein König! Ich habe viele Gespräche mit ihm geführt und ...»
Atlacoya schaute den Mani an: «Soll ich ihn den Alligatoren zum Fraß vorwerfen!»
«Sinnvoll wäre es vielleicht!», meinte der Mani: «Er nervt. Ständig kommt er mit seiner Moral. Ständig redet er von Gefühlen!»
«Moment!», wehrte Itzli ab.
«Nun. Diesen Gefallen werde ich dir nicht tun, Bruder!», sagte Atlacoya und winkte einen Soldaten her: «Bringt sie zu meinem Weib. Sie soll ihnen Wein und etwas zu essen geben. Sie sind meine Gäste!»
«Was ist mit ihm?», fragte der Soldat und zeigte mit dem Schwert auf den Söldner.
«Ach ja, er. Hackt ihm beide Hände ab, schneidet ihm seine verräterische Zunge raus!»
«Und dann?», fragte der Soldat ein wenig irritiert.
«Na dann hoffen wir, dass meine kleinen schuppigen Kinder dort unten wieder genug hungrig sind. Dann soll er seinen Söldnerkameraden folgen!»
5
Stadt Hingston,
Gemächer der Prinzessin
In der großen Welt von Ariton passierte Tag für Tag so viel. Und dies war an diesem einen Tag nicht anders. Männer und Frauen starben, Babys wurden geboren, Händler wurden betrogen, Schwerter gekauft, Wölfe jagten Schafe, mancherorts regnete es, irgendwo schien die Sonne, in Xipe Totec feierte ein König seinen Tag der Geburt, der Tempel von Deux war gefallen und in Hingston erwachte eine Prinzessin zur Mittagszeit.
Katharina blinzelte und schaute zum Fenster. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel. Sie hatte lange geschlafen. Aber das war kein Wunder nach den aufregenden Ereignissen des letzten Tages. Sie war das Götteropfer der Mani und würde auf eine lange Reise gehen. Auch wenn sie es noch nicht so richtig glauben konnte.
Prinzessin Katharina hatte darauf bestanden, dass die beiden Götteropfer Hedda und Ailsa bei ihr unterkamen. Sie würden ohnehin auf der Reise ständig beieinander sein. So konnten sie sich vielleicht vorab ein wenig besser kennenlernen. Zudem waren sie in den Gemächern der Prinzessin am besten geschützt.
Man hatte für die beiden jeweils ein Bett aufgestellt.
Katharina stand auf und schaute zuerst zu Ailsa. Sie schlief noch. Hedda hingegen war wach. Gedankenversunken schaute sie ins Leere. Als sie sah, dass Katharina aufgewacht war, lächelte sie und nickte ihr zu.
«Gut geschlafen?», flüsterte die Prinzessin.
Die Ragna nickte: «Ja. Allerdings bin ich schon eine Weile wach. Und ich langweile mich!»
«Nun, sei doch froh. So viel Aufregung. Da tut dir eine Woche Erholung bestimmt gut!»
«Eine Woche hier in der Stadt?», Hedda seufzte: «Nun, vielleicht hast du recht. Die letzten Tage waren schon heftig. Ein wenig Ruhe tut gut!»
«Heute ist schönes Wetter. Ich könnte euch den Strand zeigen!», meinte Katharina.»
«Den Strand?»
«Ja, wir könnten baden gehen!», meinte die Prinzessin.
«Baden, wirklich? Im Meer?»
«Ich vergaß. Du kommst ja aus dem Eis und Schnee im Norden! Kannst du überhaupt schwimmen?»
Hedda schüttelte den Kopf: «Nein, kann ich nicht!»
«Dann solltest du es lernen!»
«Du willst mir das Schwimmen beibringen?»
Katharina kam nicht mehr dazu die Frage zu beantworten. Es klopfte an der Türe.
«Wer mag das sein?», fragte Ailsa. Sie war gerade aufgewacht. Noch ein wenig müde rieb sie sich die Augen.
«Du bist wach, endlich!», meinte Katharina und ging zur Türe. Lord Lenningten stand davor. Er schaute weg, als er Katharina im Nachthemd sah.
«Königliche Hoheit!», sagte er.
«Onkelchen, warum so förmlich?», fragte sie überrascht.
«Du hast Gäste, oder?», Lord Lenningten vermied es einen Blick in die Gemächer zu wagen.
«Ja, natürlich. Die beiden anderen Götteropfer!»
«Nun. Ihr sollt zum Obersten Priester. Alle drei!»
«Wirklich?»
Er nickte: «Ja. Sobald wie möglich. Man erwartet euch drei im Tempel!»
Katharina war nicht wirklich begeistert. Ihr Verhältnis zu Priestern war nicht mehr das Beste. Das hatte sich auch nach dem Tod von Priester Zacharias nicht geändert. Doch was sollte sie schon sagen? Deshalb nickte sie einfach nur.
«Der Oberste Priester ist, wie gesagt, im Tempel. Lasst euch Zeit. Macht euch erst einmal frisch und zieht euch an. Die Priester laufen ja nicht davon!»
«Ach, tatsächlich?», grinste Katharina: «Nun ja. Wir gehen natürlich hin, sobald wir fertig sind!»
«Nehmt Wachen mit. Mindestens zwei!», sagte Lenningten: «Nach den Vorkommnissen gestern sind wir gar nicht mehr so sicher, ob Hingston genug geschützt ist. Diese Kreaturen, die aus dem Himmel kamen. Mögen die Götter uns vor ihnen bewahren. So etwas Gespenstisches habe ich noch nie gesehen! Und dann erst diese Drachen. Bei den Göttern, Hingston hat gestern mehr als genug Unheil erlebt!»
Katharina nickte. Die Ereignisse am gestrigen Tag hatten sich überschlagen. Sie dachte an Sjel, den schwarzen Drachen. Anfänglich hatte sie panische Angst gehabt. Wie auch alle anderen. Und dann hatte er sie direkt angesprochen. Sie, die Prinzessin. Und noch immer verstand sie nicht, woher er gekommen war und was er eigentlich wollte.
Lenningten nickte nun ebenfalls und zog sich dann zurück.
«Was wollte er?», fragte Hedda.
«Wir müssen zu den Priestern. Oder dem Obersten Priester. In jedem Fall müssen wir zum Tempel!»
«Okay, das klingt spannend!», die Ragna grinste.
«Nein, das ist nicht spannend. Lauter alte Männer, die ...», Katharina sprach nicht weiter. «Die einen nur lüstern anschauen», hatte sie sagen wollen. Aber sie sprach es nicht aus. Sie hatte Angst, das vor allem Ailsa über sie lachte.
Die Noatin war nun vollends aufgestanden und hatte sich ihr Nachthemd ausgezogen. Nackt stand sie nun im Raum: «Wir sollten uns frisch machen. Können wir baden?»
«Sicher!», nickte Katharina: «Ich kann Tamara holen lassen, damit sie uns ein Bad einlässt!»
«Ist das dein Ernst? Hilft sie dir dann auch beim Ankleiden?»
Katharina wurde rot: «Na ja. Eigentlich schon!»
«Eine Prinzessin, eine verwöhnte Prinzessin!», grinste Ailsa spöttisch und ging dann in die Badestube nebenan: «Erkläre mir lieber, wie das funktioniert.»
«Gerne!», antwortete Katharina ein wenig unsicher. Sie ging der nackten Noatin hinterher. Dann erklärte sie, wie man das Wasser heißbekam.
6
Xipe Totec,
Königlicher Palast
«Du hast mir nie erzählt, dass du im Königshaus aufgewachsen bist!», sagte der Schakal.
«Es schien mir nicht wichtig!», murmelte Baby.
«Nicht wichtig?» fragte Itzli: «Du machst wohl Scherze. Es ist sehr wohl wichtig. Vor allem hast du mich Blut und Wasser schwitzen lassen, als wir vor dem König standen. Herrje, du wusstest von Anfang an, dass der König dir nichts tut!»
«Nein, wusste ich nicht. Atlacoya ist ein jähzorniger und unberechenbarer Mann!»
«Das ist er!», sagte eine Stimme aus dem Hintergrund. Es war Shada, die Königin.
«Königliche Hoheit!», sagte Itzli ehrfürchtig und wollte aufstehen.
Doch sie winkte ab: «Bleibt sitzen. Ihr seid unsere Gäste. Habt ihr Hunger?»
«Oh ja, königliche Hoheit! Ich habe wirklich Hunger!», meinte Itzli: «Und ihn braucht Ihr nicht fragen. Er könnte jede Stunde ein Schwein verputzen! Hätte ich Haare auf dem Kopf, dann würde er mir sie runterfressen!»
Die Königin gab einen Wink und einige leichtbekleidete Frauen brachten Speisen herein. Sie trugen alle lediglich einen recht kurzen weißen Rock.
«Herrje, eine schöner als die Andere!», grinste Itzli beim Anblick der nackten Brüste.
«Da hast du recht!», murmelte Oxomoco mit Blick auf die kross gebratenen Enten.
«Ich spreche von den Titten der Weiber!», sagte sein Begleiter.
«Mein Gemahl wünscht sich nur die schönsten Nehatanerinnen um sich herum!», erklärte die dunkelhäutige Schönheit Shada: «Ihr könnt jede heute Nacht haben. Ihr müsst es nur sagen!»
«Was ich vor allem jetzt will ist Ruhe!», meinte Baby und riss einer Ente den gebratenen Flügel aus: «Ich mag es nicht, wenn man beim Essen quatscht!»
«Er ist immer noch der gleiche griesgrämige Junge!», seufzte die Königin.
«Er war schon als Kind so?» Itzli grinste. Seine Augen jedoch waren immer noch bei den Brüsten der Frauen.
«Oh ja. Ich lernte ihn kennen, da war er ein kleiner hellhäutiger Junge, der immer wieder seine beiden Brüder verdrosch. Vor allem Atlacoya bekam es immer wieder ab! Und erstaunlicherweise erinnert er sich gerne daran zurück. An den einzigen Mann, der ihm jemals contra geben konnte.»
«Hatte Baby damals schon einen Bart?», witzelte der Schakal.
Shada lächelte: «Er war schon immer ein prächtiger Junge!» Sie ging zu Oxomoco und strich ihm sanft durch die Haare: «Und ein verdammt guter Liebhaber!»
«Er? Tatsächlich?», Itzli bekam große Augen: «Das wusste ich nicht!»
Baby reagierte darauf überhaupt nicht, sondern biss herzhaft in das saftige Fleisch.
«Oh ja. Und er war meine erste Wahl. Wir waren noch jung. Aber er entschied sich schon früh dafür als Vagabund durch das Land zu ziehen statt mich als Frau zu nehmen!»
«Was für ein Narr bist du doch!», Itzli schüttete den Kopf.
«Derjenige, der dem Narren folgt, ist ein noch viel größerer Narr. Vergiss das nicht!», murmelte Baby: «Also halt keine Volksreden, sondern iss! Oder meinetwegen nimm dir eine der Weiber. Aber lass mich mit meiner Ente in Ruhe!»
«Oh ja, die warmen Schenkel, dann diese Brüste ...», schwärmte der hagere Nehataner.
«Redest du jetzt von den Weibern oder meiner Ente?», der bärtige Mann schob sich ein Stück der Entenbrust in den Mund.
«Meine Königin, verzeiht mir die Störung!», sagte ein Diener plötzlich.
«Was gibt es, Bursche?»
«Der König verlangt nach Euch!»
«Gut. Sag ihm, ich komme sofort!», sagte die Königin und meinte dann zu ihren beiden Gästen: «Habt ihr noch einen Wunsch!»
«Nein, wir sind glücklich!», grinste Itzli. Er konnte seinen Blick gar nicht von den Brüsten der Weiber lassen.
«Warum nennt man dich eigentlich den Schakal?», fragte die Königin.
«Weil er ein hinterfotziger, dreister und zudringlicher Halunke ist!», murmelte Baby.
7
Stadt Hingston,
Tempel
Der Tempel in Hingston war eigentlich mehr eine Kirche. Vergleichbar mit dem Tempel von Deux oder der Tempelanlage in Galava war er auf jeden Fall nicht.
Katharina war unglaublich nervös. Sie hatte keine gute Meinung mehr über die Priester. Mit Schrecken erinnerte sie sich an den verstorbenen Zacharias. Vielleicht war es eine Art Prüfung der Götter. In jedem Fall hatte sie noch keinen einzigen Priester erlebt, dem sie wirklich vertraute. Priester Johannes hatte das am vergangenen Tag bei der Wahl des Götteropfers auch nicht geändert. Und nun mussten sie alle drei zu ihm. Auch Hedda und Ailsa. Die Macht der Priester war volksübergreifend. Denn es war die Stimme der Götter, die durch sie sprach.
«Ich habe ein bisschen Panik!», meinte Katharina.
«Wieso?», Hedda schaute sie an.
«Ich weiß nicht. Die Priester, sie sind alle irgendwie seltsam!»
Ailsa nickte und gab ihr überraschenderweise recht: «Da hast du es allerdings auf den Punkt gebracht. Aber was hilft es schon? Sie sind die Stimme der Götter. Und wir drei sind die Opfergaben!»
Ein Tempeldiener stand am Eingang und führte sie dann in den Vorraum: «Wartet hier!»
Katharina schaute die anderen beiden an. Sie war nun noch nervöser als vor dem Tempel. Den anderen beiden schien es aber ähnlich zu gehen. Vor allem Hedda. Ailsa konnte ihre Nervosität ganz gut überspielen. Oder aber besser damit umgehen.
Es dauerte nicht allzu lange, bis die Türe aufging und einer der Priester erschien. Er schaute die drei Götteropfer von oben bis unten an: «Zieht Euch aus. Tretet vor den Altar von Regnator, wie er Euch erschaffen ließ.»
Katharina wagte kaum zu atmen. Sie wollte nicht, dass die anderen ihre Nervosität spüren konnten.
Aber das war unnötig. Hedda bekam davon ohnehin nichts mit. Sie war mit sich beschäftigt.
Und Ailsa bekam es ebenfalls nicht mit. Weil sie schon dabei war sich zu entkleiden.
Katharina und Hedda taten es ihr schließlich gleich.
Und dann war es soweit.
«Was ist nun?», fragte der Priester. Erneut ging sein Blick über die Körper der jungen Frauen. Dieses Mal war er intensiver.
«Wir sind soweit!», sagte Ailsa.
«Gut, dann tretet vor! Die Stufen hinauf bis zum Altar!»
Ailsa ging voran. Hedda folgte und schließlich, ganz hinten, ging Katharina.
«Regnator. Gott der Götter!», murmelte der Oberste Priester: «Sie treten nun vor deinen Altar. Die drei auserwählten Götteropfer aus den Ländern der Mani, der Ragni und der Noaten! Sei uns aritonischen Seelen gnädig!»
Alle drei waren sie nun oben angekommen und stellten sich nebeneinander. Links stand Hedda, rechts Katharina und in der Mitte die Noatin. Zur linken stand der Oberste Priester, rechts davon vier weitere Geistliche.
«Kniet nieder vor dem Altar Regnators!», befahl der Oberste Priester.
Alle drei gehorchten sie.
Katharina zitterte leicht. Nicht weil es kalt war, sondern weil es demütigend war. Sie spürte die Blicke der Priester auf ihrer nackten Haut.
«Ich werde Euch auf Eurer Reise begleiten!», sagte Johannes mit brüchiger Stimme. Und dann geschah etwas, das weder Katharina, noch Hedda oder Ailsa jemals geglaubt hätten.
Katharina bemerkte es als erstes. Und sie konnte es gar nicht fassen. Aber es war tatsächlich wahr. Der Oberste Priester war zum Altar gegangen, hatte dort in einen Topf gegriffen, anschließend seinen Rock gehoben und dann onanierte er.
Auch Hedda bemerkte es. Ihre Wangen wurden rot vor Scham. Nein, das hatte sie genauso wenig erwartet wie Katharina.
Und auf der anderen Seite tat es ihm ein anderer Priester nach. Und schließlich folgte noch ein weiterer, ging zum Topf, nahm eine geleeartige Substanz heraus und rieb sich sein Glied. Eine bizarre Szene für alle drei. Sie wussten sehr wohl, dass die Priester Keuschheit gelobt hatten. Umso erschreckender war es, dass sie ihre Geschlechter entblößten und sich selbst befriedigten.
Katharina schloss die Augen. Sie wollte das nicht sehen. Für einen Moment lang erfasste sie ein seltsames Gefühl und sie erinnerte sich zurück. Priester Zacharias war ihr wie ein alter Lüstling vorgekommen. Aber sie hatte gedacht, er wäre eine Ausnahme und die anderen Priester waren anders. Dann die Erfahrung mit Lord Christoph. Der sie gefangen gehalten hatte, sie beobachtet hatte. Und letztendlich Alexander. Bei dem sie am wenigsten erwartet hatte, dass er so war, wie er sich am Ende seines Lebens präsentiert hatte. Waren alle Männer so? Sie wagte kaum zu atmen. Hielt noch immer die Augen geschlossen, was noch viel unheimlicher war. Denn sie hörte durchaus das leise Stöhnen dieser geistlichen Männer.
Nicht alle Männer waren schlecht. Und auch im Umfeld von Prinzessin Katharina gab es gute Männer mit Ehre und Anstand. Doch diese prägten sich deutlich weniger in ihrer Erinnerung ein. Sie selbst war eine junge Dame in der Findungsphase. Und im Moment überwogen die schlechten Erfahrungen.
Einer der Männer, die von Ehre und Anstand wohl genügend hatten, war einer den Prinzessin Katharina nur flüchtig kannte. Er war auch noch nicht allzu lange in Hingston. Lord Marcus von Lessington. Wie der Zufall es wollte, war er gerade auf dem Weg zum Tempel. Sein Ziel war ein Gespräch mit dem Obersten Priester. Er wollte einen Ansprechpartner für zukünftige Fragen im Hinblick auf den Glauben. Denn seiner Erfahrung nach basierten viele Verbrechen auf Gründen des Glaubens. Manch einer versuchte damit seine Tat zu rechtfertigen.
Der Tempel war ein offenes Haus. Im Grunde konnte jeder reingehen, wann er wollte. Allerdings war dies selten der Fall. Keiner betete im Tempel. Und so war es ein absoluter Zufall, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt jemand das Götterhaus betrat, als die Götteropfer vor dem Altar knieten.
Lord Marcus war schockiert, als er die Szene sah. Drei nackte junge Frauen knieten vor dem Altar und die Priester holten sich einen runter.
Der Lord aus Lessington war ein gottesfürchtiger Mann. Er war im Glauben erzogen worden, betete und glaubte wie jeder gute Mani. Doch er hatte auch einen Hang zum Realismus. Er hatte sich mit so vielen wissenschaftlichen Themen beschäftigt, dass er nicht einfach alles ungefragt hinnahm. Und so stellte er auch diese Szene in Frage.
«Bei den Göttern, Oberster Priester. Was tut Ihr?», fragte der Lord überrascht und entsetzt zugleich.
Der Priester ließ sofort von seinem Tun ab. Für einen Moment rang er nach einer Antwort. Wütend darüber, dass der Lord einfach so in den Tempel geplatzt war: «Ihr platzt einfach so in die Zeremonie?»
«Es ist ein offener Tempel. Ein Haus der Götter!», meinte Lord Marcus: «Ich wusste nicht, dass ich anklopfen muss!»
«Es ist ... eine Fruchtbarkeitszeremonie!», sagte der Oberste Priester wirsch.
«Für mich sah es eher so aus, als würdet ihr Eurem Trieb nachgehen!», meinte Lord Marcus: «Mag sein, dass diese drei auserwählt von den Göttern sind. Aber doch nicht um Euch Vergnügen zu bereiten!»
«Ihr wisst nicht, was Ihr redet!», sagte Johannes: «Ihr nehmt Euch viel raus dafür, dass Ihr gestern erst zum Offizier ernannt wurdet!»
«Ich bin von Adel, falls Ihr das vergessen habt. Und ich spreche als Lord dieses Landes. Nicht als Offizier!»
«Dann hütet Eure Zunge. Ihr habt keine Ahnung von den Sitten und Bräuchen, die notwendig sind um Regnator zu besänftigen. Kümmert Euch um Eure Angelegenheiten!»
«Ich werde diese drei jungen Frauen mitnehmen, ob es Euch passt oder nicht. Soll der König entscheiden wie weiter verfahren wird. Aber hier bei Euch lasse ich Sie nicht!», sagte Marcus.
Die Prinzessin war die erste, die sich umdrehte: «Danke, Lord Marcus!»
Für einen Moment erwischte er sich dabei, wie er sie anstarrte. Dann aber siegte die Moral: «Zieht Euch an, königliche Hoheit. Und Eure beiden Kameradinnen ebenfalls. Ich bringe Euch zum König!»
8
Xipe Totec,
Königlicher Palast
In rund einem Tag konnte eine gutgenährte Taube im besten Alter und bei ausgezeichneter Gesundheit über tausend Kilometer zurücklegen. Vor dem Flug wurden sie mit fettreichen Nüssen gefüttert. Um die vierhundert Gramm wog einer dieser fliegenden Boten bevor man sie auf die Reise schickte. Deutlich leichter waren sie dann am Ziel, da sie während dem Flug ihre Fettreserven aufbrauchten. Chantico hatte jeden Tag eine Taube mit einer Nachricht in die Hauptstadt zu seinem Bruder geschickt. Sie waren unglaublich zuverlässig und flogen stets direkt in ihren Heimatschlag. Dieser war in einem der Türme des Palastes. Der alte Nehataner, der für die Tauben zuständig war, döste gerade. Er hatte ein wenig zu viel Wein getrunken. Zu Ehren des Königs. Als die Tauben aufgeregt in ihren Schlägen umherflatterten, erwachte er. Sofort wusste er, dass eine Taube zurückgekehrt war. Er öffnete den Taubenschlag und nahm die Taube, die eine Nachricht trug, heraus. So gerne er es auch gelesen hätte, er durfte das kleine Papierstück nicht auseinanderfalten. Das war dem König vorbehalten.
Keine halbe Stunde später hatte der König die kleine Nachricht in der Hand. Atlacoya starrte auf das Stück Papier. Er war froh, dass sein Bruder auf die Tauben bestanden hatte. So war er immer informiert. Doch diese Nachricht war nicht so gut.
«Mixtli ein Verräter? Bist du dir sicher?», fragte Shada, seine Frau. Vor ihr kniete die manische Sklavin Rebecca. Sanft streichelte die Königin das Haar der hellhäutigen Frau.
«Wenn es Chantico schreibt, dann wird es wohl so sein!», meinte Atlacoya wütend.
«Vergib mir, ich wollte dich nicht zornig machen!», sagte Shada.
«Bei den Göttern. Hoffentlich ist das nicht die Strafe dafür, dass wir noch kein Götteropfer auf die Reise geschickt haben», murmelte der Hohepriester Tupac. Er war gerade da, um dem König noch einmal zu verdeutlichen für wie wichtig er die Aussendung eines Götteropfers hielt.
«Unsinn!», sagte Atlacoya wütend: «Was soll das damit zu tun haben?»
«Nun, das Volk vertraut Euch, mein König. Aber die Leute haben Angst vor den Göttern und fürchten ihren Zorn. Euer Wort, mein König, steht über dem von jedem in unserem Land. Aber nicht über den Göttern!»
«Ich bin ein Sohn der Götter!», sagte Atlacoya: «Ich bin ein Halbgott. Und das wisst Ihr!»
«Und dennoch müsst auch Ihr den Göttern gehorchen!»
«Ich brauche keinen Hohepriester. Mein Vater hörte gerne auf Euch, das weiß ich. Aber ich bin anders. Ich spreche mit den Göttern und sie sprechen mit mir!»
«Dann werden sie Euch auch sicherlich ins Gewissen geredet haben, dass die Nehataner ebenfalls zur Jahrhundertwende ein Götteropfer zum Tempel von Deux bringen müssen!»
Atlacoya erwiderte darauf nichts. Er betete nicht zu den Göttern. Und natürlich sprachen sie auch nicht mit ihm. Und dennoch behauptete er es. Weil er sich gerne als Sohn der Götter ansah. Stattdessen fragte er Tupac: «Habt Ihr denn eine ausgesucht? Ich gab Euch doch freie Hand eine zu erwählen?»
«Das habe ich, mein König. Eine schöne Maid aus Tezcatli Poca!»
«Nun, wo ist dann das Problem? Wir haben ja dann unser Götteropfer!»
«Ihr seid es, die sie auf die Reise schicken muss!»
«Für was habe ich Euch?», fragte Atlacoya: «Meinen Priester?»
«Ich reiste vor ein paar Wochen zum Tempel von Deux und kam gesund wieder. Eine weitere Reise halten meine müden Knochen nicht mehr aus. Das wisst Ihr, mein König!»
«Herrje. Mixtli hat mich verraten. Hat unser ganzes Volk verraten! Und Ihr sprecht von Euren Knochen!», meinte der Herrscher zornig, wurde dann aber etwas ruhiger: «Geht und bringt sie mir. Ich möchte sie sehen!»
«Sehr wohl, mein König!», sagte Tupac und entfernte sich dann rasch.
«Das Volk wird es irgendwann erfahren, dass Mixtli die Seiten gewechselt hat!», meinte die Königin.
Atlacoya nickte: «Richtig. Und das ist ein ernstes Problem. Was interessiert mich da dieses Götteropfer?»
«Nun. Vielleicht schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe!», meinte sie: «Es wird irgendwann Gerüchte geben und man wird sprechen. Was, wenn du vor das Volk trittst und es verkündest? Mixtli als Verräter öffentlich nennst? Und dann das Götteropfer losschickst um die Götter zu besänftigen!»
«Das ist doch Unsinn!», sagte Atlacoya. Er zögerte einen Moment und dachte nach. Er war oft hart zu seiner Frau. Aber ihr Rat war meist recht hilfreich. Dann meinte er: «Obwohl ... du hast recht. So dumm ist das gar nicht.»
«Danke, mein Herr und König!», sagte sie und streichelte erneut den Kopf ihrer Sklavin: «Vielleicht kann dich Rebecca ein wenig beruhigen?»
«Das wäre gut!», meinte er.
Rebecca hatte sofort verstanden. Sie krabbelte auf allen Vieren zu ihrem König. Dieser öffnete seinen Lendenschurz und ließ ihn zu Boden fallen. Ihre Lippen stülpten sich über seinen Schwanz.
«Hol mir meinen Bruder!», meinte Atlacoya stöhnend.
«Oxomoco?»
«Wen denn sonst?», sagte er ein wenig mürrisch, schloss aber dann die Augen und genoss die orale Befriedigung durch die manische Sklavin.
Keine fünf Minuten kam Oxomoco herein.
«Da bist du ja!», sagte König Atlacoya. Noch immer steckte sein Schwanz im Mund der Sklavin.
«Ist das dein Ernst?», fragte der Mani: «Was soll das?»
«Was soll was?», stöhnte der Herrscher der Nehataner.
«Herrje. Könntest du ihr mal sagen, dass sie aufhören soll?»
«Wieso? Soll sie es dir besorgen?», Atlacoya grinste.
«Du wolltest mit mir reden. Also konzentrier dich gefälligst darauf!», sagte Oxomoco.
Atlacoya nickte und stieß Rebecca zurück: «Geh zurück zur Königin und sei ihr zu Diensten!»
Rebecca nickte schüchtern und verschwand dann rasch.
«Mein manischer Bruder. Ich brauche deine Hilfe!», meinte Atlacoya.
«Meine Hilfe?», der Mani lachte. Atlacoya ging nackt, wie er war, Richtung Terrasse. Oxomoco folgte ihm. Von hier aus konnte man die ganze Stadt sehen: «Dir gehen die Männer aus!»
«Es ist ein Auftrag, der nichts mit dem Krieg zu tun hat. Und ich denke, dass du der richtige Mann bist!»
«Spuck schon aus. Um was es geht. Ich würde gerne wissen, zu welchem Auftrag ich dir meinen blanken Hintern zeigen soll!»
«Deinen weißen, blanken Hintern, wohlgemerkt. Nein, den möchte ich nicht sehen!», sagte Atlacoya «Unser Volk hat einen Auftrag von den Göttern!»
«Dich interessiert, was die Götter sagen?», Baby lachte: «Du hältst dich doch selbst für einen Gott!»
Atlacoya ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und erklärte im nüchternen Ton: «Das Volk soll ein Opfer bringen. Eine Jungfrau. Ich dachte erst, dass der Priester wieder einer seiner absurden Ideen hat. Ich habe ihm gesagt, er solle sich selbst darum kümmern. Dass es mich nicht interessiere. Aber heute kam eine Taube mit Nachricht von Chantico!»
«Und?»
«Mixtli hat die Fronten gewechselt. Er ist zum Verräter geworden!»
«Mixtli?»
«Ja, verflucht. Ich weiß, du konntest ihn nie leiden. Und es ist dir wahrscheinlich eine innerliche Freude, dass du recht hattest. Aber das ist nun mal jetzt nicht zu ändern. Ich möchte, dass du das Götteropfer zum Tempel von Deux bringst!»
«Moment!», Baby lachte spöttisch auf: «Du hast Angst vor den Göttern? Du glaubst, dass Mixtli die Seiten gewechselt hat, weil die Götter dich bestrafen?»
Atlacoya atmete tief ein und aus. Genau diese Reaktion hatte er erwartet. Und er hasste es: «Ich habe keine Angst vor den Göttern. Ich bin durch die Gnade der Götter zum König geworden und ...»
«Du bist König geworden, weil du der Sohn des Königs bist!», sagte der Mani.
«Verflucht, Baby, hör mir zu. Wenn das Volk erfährt, dass der Feldmarschall die Seite gewechselt hat, dann wird man reden. Der Priester hat alle verrückt gemacht mit seinem Götteropfer. Hat davon gesprochen, dass ein großes Unglück passieren wird, wenn wir nicht den Göttern gehorchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Kunde herumspricht, dass Chantico bald vor den Toren von Lios steht und nun gegen seinen eigenen Feldmarschall kämpfen muss. Was glaubst du, was der Priester dann macht? Er wird es als Götterstrafe bezeichnen und alle verrückt machen.»
«Und das interessiert dich?», der Mani verdrehte die Augen: «Du bist Atlacoya. Mich wundert es, dass du dem Priester nicht schon längst die Zunge herausgeschnitten hast!»
«Über Nehats zu herrschen ist nicht mehr ganz so einfach, Bruder! Der Widerstand formiert sich. Und die Armee ist fast gänzlich nach Pravin marschiert. Ich kann mir hier keine Unruhen leisten!»
«Und ich soll den Karren aus dem Dreck ziehen?»
«Ich werde dich reichlich belohnen. Ich kann dir alles geben, was du willst!»
«Zur Insel der Lucrezen?», fragte der Mani.
«Du bekommst ein Schiff mitsamt einer Besatzung! Es dauert keine zwei Tage, bis du die Meeresenge überwunden hast. Und im Dschungel kennt sich keiner besser aus als du.»
«Ich mache es unter einer Bedingung!», sagte Oxomoco.
«Die wäre?»
«Wenn ich zurück komme, möchte ich eines deiner besten Pferde. Und eine gute Ausrüstung! Ich möchte nach Norden!»
«Ins Land der Mani?»
«In das Land meiner Väter!», meinte der bärtige Mann.
«Das ist ein langer Weg. Und im Lande der Pravin ist Krieg. Und denk an die Wüste ...»
«Das ist dein Krieg. Er interessiert mich nicht. Du sagtest selbst, dass dein Bruder bereits vor den Toren von Lios ist. Zuvor werde ich den Weg in die Wüste nehmen. Vor der ich keine Angst habe!»
«Ich werde dir Männer mitgeben!»
«Ich habe Itzli. Mehr Männer brauche ich nicht! Und auch ihm wirst du ein Pferd geben.»
Atlacoya seufzte: «In Ordnung. So machen wir es!»
9
Königlicher Palast Hingston,
Thronsaal
Priester Johannes war außer sich. Er baute sich vor dem König auf und wirkte dabei durchaus bedrohlich.
Lord Philipp herrschte ihn an: «Ihr mögt ein gottgeweihter Priester sein. Aber haltet Abstand vor dem König. Sonst ward Ihr die längste Zeit unserer Oberster Priester!»
«Kurze Amtszeiten scheinen ohnehin üblich im Amt des Obersten Priesters!», murmelte der König. Für ihn war es durchaus befremdlich, was die Priester getan hatten und er hatte Lord Marcus sogar ausdrücklich gelobt.
«Lord Marcus hat eine Zeremonie gestört und muss dafür bestraft werden!», sagte Johannes.
«Er hat Euch beim Onanieren unterbrochen. Was, bitteschön, ist das für eine Zeremonie?», der König schüttelte verwirrt seinen Kopf.
«Auch Ihr versteht nichts davon!», sagte der Priester: «Wir wollten unseren priesterlichen Samen opfern, vor Regnator, unserem Gott. Damit er besänftigt ist und ...»
«Was für ein Unsinn!», sagte Lord Philipp.
«Ich möchte über alles informiert werden!», meinte der König: «Ihr werdet mit den Götteropfern keinen Schritt mehr tun, ohne dass ich es weiß!
«Sie sind die Götteropfer. Und sie sollten in unserer Obhut sein!», Priester Johannes tobte. Und da half auch nicht der strenge Blick von Lord Philipp.
«Nein! Ich bin der König! Sie sind das Opfer ihres Volkes und ich werde sie so lange schützen, bis sie sich auf die Reise machen!»
«Was für einen Sinn macht das? Dann werden sie ohnehin in meiner Obhut sein!»
«Oh, ich denke nicht, dass ich Euch auf die Reise schicke!», meinte Leopold: «Ihr wertet hier gebraucht. Wir hatten lange genug keinen Obersten Priester. Ich werde fähige Männer aussuchen, die alle drei Götteropfer zum Tempel von Deux bringen!»
«Was?», fragte Johannes entsetzt. Er war in jedem Fall davon ausgegangen, dass er die Reise antreten würde: «Das könnt Ihr nicht tun!»
«Das kann ich sehr wohl!», meinte der König: «Und nun geht. Mich strengt es an mit Euch zu sprechen!»
«Bei den Göttern. Ihr macht einen schweren Fehler!», sagte Johannes: «Verflucht soll der sein, der sich gegen die Götter und seine Priester stellt!»
«Ihr wagt es mir zu drohen?», schrie der König.
Lord Philipp wollte etwas sagen um die Sache zu deeskalieren. Doch der König war sichtlich aufgebracht und wütend. Und dies war durchaus verständlich. Es ging immerhin um seine Tochter. Barsch unterbrach er seinen Kommandeur: «Schweigt, Lord Philipp. Ich lasse mir das nicht gefallen! Nehmt Ihn fest und schmeißt ihn in den Kerker!»
«Was?», Lord Philipp starrte seinen Herrscher irritiert an. Ja, er war voll und ganz dafür, dass man dem Priester mal einen Denkzettel verpassen musste. Allen Priestern im Grunde. Es gab so viele Geschichten. Von Unzucht, von Hurerei, Besäufnissen ... und im Grunde versteckten sich die Priester hinter einer Fassade göttlichen Glaubens. Aber den Obersten Priester wegzusperren? Nein, davon hielt er nichts. Das war dann doch zu viel.
«Hört Ihr nicht?», schrie der König und winkte die Wachen, die am Eingang standen, her.
Diese reagierten nur zögerlich. Eigentlich musste der Kommandeur reagieren. Aber der stand nur da. Und so gingen sie zu dem Priester und packten diesen.
Lord Philipp reagierte dann doch. Er ging zum Priester, schaute diesen einen Moment an und meinte schließlich zu den beiden Soldaten: «Führt ihn ab!»
«Bei den Göttern, das war nicht meine Absicht!», sagte Lord Marcus: «Ich hätte nie gedacht, dass der König so reagiert!»
Lord Philipp schüttelte den Kopf: «Es ist nicht Eure Schuld. Ich hätte vermutlich genauso gehandelt. Unter uns, ich traue den Priestern nicht. Doch das ist der falsche Weg! Das wird schnell seine Runde in der Stadt machen!»
«Ihr sagt also, dass der König überzogen reagiert hat?», fragte Lord Marcus unsicher. Er selbst würde das vielleicht denken, aber nicht laut aussprechen.
«In der Tat. Er hat sich verändert seit seiner tagelangen Starre. Er ist launisch geworden. Teilweise sogar aggressiv!», meinte der Kommandeur: «Euch trifft keine Schuld!»
«Ich hätte mich raushalten sollen!»
«Was hattet Ihr überhaupt bei den Priestern gesucht?»
«Nun ja. Ich wollte um Zusammenarbeit bitten. Bei den Ermittlungen in Zukunft müssen alle Aspekte berücksichtigt werden.»
«Nun, das gelang Euch nicht. Das ist sicher. Auf die Hilfe der Priester müsst Ihr erst einmal verzichten!»
«Ich hatte mir das alles anders vorgestellt!»
Lord Stephan kam mit raschen Schritten auf die beiden zu. Schon von Weitem fragte er: «Was ist los? Man hat mich rufen lassen?»
«Der König hat befohlen den Obersten Priester einzusperren!», meinte der Kommandeur.
Lord Stephan riss die Augen weit auf: «Was? Aber wieso?»
«Nun ja. Die Priester sind nicht wirklich das, was sie darstellen oder zumindest versuchen dazustellen, sie sind ...», Lord Marcus suchte nach Worten: «... nicht immer so tugendhaft!»
«Das ist mir klar!», meinte Stephan: «Das ist allen klar. Aber sie sind die Priester. Und das ganze Volk fürchtet nichts mehr als die Götter. Keinen Krieg, keine Seuche, nichts fürchten sie mehr als die Götter. Und die Priester sind der direkte Draht zu ihnen!»
«Und wer sagt das? Die Priester. Auch ich bin ein gläubiger Mann, aber es ist doch denkbar einfach für die Priester zu sagen all ihre Worte sind die Worte der Götter!», Lord Philipp zeigte auf sein königliches Siegel, das er am Finger trug: «Dies hier zeichnet mich aus, dass ich die Stimme des Königs bin. Ihr alle tragt diesen Ring. Aber wenn der König ihn uns wegnimmt, dann sind wir auch nicht mehr seine Stimme. Den König, den hört man. Er kann zum Volk sprechen und einen Offizier aus seiner Offizierswürde verbannen. Wer aber hört die Götter? Nur die Priester.»
Stephan nickte: «Ich gebe Euch recht, Lord von Raditon. Und dennoch ist es taktisch unklug. Die Priester sind mächtig und spielen mit der Angst!»
Der Kommandeur schaute seinen Offizier an. Er wusste, dass dieser recht hatte. Sie konnten den Priester nicht wegsperren. Das würde für Ärger sorgen. Aber der König hatte entschieden.
«Ihr solltet noch mal mit dem König sprechen!», meinte Marcus um Lord Stephan zu unterstützen.
Philipp nickte: «Ihr habt beide recht, meine Herren. Und ich bin Eurer Meinung. Ich werde mit ihm sprechen. Gleich morgen früh!»
10
Xipe Totec,
Königlicher Palast
Oxomoco rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Wobei die Bezeichnung Stuhl eher nicht zutraf. Es war mehr ein Sessel. König Atlacoya hatte darauf bestanden, dass man ihn für seinen Stiefbruder aufstellte.
«Was ist mit deinem Freund?», fragte Atlacoya.
«Itzli? Er vergnügt sich vermutlich mit den Weibern. Sie scharen sich um ihn wie um einen verletzten Hund!»
«Was findest du nur an ihm?», Atlacoya verstand es nicht.
«Er ist mir treu und wir sind ein gutes Gespann!»
«Ein Gespann? So wie eine Art Pferdegespann?»
«Du weißt, wie ich das meine! Du bist nicht dumm!»
«Nein, bin ich nicht. Deshalb bin ich König!», grinste Atlacoya.
Oxomoco schüttelte den Kopf. Der Mann mit dem nehatanischen Namen aber dem Aussehen eines Mani wirkte genervt: «Ich habe es dir schon einmal gesagt und wiederhole es gerne. Weder deine Intelligenz, noch die Götter sind dafür verantwortlich, dass du König bist. Sondern nur, dass du aus dem Schoß der Frau kamst, die von deinem Vater gevögelt wurde!»
«Du sprichst von unserer Mutter, als wäre sie irgendeine Nehatanerin von vielen!»
«Sie ist nicht meine Mutter und ich bin müde das immer und immer wieder zu wiederholen!»
Atlacoya wurde sauer: «Was hätte mein Vater tun sollen? Dich im Fluss ertränken? Oder hätte er dich den Söldnern überlassen sollen? Sie hätten dich an perverse Idioten verkauft. Und die hätten dann aus dir ein missbrauchtes Kind und später eine männliche Hure gemacht!»
«Ich bin deinem Vater immer dankbar gewesen, dass er mich gerettet hat. Und dennoch war ich für ihn eher wie ein Hund, den man von der Straße holt!»
«Ist dieses Denken der Grund, dass du nun so bist, wie du bist?», fragte Atlacoya und schaute zur Türe. Er bekam keine Antwort mehr.
«Verzeiht!», meinte einer der Soldaten: «Der Priester ist da. Mit dem Götteropfer!»
«Holt ihn herein!»
Der Hohepriester hatte nicht zu viel versprochen. Er hatte eine wahre Schönheit in Tezcatli Poca gefunden. Eine stolze junge Nehatanerin mit äußerst hübschem runden Gesicht, wahnsinnig schönen braunen Rehaugen, vollen Lippen und wallendem braunem Haar. Sie hatte einen schlanken Hals, war allgemein durchaus schlank, hatte jedoch enorm große Brüste.
Ihre Augen wirkten wach. Sie schien stolz zu sein, dass sie auserwählt war. Angst hatte sie keine. In ihr pochte zwar wie wild das noch junge Herz, aber wohl mehr der Aufregung geschuldet nun vor den König zu treten. König Atlacoya, den mächtigsten Mann von ganz Nehats.
Nackt wurde sie hereingeführt. Sie sah demütig aus, hatte den Kopf gesenkt. Ihr Respekt vor dem Herrscher war groß.
Atlacoya schaute sie von oben bis unten an. Er nickte zufrieden, stand von seinem Thron auf und ging dann zu ihr. Er fasste an ihre Brüste, hob sie ein wenig an, so als wollte er ihr Gewicht prüfen: «Fast zu schade um sie den Göttern zu opfern!», sagte er: «Sie wäre eine prächtige Sklavin in meinem Harem.»
Sie wurde rot vor Verlegenheit. Oxomoco konnte das nicht sehen. Obwohl er unter den fast schwarzen Nehatanern aufgewachsen war, hatte er dafür keinen Blick. Die Gefühlsregungen des schwarzen Volkes waren ihm fremd. Ein Nehataner wie Atlacoya sah jedoch trotz der dunklen Hautfarbe, dass sie errötete.
«Wie ist dein Name?», fragte der König.
«Mein Name ist Itoia, mein König!», sagte sie leise und demütig.
«Bei den Göttern. Was für ein prächtiges Weib. Ich würde dich am liebsten hier auf der Stelle vögeln. Was sagst du dazu, Baby, wird sie den Göttern gefallen!»
«Ich glaube nicht an die Götter!», sagte Oxomoco.
Atlacoya ging nicht darauf ein: «Sieh doch diese prächtigen Titten. Der schlanke Hals. Sie ist eine wahre Schönheit!»
«Du bist der König, dann nimm sie dir doch!», sagte der Mani.
«Ach, tatsächlich?», Atlacoya grinste.
«Ja. Du kannst alles haben. Vergiss diesen Göttermist. Vergiss den Priester und seine Worte ...»
Der Hohepriester schaute entsetzt auf den Mani. Dieser ungläubige Bastard. Er lästerte den Göttern.
Doch der König grinste: «Du willst mich nur provozieren, Bruder. Ohne sie müsstest du nicht auf die grüne Insel und zum Tempel von Deux. Aber vergiss nicht, du bekommst dann auch kein Pferd und keine Ausrüstung für deine Reise ins Land der Mani!»
«Helfen dir die Götter und der König nicht, dann hilf dir selbst. Ich finde schon einen Weg meine Reise zu ermöglichen.»
«Hast du eigentlich irgendwo ein kleines Büchlein, wo die ganzen beschissenen Sprüche stehen oder denkst du dir die alle aus?», fragte Atlacoya und haute der jungen Frau auf den Po.
Sie schrie laut auf.
«Wenn wir dann soweit wären!», meinte Oxomoco: «Ich würde mich gerne zurückziehen.»
«Das geht nicht!», sagte Atlacoya: «Du musst bei der Zeremonie dabei sein!»
«Welcher Zeremonie?», Oxomoco schüttelte den Kopf.
«Sie wird als Jungfrau geweiht. Im Tempel! Es ist alles vorbereitet. Oder etwa nicht, Priester?», die letzten Worte galten Tupac, dem Hohepriester.
«Ja, mein König. Das ist es!»
«Dann auf, auf!», sagte Atlacoya.
«Tut mir leid. Aber ich habe für sowas keine Nerven!», meinte der Mani.
«Du kommst mit!», des Königs Worte duldeten keinen Widerspruch.
Vom Palast des Königs führte eine Straße durch die gesamte Stadt bis zum Tempel auf der anderen Seite. Eine langgezogene Hauptstraße die kerzengrade durch Xipe Totec führte. Verließ man den gewaltigen Palast, dann sah man direkt auf den Tempel am Ende der Stadt. Ein Gebäude, das nicht ganz so gewaltig war, aber dennoch hervorstach. Und dominant auf der anderen Seite der Hauptstraße prangte.
Es war eine Demonstration von Macht, die Atlacoya hier vollzog. Wie auch immer er so schnell das alles organisieren konnte, bei der Bevölkerung sorgte er für den plötzlichen zweiten Auftritt am heutigen Tag für Aufregung. Vier Soldaten gingen voran, dann folgte Atlacoya, der König. Er trug einen goldenen Lendenschurz, der nicht nur golden aussah, sondern tatsächlich aus zahlreichen Goldplättchen bestand. Auf seinem Kopf saß eine goldene Krone mit pechschwarzen Federn. Der ohnehin schon hünenhafte König wirkte so noch größer.
Hinter ihm ging das Götteropfer. Die schönste Jungfrau, die der Hohepriester hatte auftreiben können. Ob sie wirklich die Allerschönste war, das war natürlich Geschmacksache. Eine Augenweide war sie in jedem Fall. Sie war komplett nackt. Nicht minder stolz ging sie hinter dem nehatanischen Herrscher. Sie war die Auserwählte.
Dahinter der Hohepriester und zwei weitere Priester. Dann folgten vier Soldaten, schließlich Oxomoco zusammen mit Itzli. Am Schluss des Zuges gingen noch einmal rund zwanzig Soldaten. Alle in Lendenschurz und mit Speeren bewaffnet.
«Was wird das hier?», fragte Itzli.
«Eine Zeremonie!», erwiderte Oxomoco.
«Ach ja? Und was soll ich da?»
«Wolltest du nicht brüderlich Leid und Freude teilen. Das ist das Leid!»
«Leid? Oh je. Was erwartet uns?»
«Was weiß ich. Du bist doch Nehataner. Du kennst die Sitten und Bräuche besser als ich!»
«Entschuldige, aber du bist im Königshaus aufgewachsen. Langsam habe ich das Gefühl, du versteckst dich hinter deiner manischen Maske! Du weißt vermutlich mehr über unser Nehataner als solche Leute wie ich. Arme Leute.»
Die Soldaten vorne kamen am Tempel an und blieben dort stehen. Zwei Tempeldiener standen links und rechts vor den großen Flügeltüren. Sie bliesen in zwei große gewundene Hörner. Es dauerte nicht lange und das Tor öffnete sich.
«Bei den Göttern. Ich war noch nie in so einem Tempel!», sagte Itzli.
«Gerade hast du noch gemeckert. Jetzt hört es sich an, als würdest du dich freuen. Entscheide dich für eine Gefühlsregung!», sagte Oxomoco und fuhr durch seinen Bart: «Oder aber sei einfach still, Schakal!»
Langsam setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Die Soldaten vorne marschierten durch das Tor. König Atlacoya folgte.
Itzli mache große Augen, als er schließlich ebenfalls den Tempel betrat. Zum ersten Mal in seinem Leben. Dem einfachen Volk war das Betreten eigentlich verboten. Und zu dem zählte er nun mal.
Was er sah übertraf all seinen Vorstellungen. Ein großer Saal tat sich auf. Ganz hinten im Mittelpunkt war eine große goldene Statue. Sie war gut und gerne zehn Mal größer als er selbst. Und sie zeigte den Gott Regnator. Die vermutlich größte Statue, die es in Ariton jemals gab. Davor waren kleinere Statuen. Direkt vor Regnator in der Mitte Bellumus, der Kriegsgott. Im Rang stand er direkt unter dem Göttervater und größten Gott. Links von Bellumus war Aviustus, der Gott der Wüste, dann Adfectus, der Gott der Liebe und schließlich Montis, der Gott der Berge. Auf der rechten Seite waren Venatura, der Gott der Jagd, daneben Cultivius, der Gott des Ackers und zuletzt Aquarius, der Gott des Wassers.
Itzli war erstaunt über derartige prunkvolle Statuen.
Links und rechts des Saales standen nackte weiße Männer. Allerdings waren es Nehataner. Sie hatten sich von oben bis unten angemalt. Nur an den Augen war ein schmaler Streifen nichtbemalter Haut zu sehen.
Was die ganze Sache unheimlich machte war ihr Summen. Das dumpfe Raunen hallte im ganzen Saal wieder. Die Männer schienen in einer Art Trance zu sein. Ihre Augen waren geschlossen und ihre weiß angemalten Körper bewegten sich vor und zurück. Sie wippten im Takt ihres eigenen Raunens.
Der König blieb vor der Statue von Bellumus stehen. Es sah so aus, als würde er den Gott um Erlaubnis bitten an ihm vorbei zu gehen. Er verbeugte sich vor der Statue und ging dann links an ihr vorbei. Eine Treppe führte hinauf zum Hauptgott. Zu Regnator, der großen Statue dahinter. Er winkte das Götteropfer zu sich. Langsam folgte die nackte junge Frau dem König. Sie zitterte. Nun überwog doch die Angst. Die Unsicherheit und die Furcht vor dem Unbekannten.
Itoia stand nun neben dem König. Er zeigte auf eine kreisförmige Stelle unterhalb der Statue. Dort hin sollte sie sich stellen. Sie gehorchte. Der König befahl ihr sich hinzuknien. Und auch das tat sie.
«Schau hinauf zu Regnator!», meinte der Priester.
Sie schaute hinauf zur Statue. Regnator war als kräftiger, muskulöser Mann dargestellt. In seinen beiden Händen hielt er ein Horn. Das Horn von Deux. Das heilige Horn aus dem der Gott aller Götter den Lebenssaft schenkte. So zumindest die Legende. Es sah so aus, als würde Regnator das Horn genau über der kreisrunden Stelle ausschütten auf der Itoia stand.
Sie war die Auserwählte. Sie war das Götteropfer. Zwanzig Tage lang hatte Tupac, der Hohepriester der Nehataner, Jungfrauen aus dem ganzen Land suchen lassen und sie hierhergebracht. Erst hier hatten die Priester dann sie erwählt. Aus sage und schreibe siebenundsiebzig Jungfrauen. Was aus den anderen geworden ist, dass wusste sie nicht.
Das Summen der weißen Männer verstummte. Und mit einem Schlag war es unglaublich still.
«Was geschieht nun?», fragte Itzli.
«Nichts Gutes!», meinte Oxomoco. Davon war er überzeugt. Es war nicht seine erste Zeremonie. Und die Meisten verband er mit schlimmen Erinnerungen.
Das Summen verstummte. Bewegung kam in den Tempel. Die weißen Männer drehten sich nach vorne um und verschwanden dann nach und nach in zwei Eingängen links und rechts neben den Statuen.
Itoia hatte Freundinnen gefunden. Mit vier Mädchen aus den Reihen der siebenundsiebzig Jungfrauen hatte sie sich besonders gut verstanden. Würde sie die vier jemals wiedersehen? Jetzt nachdem sie zum Götteropfer gewählt wurde?
Ja, sie würde. Und zwar in diesem Augenblick. Bei dieser Zeremonie. Hinter der Statue von Regnator war eine Art Empore. Links und rechts durch zwei Eingänge kamen nun die weißen Männer. Begleitet von jeweils einer der Jungfrauen. Damit war klar, dass es insgesamt sechsundsiebzig Männer gewesen waren. Jeweils achtunddreißig auf jeder Seite.
«Bei den Göttern, was wird das?», fragte Itzli.
Und Oxomoco wiederholte seine Worte: «Nichts Gutes!» Der Mani hielt nichts von den Göttern. Mehr noch, er leugnete ihre Existenz.
Eine der jungen Frauen, die mit Itoia befreundet waren, sah das Götteropfer unterhalb der Statue knien. Sie lächelte gequält. Angst überfiel sie. Hinter ihr stand einer der weißen Männer. Ja, auch sie wäre gerne die Auserwählte geworden. Aber sie gönnte es Itoia. Und sie hoffte, sie würde sie irgendwann einmal wiedersehen.
Es war erdrückend still plötzlich.
Dann sprach der König.
«Lasst uns die Kraft aller anderen Jungfrauen vereinen!», sagte Atlacoya laut: «Tut Eure Pflicht, Diener des Tempels!»
Die weiß angemalten Männer begannen sich ihre jeweilige Frau zurechtzulegen. Die meisten wehrten sich nicht. Sie platzierten sie auf der äußerst seltsamen Vorrichtung vor sich. Legten sie mit dem Rücken darauf.
Als der König sah, dass die sechsundsiebzig Jungfrauen platziert waren, hob er die Hand. Nackt auf dem Rücken lagen sie. Jede einzelne direkt vor einem der weißen Männer. Atlacoya machte eine Handbewegung. Worte waren nicht nötig.
Und schließlich nahm sich jeder der weißen Männer die jeweilige Frau vor sich. Einige der Frauen versuchten sich zu wehren. Zappelten, schrien. Andere wiederrum waren erstarrt vor Angst.
«Heilige Götter der sieben Monde und der Sonne. Sie werden alle vergewaltigt!», sagte Itzli.
«Das ist noch gar nichts!», sagte Oxomoco. Er hatte dort schon andere Szenen gesehen.
Die junge Frau, die mit Itoia befreundet war, schrie auf, als der Mann vor ihr in sie eindrang. Tränen rannen ihre Wangen hinunter. So hatte sie es sich nicht vorgestellt. Wie ein wildgewordener Stier rammte der weiß angemalte Mann seinen Schwanz in sie und befriedigte sich an ihr. Tief und fest stieß er zu. Sein weiß angemaltes Gesicht verzog sich zu einer hässlichen Fratze. Und es dauerte nicht allzu lange, bis er kam.
Es war wie ein Nebelschleier, der die Frau umgab. Sie spürte, wie er sie fickte. Es schmerzte. Und als er kam, schmerzte es noch mehr. Tief trieb er sein Glied in sie. Auf dem Höhepunkt angekommen nahm er ein Messer. Sie sah es erst im letzten Augenblick.
Sie hörte links von sich einen kurzen Schrei, der dann verstummte. Ein weiterer von rechts. Dann noch einer. Und dann schrie auch sie. Als er das Messer an ihre Kehle ansetzte, ergriff sie die Panik. Sie schrie voller Angst. Doch der Schrei endete nur in einem schrecklichen Gurgeln, als er ihr die Kehle aufschnitt. Er war nicht einmal draußen mit seinem Geschlecht, als er sie tötete. sein Penis steckte noch in ihr. Das Blut rann aus ihrer Kehle.
«Was ... was tun die da?», fragte Itzli erschrocken und völlig bewegungsunfähig. Er war mehr als entsetzt. Fühlte sich machtlos.
«Sie opfern die Jungfrauen Regnator!»
«Aber ...», Itzli spürte, wie er schwach wurde. Sein Körper bebte. Das hatte er nicht erwartet. Und es war schrecklicher als er sich es jemals hätte vorstellen können.
Tränen rannen an den Wangen von Itoia herunter und tropften auf den kalten Boden. Tränen der Erleichterung. Weil sie nicht sterben musste. Zumindest noch nicht. Aber auch Tränen der Trauer durch den Verlust ihrer Freundinnen. Nach und nach wurde jeder dort oben die Kehle durchgeschnitten.
Das Blut floss direkt in eine Rinne. Diese war zur Mitte abschüssig. Von links und rechts floss so das Blut in das Zentrum und von dort über ein Konstrukt hinüber zu Regnator. Literweise. Direkt in die Statue hinein. Und von dort ...
Itoia kniete vor dem Gott der Götter. Sie schaute zu ihm empor. Schaute auf das Horn, das er vor sich hielt. Gerade so als wolle er etwas über sie schütten. Und schließlich floss das Blut der sechsundsiebzig Jungfrauen direkt über das Horn auf sie.
Die weißen Männer ließen ab von den Frauen und fingen an wieder zu summen.
Itzli musste sich fast übergeben. Er schaut weg. Er konnte nicht zuschauen, wie das ganze Blut über die siebenundsiebzigste Jungfrau floss. Es war ein grausamer und schockierender Anblick.
Atlacoya lächelte: «Nun vereinst du in dir die Kraft vieler Jungfrauen. Du bist das mächtigste Götteropfer und stärker als alle anderen aus den sechs Völkern, die mir so zuwider sind. Nutze die Kraft. Gehe zum Tempel von Deux und mache Regnator glücklich!»
Blutüberströmt stieg Itoia aus dem runden Kreis. Sie zitterte. Stand unter Schock. Und schließlich folgte sie vollkommen neben sich dem König der langsam durch den Saal schritt und schließlich hinausging. Er ging weiter Richtung Tempel. Itoia hinterher. Blutüberströmt ging sie über die Straße. Vorbei an den zahlreichen Nehatanern, die sie entgeistert anblickten.