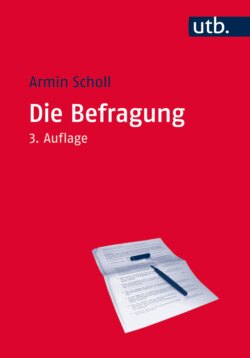Читать книгу Die Befragung - Armin Scholl - Страница 8
Оглавление| [29]2 | Verfahren der Befragung |
Die Verfahren der Befragung lassen sich nach ihrem Kommunikationsmodus in drei Gruppen unterteilen: persönliche (face to face), telefonische und schriftliche Befragungen. Das jüngste Verfahren der Online-Befragung stellt zwar eigentlich nur eine Variante der schriftlichen Befragung dar, aber sie bekommt zunehmend ein eigenes Profil und wird deshalb hier als eigenständiges Verfahren behandelt. Neben der Charakterisierung der Verfahren selbst wird auch die jeweilige Stichprobenpraxis beschrieben, weil diese wesentlich zu den Vorteilen und Nachteilen des Verfahrens beiträgt. Die Unterstützung der Befragung durch den Computer, die unter dem Oberbegriff »Computer Assisted Interviewing« (CAI) firmiert, erschließt neue Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Befragungsverfahren, die aber auch mit neuen Anforderungen und Problemen verbunden sind.
| 2.1 | Das persönliche (face-to-face) Interview |
| 2.1.1 | Beschreibung und Varianten |
Das persönliche Interview ist eine Befragungsform, das auf der Anwesenheit von einem (selten zwei) Interviewer(n) und einem (selten mehreren) Befragten basiert. Es wird deshalb auch als »face-to-face«-Interview bezeichnet.
Grundsätzlich lassen sich drei Varianten unterscheiden: das Hausinterview, das Passanteninterview und die »Klassenzimmer«-Befragung.
Beim Hausinterview sucht der Interviewer den Befragten auf, entweder in dessen Privatwohnung, an seinem Arbeitsplatz oder an einem verabredeten anderen Ort. Es ist die häufigste Variante der mündlichen Befragung, die auch die größten Möglichkeiten bietet, während die anderen Varianten verschiedenen Beschränkungen unterliegen.
Beim Passanteninterview führt der Interviewer die Befragung im öffentlichen Raum durch, zum Beispiel in der Fußgängerpassage einer Innenstadt. Für den Einsatz dieser Variante müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein bzw. Beschränkungen berücksichtigt werden (vgl. Nötzel 1989; Friedrichs / Wolf 1990):
Die Grundgesamtheit muss in Beziehung stehen mit dem Ort der Befragung. Dies ist der Fall, wenn Käufer in der Innenstadt oder Passanten, die an einer Plakatwand oder an einem Flugblattverteiler vorbeigehen, interviewt werden.
[30]Die Interviews müssen kurz gehalten werden, da die Situation flüchtig ist und die Passanten andere Ziele verfolgen und wenig Zeit haben.
Externe Faktoren wie Wetter und Tageszeit beeinflussen den Ablauf von Passanteninterviews wesentlich, sodass die Bedingungen vorher genau ermittelt werden müssen.
Bei der Klassenzimmer-Befragung werden die Fragebögen durch einen Verteiler persönlich an die Befragten übergeben, aber von diesen selbst ausgefüllt (selfadministered questionnaires). Der Verteiler der Fragebögen motiviert zur Teilnahme an der Befragung, steht für Rückfragen der Befragten zur Verfügung und erläutert gegebenenfalls den Zweck der Untersuchung, greift aber sonst nicht ein. Damit ist die Klassenzimmer-Befragung eine Hybridform aus mündlicher und schriftlicher Befragung (vgl. Hafermalz 1976: 12). Voraussetzung für diese Befragungsart ist allerdings, dass die Befragten räumlich nicht verstreut sind, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten, relativ geschlossenen Ort versammelt sein müssen, an dem die Fragebögen verteilt und in der Regel auch wieder eingesammelt werden müssen. Damit reduziert sich die Einsatzmöglichkeit dieser Variante der persönlichen Befragung auf Fragestellungen, bei denen in der Regel homogene Gruppen untersucht werden sollen (Schulklassen, Universitätsseminare, Ressorts in journalistischen Redaktionen, Abteilungen in Unternehmen und Behörden usw.).
Da das Passanteninterview und die Klassenzimmer-Befragung nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden können, beziehen sich die folgenden Ausführungen in erster Linie auf das wesentlich häufiger verwendete Hausinterview.
| 2.1.2 | Stichprobe |
Da die Stichprobenziehung zuerst für die mündliche Befragung entwickelt wurde und diese Verfahren grundlegend für die Befragung im Allgemeinen sind, können anhand derer generelle Anforderungen an die Stichprobenziehung erläutert werden. Deshalb sollen sie im Kontext der mündlichen Befragung ausführlicher behandelt und in den Abschnitten über die telefonische und schriftliche Befragung nur noch die dafür spezifischen Varianten beschrieben werden.
Um die Repräsentativität einer Stichprobe zu erreichen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird mit einem Zufallsverfahren gewährleistet, dass prinzipiell jedes Element der Grundgesamtheit (etwa der gesamten erwachsenen Bevölkerung eines Landes) die gleiche Chance hat, in die Stichprobe zu gelangen. Hier gewährleistet (bereits) die korrekt durchgeführte Prozedur die Repräsentativität der Stichprobe hinsichtlich aller Merkmale. Das elaborierteste Verfahren ist das ADM-Stichproben-System, das vom »Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute [31]e.V.« entwickelt wurde (→ Kapitel 1.1; www.utb-shop.de, Kapitel 1.2.1). Alternativ dazu kann Repräsentativität dadurch hergestellt werden, dass die Verteilung der wichtigsten Merkmale der Stichprobe – das sind meist die soziodemografischen Kennzeichen – mit der Verteilung dieser Merkmale in der Grundgesamtheit zur Übereinstimmung gebracht werden (→ www.utb-shop.de, Kapitel 1.2.2).
In der Praxis werden die prozedurale und die ergebnisorientierte Variante miteinander kombiniert, allerdings werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt: Bei der Zufallsstichprobe wird in erster Linie Wert darauf gelegt, ein elaboriertes Verfahren zu entwickeln, mit dem die Zufälligkeit der Auswahl geregelt wird. Das Ergebnis der Stichprobenziehung wird mit den wichtigsten Merkmalen der Grundgesamtheit verglichen und – bei Abweichungen – durch Gewichtung korrigiert. Beim Quotenverfahren erfolgt der Abgleich der Stichprobenmerkmale mit den Grundgesamtheitsmerkmalen, während die Studie noch im Feld ist, sodass mögliche Abweichungen durch spezielle Quotenvorgaben der unterrepräsentierten Segmente noch in der Feldzeit korrigiert werden können.
Festzuhalten bleibt, dass die Repräsentativität einer Stichprobe nicht in der Verteilung aller (denkbaren) Merkmale proportional mit der Grundgesamtheit übereinstimmen kann. Die Stichprobe ist nicht in dem Sinn ein Abbild der Grundgesamtheit wie das Foto von seiner abgebildeten Umgebung, sondern die Stichprobe ist selbst Teil der Grundgesamtheit. Insofern gilt Repräsentativität nur für spezielle Merkmale und streng genommen auch nur für den Zeitpunkt der Erhebung (vgl. Erichson 1992: 19f.).
Im Folgenden werden einige relevante Stichprobenmodelle vorgestellt. Im Befragungsalltag gibt es natürlich zahlreiche weitere Möglichkeiten der Stichprobenziehung, auch solche, die keinen Anspruch auf bevölkerungsweite Repräsentativität erheben.
Zufallsstichprobe mit dem ADM-Stichprobensystem
Das ADM-Verfahren ist eine dreistufige Gebiets- bzw. Flächenstichprobe auf der Basis von geografischen Einheiten, den Wahlbezirken: Auf der ersten Stufe werden so genannte Sampling Points, die zumeist den Wahlbezirken entsprechen, ausgewählt. Darauf folgt eine Ziehung der Privathaushalte mit Hilfe einer Zufallsbegehung, woraus im letzten Schritt die zu befragenden Zielpersonen ermittelt werden (vgl. Behrens / Löffler 1999: 69). Die Grundgesamtheit bilden somit Privathaushalte unter Ausschluss von »Anstaltshaushalten«, gewerblichen Betrieben und Mehrfach-Wohnsitzen. Das vereinigte Deutschland besteht aus über 80.000 Wahlbezirken, die allerdings unterschiedlich viele wahlberechtigte [32]Personen umfassen. Deshalb werden einige Wahlbezirke zu synthetischen »Sample Points« zusammengefasst mit mindestens 400 Wahlberechtigten.
1. Stufe: Die Stichprobe der Sample Points wird als systematische Zufallsauswahl gezogen. Systematisch ist die Auswahl deshalb, weil sie nach verschiedenen geographischen Einheiten getrennt erfolgt: nach Bundesländern, pro Bundesland nach Regierungsbezirken, pro Regierungsbezirken nach Kreisen, pro Kreis nach Gemeindegrößeklassen, pro Gemeindegrößeklasse nach Gemeinden, eventuell Stadtteilen und Wahlbezirken. Auf diese Weise werden je nach Bedarf der ADM-Institute gesamtdeutsch 128 Netze aus jeweils 258 Sample Points gebildet (vgl. Behrens / Löffler 1999: 74ff.).
2. Stufe: Zur Ermittlung der Privathaushalte wird die im ersten Schritt ausgewählte Fläche »begangen«. Dazu wird ein Startpunkt bestimmt, von dem aus zwischen 20 und 50 Adressen von den Türschildern abgeschrieben oder erfragt werden. Das können entweder alle hintereinander oder nur jede x-te Adresse bis zur geforderten Anzahl sein. Für diese Zufallsbegehung gibt es genaue Anweisungen. Sie kann entweder als Adress-Random realisiert werden, wobei die Begehung bzw. Adressermittlung und die eigentliche Befragung voneinander getrennt werden, oder mittels Random-Route bzw. Random-Walk direkt mit der Befragung verknüpft werden. Die Trennung zwischen Stichprobenauswahl und Befragung beim Adress-Random entlastet den Interviewer, während bei Random-Route möglicherweise unbequeme Adressen übersprungen werden. Allerdings ist Random-Route ökonomisch und zeitlich günstiger und immer dann geeignet, wenn aufgrund der Beschränkung der Grundgesamtheit (etwa auf bestimmte Altersgruppen) mit hohen Fehlkontakten zu rechnen ist (vgl. Behrens / Löffler 1999: 78ff.; Noelle-Neumann / Petersen 1996: 246ff.).
3. Stufe: Schließlich muss die zu befragende Zielperson im Haushalt bestimmt werden. Dazu werden die Haushaltsmitglieder aufgelistet und per Zufallsverfahren (»Schwedenschlüssel«) die Zielperson ausgewählt. Alternativ kann auch die Person befragt werden, die als letztes Geburtstag hatte oder als nächste Geburtstag hat. Da die Haushalte aus unterschiedlich vielen Personen bestehen, haben Personen in kleinen Haushalten eine höhere Auswahlwahrscheinlichkeit, was gegen die wahrscheinlichkeitstheoretischen Regeln der Zufallsauswahl verstößt, wonach jedes Mitglied der Grundgesamtheit die gleiche Chance haben muss, ausgewählt zu werden. Deshalb werden in großen Haushalten oft zwei Personen befragt. Außerdem können bei bekannter Haushaltsgröße die individuelle Auswahlwahrscheinlichkeit jeder Person errechnet und diesbezügliche Disproportionalitäten durch Gewichtung in der Stichprobe ausgeglichen werden (vgl. Behrens / Löffler 1999: 81ff.).
[33]Die Ausschöpfung einer geplanten Stichprobe ist nie vollständig, weil aus verschiedenen Gründen das Interview mit der Zielperson nicht immer zustande kommt. Man unterscheidet unsystematische oder qualitätsneutrale und systematische oder (qualitäts)relevante Ausfälle. Zu den qualitätsneutralen Ausfällen, die keinen Einfluss auf die Güte der Stichprobe haben, zählen:
Dateifehler (Haushalt existiert trotz Adressauflistung nicht);
Straße oder Hausnummer nicht auffindbar;
Haushalt gehört nicht zur Stichprobe (Anstaltshaushalt, Gewerbebetrieb);
Wohnung oder Untermietwohnung zurzeit nicht bewohnt;
keine Person passt zur definierten Grundgesamtheit;
Haushalt oder Zielperson ist der deutschen Sprache nicht mächtig;
Totalausfälle von Sample Points;
Adresse nicht bearbeitet.16
Um relevante Ausfälle handelt es sich, wenn keine Interviews durchgeführt werden können, obwohl die Zielpersonen zur Stichprobe gehören. Hierzu zählen:
Haushalt oder Zielperson trotz mehrmaliger Versuche nicht erreichbar;
Haushalt oder Zielperson verweigert jede Auskunft ohne Angabe von Gründen, aus Zeitmangel, aus Interesselosigkeit oder aus prinzipiellen Erwägungen gegen Meinungsforschung;
Zielperson bricht das Interview frühzeitig ab;
Zielperson ist krank oder kann dem Interview geistig nicht folgen;
Interview ist fehlerhaft und kann nicht ausgewertet werden17 (vgl. Behrens / Löffler 1999: 88f.; Porst 1991: 61).
Die Ausschöpfungsquote ist ein wichtiger Indikator für die Qualität der Stichprobenrealisierung; sie wird wie folgt berechnet18: Ausgangspunkt ist die Bruttostichprobe, die alle ausgewählten und eingesetzten Adressen umfasst. Davon werden die qualitätsneutralen Ausfälle abgezogen; der Rest ist die Nettostichprobe [34]oder »bereinigte« Stichprobe. Von dieser werden die relevanten Ausfälle abgezogen, sodass der Anteil der tatsächlich durchgeführten und auswertbaren Interviews an der Nettostichprobe die Ausschöpfungsquote ergibt. Man kann zwar nicht eindeutig mathematisch bestimmen, unterhalb welcher Grenze eine Stichprobe nicht mehr repräsentativ ist, aber die Marktforschung sieht als Konvention eine Mindestausschöpfung von 70 Prozent an, deren Unterschreitung zumindest begründet werden muss (vgl. Behrens / Löffler 1999: 88ff.). Kritiker bezweifeln allerdings, dass bei einem Ausfall von bis zu 30 Prozent die wahrscheinlichkeitstheoretischen Annahmen der Zufallsauswahl noch gültig sind. Zudem ist die geforderte Ausschöpfungsquote von 70 Prozent in der Praxis selten in einem vertretbaren Aufwand zu realisieren (vgl. Sommer 1987: 300f.).
Quotenstichprobe
Wie aus diesen Ausführungen ersichtlich wird, ist das Vorgehen auf ADM-Basis in der Praxis sehr aufwändig. Aus diesem Grund bevorzugen einige Meinungsforschungsinstitute das Quotenverfahren, das bereits in 40er Jahren in den USA entwickelt wurde.
Ausgangspunkt ist nicht die Grundgesamtheit selbst und ihre Elemente, sondern die statistischen Proportionen bzw. Merkmalsverteilungen der Grundgesamtheit. Aufgrund amtlicher Daten des Mikrozensus oder den Ergebnissen der »MediaAnalyse« (→ www.utb-shop.de, Kapitel 1.2.1) sind folgende Merkmale und ihre Verteilungen in der Grundgesamtheit bekannt:
regionale Verteilung nach Bundesländern, Regierungsbezirken und Gemeindegrößen (vier Wohnortgrößegruppen);
Geschlecht;
Alter bzw. (vier) Altersgruppen;
Anteil Berufstätiger und (sechs) Berufsgruppen;
bekannte Konsummerkmale (Besitz bestimmter Konsumartikel).
Anhand dieser Merkmale wird ein Quotenplan entwickelt, der einen modellgerechten Miniaturquerschnitt der Grundgesamtheit abbildet. Mit diesen Quotenvorgaben suchen die Interviewer die Befragten selbstständig aus. Damit einher gehen zwei Annahmen: Durch die komplexe Quotenvorgabe, die mehrere Merkmale umfasst, ist der Interviewer in seinem Ermessensspielraum eingeschränkt und praktisch gezwungen, die Befragten annäherungsweise zufällig auszuwählen, sodass systematische Verzerrungen zumindest verringert werden können. Über die (wenigen) Quotenmerkmale hinweg wird Repräsentanz auch für andere Merkmale, die mit ihnen korrelieren, hergestellt. Dies kann man zumindest für [35]diejenigen weiteren Merkmale kontrollieren, für die externe Daten vorliegen (vgl. Noelle-Neumann / Petersen 1996: 255ff.; Meier / Hansen 1999: 103ff.).
Folgende Anforderungen sind an die Erstellung von Quotenplänen zu stellen:
Die Quoten müssen objektiv und spezifisch sein, sodass sie nicht erst vom Interviewer interpretiert werden müssen.
Die Quotenvorgabe darf weder zu einfach sein, um zu vermeiden, dass der Interviewer (nur) Personen aus seinem Bekanntenkreis auswählt, noch zu schwierig sein, um zu vermeiden, dass der Interviewer die Befragtenmerkmale fälscht und sie an die Quotenvorgabe anpasst.
Der Fragebogen sollte multithematisch sein, damit der Interviewer die Zielpersonen nicht nach ihrer (vermeintlichen) Themenkompetenz auswählt.
Die Interviews sollten vorwiegend in Wohnungen und nicht auf der Straße durchgeführt werden, damit mobile Personen nicht überrepräsentiert werden.
Die Befragung sollte auf möglichst viele Interviewer verteilt sein, sodass individuelle Verzerrungen sich nicht stark auf das Gesamtergebnis auswirken oder sich im Durchschnitt ausgleichen (können).
Dementsprechend sollte die Zahl der Interviews pro Interviewer möglichst gering sein, damit die Aufgabe auch zeitlich zu bewältigen ist und keine Frustrationen mit der Quotenerfüllung entstehen.
Insgesamt sollte das Interviewernetz eines Instituts soziodemografisch heterogen, ähnlich der Bevölkerungsstruktur, zusammengesetzt sein, damit keine Verzerrungen entstehen selbst für den Fall, dass die Interviewer Zielpersonen aus ihrem Milieu bevorzugt auswählen.
Die Interviewer müssen intensiv geschult und ihre Tätigkeit regelmäßig und zentral kontrolliert werden, damit Verstöße im Vorfeld minimiert und während der Feldzeit schnell entdeckt und korrigiert werden können (vgl. Noelle-Neumann / Petersen 1996: 278f.; Meier / Hansen 1999: 109ff.).
Mittlerweile haben etliche Methodenexperimente stattgefunden, um Unterschiede zwischen Zufallsverfahren und Quotenverfahren zu ermitteln. Tatsächlich stimmen die Verteilungen weitgehend überein (vgl. Reuband 1998b; Noelle-Neumann / Petersen 1996: 263ff.). Dennoch verbleibt als Nachteil des Quotenverfahrens, dass die Qualität der Auswahl selbst nicht kontrollierbar ist. Die Berechnung einer Ausschöpfungsquote ist nicht möglich, da der Interviewer zielgerichtet die Personen selbst aussucht und nicht angibt, wie viele Fehlversuche er hatte. Auch ist nicht kontrollierbar, ob er mehrfach dieselben Personen befragt.
Für beide Verfahren gilt: Repräsentanz ist weitgehend abhängig von der Feldarbeit, denn die Kontrolle der Einhaltung der Zufallsauswahl oder der Quotenmerkmale [36]erfordert einen erheblichen Aufwand. Dies gilt insbesondere, um die oben genannten relevanten Fehler der Verweigerung und der Nichterreichbarkeit (→ Kapitel 7.3.3) zu vermindern (vgl. Erichson 1992: 23ff.).
Weitere Stichprobenmodelle
Neben diesen beiden Grundformen der Stichprobenziehung gibt es zahlreiche Sonderformen, die insbesondere eingesetzt werden, wenn es nicht um bevölkerungsrepräsentative Umfragen geht, sondern um sehr spezifische Bevölkerungsgruppen oder um direkte Vergleiche zwischen verschiedenen Befragtengruppen.
Wenn die Auswahl der Zielpersonen in Abhängigkeit von einem bestimmten Ereignis, etwa von einer Messe, erfolgt, werden Zeitintervallstichproben eingesetzt. Diese sind zeit- und ortsabhängig. Es handelt sich in der Regel um mehrstufige Stichproben, bei denen im ersten Schritt die Befragungsorte ausgewählt werden, zum Beispiel die Eingänge der Messe und die Räume innerhalb der Messehalle. Danach werden die Zeitintervalle bestimmt, innerhalb derer die Befragung durchgeführt wird. Die Auswahl der Befragten erfolgt durch ein bestimmtes, vorher festgelegtes Kriterium, zum Beispiel jede x-te Person, die eine gedachte Linie überschreitet. Für die Entwicklung eines Stichprobenplans sollten die besonderen Gegebenheiten des Ereignisses berücksichtigt werden, um Verzerrungen zu vermeiden (vgl. von der Heyde 1999: 113ff.; Nötzel 1987b).
Speziell für die Klassenzimmer-Befragung ist in der Regel eine Klumpenstichprobe sinnvoll. Dies ist eine mehrstufige Auswahl, bei der räumlich abgegrenzte (Teile von) Organisationen (etwa Schulklassen) entweder per Zufall oder je nach Fragestellung der Untersuchung bewusst ausgewählt werden. Innerhalb dieser ausgewählten Einheiten werden dann alle Individuen (das heißt der ganze »Klumpen«) befragt. Der Vorteil besteht in der Effizienz bei der Durchführung. Allerdings wirkt sich die Klumpung dann negativ aus, wenn die Klumpen sehr homogen sind, weil dann die Gesamtstichprobe weniger Varianz aufweist als bei anderen Stichprobenverfahren und in Bezug auf das homogene Merkmal zu systematischen Verzerrungen führt.
Bei Netzwerkanalysen (→ www.utb-shop.de, Kapitel 4.2) ist es sinnvoll, mit dem Schneeballverfahren zu arbeiten. Dazu wird in einer ersten Stufe per Zufallsverfahren eine Ausgangsstichprobe gezogen. Die befragten Personen werden dann um weitere Adressen gebeten von Personen, die sich im gleichen Netzwerk befinden (Freunde, Bekannte, Kollegen, Verwandte) oder in irgendeiner Hinsicht für sie relevant sind (etwa als Meinungsführer zu bestimmten Themen). Diese zweite Stufe erfolgt nicht mehr als Zufallsverfahren, sondern stellt eine bewusste Auswahl der Befragten selbst dar.
[37]Für einige Forschungszwecke ist eine bewusste Auswahl nach bestimmten Merkmalen notwendig. Hier gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten: So können aufgrund der Fragestellung der Untersuchung Personengruppen mit einem extremen oder untypischen Merkmal wie die Fernsehverweigerer ausgewählt werden. Da es für solche Gruppen keine Übersicht über die Grundgesamtheit gibt und eine Flächenstichprobe zu große Streuverluste in Kauf nehmen müsste, ist eine zufällige Auswahl nicht durchführbar. Darüber hinaus ist die Population hauptsächlich hinsichtlich des einen spezifischen Merkmals von Forschungsinteresse, sodass es weniger auf die Repräsentanz hinsichtlich anderer Merkmale ankommt, sondern auf eine gewisse Bandbreite bzw. Streuung in Bezug auf andere Merkmale. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Auswahl von normalen oder typischen Personengruppen in Bezug auf ein bestimmtes Merkmal, also etwa Personen mit einem durchschnittlichen Fernsehrezeptionsverhalten. Sowohl bei der Auswahl extremer als auch normaler Personen(gruppen) geht es darum, diese intensiver oder detaillierter beschreiben zu können. Wenn dagegen eher der Vergleich zwischen Gruppen im Mittelpunkt der Fragestellung stehen soll, muss ein bestimmtes Spektrum abgedeckt werden. Dieses Spektrum kann je nach Untersuchungsziel wiederum eher ähnliche Personen(gruppen) berücksichtigen oder Extremgruppen.
Insbesondere bei nichtstandardisierten Befragungen sind solche bewussten Auswahlverfahren üblich, da keine quantitativen Auswertungen vorgenommen werden (→ Kapitel 3.1, 3.2, 3.3). Auch bei standardisierten Formen der Befragung wie beim Experiment sind nichtrepräsentative Auswahlverfahren üblich, wenngleich dort meist mit einem Zufallskriterium gearbeitet wird, damit bestimmte statistische Auswertungsverfahren überhaupt sinnvoll sind (→ Kapitel 3.6).
| 2.1.3 | Vorteile des persönlichen Interviews |
Alle Formen von Stichprobendesigns sind bei der persönlichen Befragung – beim Passanteninterview und bei der Klassenzimmer-Befragung allerdings nur eingeschränkt – möglich. Wenn Adresslisten oder Telefonnummern nicht verfügbar sind, kann auf eine räumliche Gebietsstichprobe mit einer eigenen Adressermittlung (etwa beim Random Route bzw. Random Walk) zurückgegriffen werden, wie dies beim ADM-Mastersample der Fall ist.
Der persönliche Kontakt mit dem Interviewer kann in mehreren Hinsichten die Qualität der Befragungsergebnisse erhöhen:
Bei unmotivierten oder unwilligen Befragten kann der Interviewer zur Teilnahme an der Befragung motivieren. Bei längeren Befragungen ist die Abbruchwahrscheinlichkeit geringer, wenn ein Interviewer sie persönlich durchführt. [38]Durch den Aufbau einer »persönlichen Beziehung« kann ein Vertrauensverhältnis entstehen, das zu einer höheren Akzeptanz der Befragung und des Fragebogens beim Befragten führt. Insgesamt ist die Ausschöpfungsquote der Stichprobe wegen des größeren Verbindlichkeitsgrades höher als bei den anderen Befragungsformen. Dies gilt für die Klassenzimmer-Befragung besonders, allerdings nur sehr eingeschränkt für das Passanteninterview.
Bei unverständlichen Fragen oder Antwortvorgaben kann der Interviewer Hilfestellung für die Beantwortung geben.
Bei ungenauen oder nicht passenden Antworten des Befragten kann der Interviewer in geeigneter Weise nachhaken, um die Antwort an die Frage bzw. die Antwortvorgaben anzupassen oder um sie zu vervollständigen.
Bei komplexen Instruktionen oder Sequenzen (zum Beispiel Filterführung) kann der Interviewer für die akkurate Befolgung durch den Befragten sorgen. Der Befragte wird dadurch von strukturellen Aufgaben, die für ihn zutreffende Frage im Fragebogen zu suchen, entlastet.
Für die Präsentation zahlreicher visuellen und optischen Unterstützungen sind Interviewer erforderlich. Bei langen Listen, die als Kartenspiele vorgelegt werden, kann der Interviewer die Reihenfolge systematisch rotieren oder zufällig auswählen (vgl. Noelle-Neumann / Petersen 2000).
Bei Mehrmethoden-Designs mit Selbstausfüller-Modulen, mit eingebauten Beobachtungsteilen (der Interviewer beobachtet die Wohnungseinrichtung oder das Verhalten des Befragten bei der Beantwortung der Fragen) oder mit experimentellen Anlagen ist die Anwesenheit des Interviewers erforderlich.
Bei qualitativen Interviews ist ein kompetenter Interviewer immer erforderlich und ein persönlich anwesender Interviewer gegenüber einem Telefoninterviewer zusätzlich im Vorteil, um vom Befragten komplexere und tiefere Informationen zu bekommen (vgl. Fowler 1988: 70ff.).
| 2.1.4 | Nachteile des persönlichen Interviews |
Aufwand und Kosten des persönlichen Interviews sind größer als in anderen Befragungsformen. Nur professionelle Institute können einen Interviewerstab organisieren, der für bundesweite Repräsentativstichproben geografisch flächendeckend eingesetzt werden kann. Rekrutierung, Einsatz, Kontrolle und Bezahlung der Interviewer sind sehr kostenintensiv. Für Passanteninterviews und Klassenzimmer-Befragungen entfällt dieser Nachteil weitgehend.
Die Feldphase dauert meist länger als bei anderen Befragungsformen, da die Interviewer die Befragten selbst aufsuchen müssen. Gerade bei mobilen Zielpersonen [39]kann dies zu einem höheren Aufwand führen. Passanteninterviews und Klassenzimmer-Befragungen haben dagegen eine kürzere Feldphase.
Einige Teilpopulationen sind mit anderen Befragungsarten besser erreichbar: Dazu gehören Bewohner oberer Stockwerke in Hochhäusern, Befragte, die in Gebieten mit hoher Kriminalitätsrate wohnen, Eliten, mobile Personen, nicht sesshafte bzw. obdachlose Personen.
Der Interviewer hebt nicht nur die Qualität von Interviews, sondern stellt in einigen Hinsichten auch ein Risiko für deren Qualität dar:
Aufgrund der persönlichen Situation im Interview können sich Befragte eingeschüchtert fühlen und deshalb ausweichend oder unehrlich antworten. Andere Formen der Befragung sind anonymer und ermöglichen den Befragten eine freiere Meinungsäußerung. Dies ist insbesondere bei heiklen Themen (abweichendes Verhalten, Sexualität usw.) problematisch, wenn der Befragte dazu neigt, dem Interviewer gegenüber eine als sozial erwünscht eingeschätzte Antwort zu geben, um einen guten Eindruck bei ihm zu hinterlassen.
Interviewer können die Fragen und Antwortvorgaben fehlerhaft vorlesen, Fehler bei der Filterführung begehen, die Angaben der Befragten falsch verstehen oder die geäußerten Antworten den Antwortvorgaben falsch zuordnen.
Interviewer können sich absichtlich falsch verhalten, um den Aufwand und die Kosten zu senken. Darunter fallen nicht regelgerechte Adressermittlungen gemäß der Begehungsvorschriften beim Random-Route-Verfahren bzw. Random-Walk-Verfahren, Unterschlagung einzelner Fragen bzw. Fälschung einzelner Antworten bis hin zur Fälschung gesamter Interviews. Bei Klassenzimmer-Befragung treffen diese Befürchtungen kaum zu, da ihr Aufwand erheblich geringer ist. Dagegen besteht bei Passanteninterviews durchaus die Gefahr der subjektiven Stichprobenziehung, weshalb diese nicht von den Interviewern selbst durchgeführt werden sollte (vgl. Fowler 1988: 70ff.).
| 2.2 | Das telefonische Interview |
| 2.2.1 | Beschreibung und Varianten |
Das telefonische Interview ist als fernmündliche Befragung weniger persönlich als das direkte face-to-face Interview, aber es basiert ebenfalls auf einer Beziehung zwischen einem Interviewer und einem Befragten.
[40]Voraussetzung ist, dass die Zielpersonen einen Telefonanschluss haben bzw. telefonisch erreichbar sind. Dies ist vor allem in Industrieländern westlicher Prägung der Fall. In den USA ist der Einsatz von Telefoninterviews schon seit längerer Zeit sehr populär, und er ist mit einer gewissen Verzögerung auch in Deutschland gestiegen. Durch die Wiedervereinigung erlitt diese Befragungsform zunächst einen Rückschlag, weil in der DDR die Telefondichte relativ gering und die technische Qualität der Telefonanschlüsse schlecht war. Diese Probleme waren jedoch nur vorübergehend, sodass Telefoninterviews mittlerweile sehr häufig verwendet werden. Sie bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie besonders für die angewandte Meinungsforschung attraktiv machen.
| 2.2.2 | Stichprobe |
Die Stichprobenziehung für eine Telefonbefragung ist ebenso anspruchsvoll wie die für eine persönliche Befragung. Es sind aber andere Anforderungen und Probleme zu beachten. Folgende Varianten werden für die Ziehung einer repräsentativen Stichprobe verwendet19:
Zufallsauswahl aus dem Telefonbuch oder von der CD: Das Telefonbuchverfahren ist zwar mittlerweile veraltet, wird aber gelegentlich noch angewendet, zumal wenn nicht die bundesweite Bevölkerung die Grundgesamtheit bildet. Die Stichprobenziehung erfolgt mehrstufig: Zuerst wird das Telefonbuch, dann die Seite, die Spalte und zuletzt der Zielhaushalt ausgewählt. Wird die Stichprobe über CD gezogen, kann sie einstufig erfolgen und der Zielhaushalt direkt ausgewählt werden. Das Verfahren hat den Vorteil, dass alle Nummern tatsächlich existieren. Außerdem fällt im Vergleich zum ADM-Stichproben-System der persönlichen Befragung die erste Stufe weg, also die Auswahl der geografischen Einheiten, der Sample Points. Von Nachteil ist, dass viele Haushalte nicht eingetragen sind, was zu systematischen Verzerrungen führt: Im Telefonbuch oder auf der CD nicht eingetragene Personen haben entweder kein Telefon, wohnen in Gemeinschaftsunterkünften oder haben Geheimnummern. Seit einigen Jahren nimmt ferner die Zahl der Personen mit mehreren Festnetzanschlüssen (etwa über ISDN) zu, die bei Zufallsauswahlen überrepräsentiert werden, wohingegen Personen, die nur noch einen Mobilfunkanschluss haben, unterrepräsentiert werden, weil sie selten in ein Verzeichnis eingetragen sind.
[41]Zufalls-Ziffern-Anwahl (Random-Digit-Dialing): Bei diesem Verfahren werden die Telefonnummern per Zufall vom Computer generiert. Damit können prinzipiell auch Geheimnummern in die Stichprobe gelangen. Allerdings sind zahlreiche vom Computer erzeugte Nummern überhaupt nicht registriert, sodass der Streuungsverlust relativ groß ist. Aus diesem Grund wird in der Regel die Zufalls-Addition-Anwahl (Random-Last-Digit-Dialing) angewendet. Dabei werden im ersten Schritt Nummern aus dem Telefonbuch ausgewählt und im zweiten Schritt die letzte oder die letzten beiden Ziffern zufällig ergänzt20 (vgl. Fuchs 1994: 154ff., 158ff.; Gabler / Häder 1997).Weder bei der Telefonbuch- oder Telefon-CD-Auswahl noch bei der Zufallsnummern-Auswahl werden direkt Zielpersonen ermittelt, sondern nur Telefonnummern. Dieses Problem stellt sich entsprechend dem Prinzip der Haushaltsauswahl bei Flächenstichproben (Random Route, Random Walk). Für die Auswahl der Zielpersonen gibt es mehrere Möglichkeiten: Wird derjenige befragt, der sich am Telefon meldet, ist die Stichprobe auf der Personenebene nicht mehr zufällig, weil zu bestimmten Tageszeiten bestimmte Personen innerhalb des Haushalts ans Telefon gehen. Alternativ könnte man zur Bestimmung der Zielperson nach dem Haushaltsmitglied fragen, bei dem die zeitliche Differenz zwischen dem letzten oder dem nächsten Geburtstag am geringsten ist. Das aufwändigste Verfahren ist ein Haushaltsscreening, bei dem alle Haushaltsmitglieder zunächst aufgelistet werden, sodass mit Hilfe einer Auswahltabelle die Zielperson ausgewählt werden kann (vgl. Fuchs 1994: 165ff.).
Personenstichproben aus Einwohnermelderegister: Bei dem Verfahren werden Personen ausgewählt, deren Telefonnummer unbekannt ist. Diese muss in einem gesonderten Schritt ermittelt werden, sodass das Verfahren aufwändiger als die anderen ist (vgl. Blasius / Reuband 1995: 66f.).
Oft werden Mastersamples von etwa vier bis acht Millionen Privatadressen generiert. Dazu werden alle Telefonbucheinträge nach Kreisen und Gemeindegrößeklassen geschichtet und pro Schicht systematisch ausgewählt. Damit kann ein Teil der Stichprobenbereinigung (etwa die Identifizierung von Firmeneinträgen oder falschen Nummern) bereits im Vorhinein erledigt werden, sodass auf das Mastersample schnell zugegriffen werden kann. Das Mastersample muss allerdings jährlich aktualisiert werden (vgl. Meier 1999: 95ff.).
| [42]2.2.3 | Vorteile des telefonischen Interviews |
Kosten und Aufwand von Telefoninterviews sind deutlich geringer als bei persönlichen Interviews. Der Interviewerstab muss nicht so groß sein, kann zentral eingesetzt werden und ist geografisch unabhängig. Außerdem bestehen bessere Möglichkeiten der Kontrolle und Supervision der Interviewer.
Aufgrund der zentralen Organisationsform kann die Forschungsleitung bei unerwarteten Problemen flexibel reagieren, und die Interviewer können wechselseitig voneinander lernen (vgl. Frey / Kunz / Lüschen 1990: 175f.).
Die Reichweite von Telefoninterviews ermöglicht Repräsentativerhebungen, bei denen auch spezielle Populationen erreichbar sind.
Die Datenerhebungsphase ist vergleichsweise kurz. Die Interviewer müssen die Zielpersonen nicht persönlich aufsuchen. Durch die Verbreitung mobiler Telefongeräte dürfte sich die Erreichbarkeit erhöhen.
Der Interviewer kann die Qualität der Befragungsergebnisse steigern. Viele Vorteile, die im Zusammenhang mit dem persönlich-mündlichen Interview aufgeführt wurden, treffen auch auf das Telefoninterview zu. Da die Gesprächsbeziehung anonymer ist – auch weil Dritte fast immer ausgeschlossen sind –, sinkt zudem die Wahrscheinlichkeit, dass die Befragten unaufrichtig antworten; außerdem ist das Gespräch konzentrierter. Insgesamt können die Interviewer im Telefoninterview weniger Fehler begehen als im persönlichen Interview, weil sie besser kontrollierbar sind und weil ihr Verhalten, auf die akustische Dimension reduziert, weniger exponiert ist (vgl. Fowler 1988: 70ff.; Fuchs 1994: 188f.).
| 2.2.4 | Nachteile des telefonischen Interviews |
Die Repräsentativität von Telefonstichproben ist von der Telefondichte abhängig. Personen, die keinen Telefonanschluss haben, werden in der Stichprobe nicht repräsentiert. Die Ausfälle, die aufgrund der automatischen Zufallsziehung (Random-Digit-Dialing oder Random-Last-Digit-Dialing) entstehen, sind nicht kontrollierbar, weil eine Nichtantwort entweder bedeuten kann, dass es die betreffende Telefonnummer nicht gibt oder dass die Person mit dem betreffenden Telefonanschluss nicht erreichbar ist.
Die Ausschöpfung von Telefonstichproben ist in der Regel niedriger als die persönlicher Umfragen und reicht in Deutschland kaum über 50 Prozent (vgl. Stögbauer 2000). Dieser Wert lässt sich auch kaum steigern durch die vorherige Zustellung des Fragebogens, sondern allenfalls mit aufwändigen Kombinationen mit den anderen Befragungsverfahren (vgl. Friedrichs 2000).
[43]Der Fragebogen muss relativ einfach gestaltet sein. Der Einsatz optischer Skalen, visueller Hilfsmittel (Bildblätter) und sonstiger Gegenstände ist nicht möglich (zum Beispiel auch keine Copytests). Die Bildung von Rangreihen kann nur begrenzt eingesetzt werden, da sie nur mit optischer Unterstützung gut funktioniert. Noelle-Neumann und Petersen (1996: 309ff.) nennen zahlreiche weitere Beispiele für nicht oder nur eingeschränkt einsetzbare Mittel, die bei mündlicher Befragung möglich sind.
Der Interviewer hat nur eingeschränkte Möglichkeiten, den Befragten zur Teilnahme zu motivieren oder eine persönliche Beziehung aufzubauen, aufgrund derer es möglich ist, auch sensible und heikle Fragen zu stellen. Insgesamt ist die Gesprächssituation am Telefon unverbindlicher als im persönlich-mündlichen Interview. Außerdem ist die Interviewdauer kürzer als beim persönlichen Interview, was damit einhergeht, dass die Antworten in der Regel oberflächlicher sind. Dies ist die Kehrseite der größeren Anonymität (vgl. Fowler 1988: 70ff.; Frey / Kunz / Lüschen 1990: 57).
| 2.3 | Die schriftliche Befragung |
| 2.3.1 | Beschreibung und Varianten |
Bei der schriftlichen Befragung wird kein Interviewer eingesetzt, und die Befragten füllen den verschickten oder verteilten Fragebogen selbst aus.
Die schriftliche Befragung gleicht zwar dem individuellen Briefverkehr (vgl. Richter 1970: 142), umfasst aber mehr Varianten der Verteilung als die postalische Verschickung von Fragebögen.
Bei der postalischen Befragung wird der Fragebogen als Brief verschickt. Dazu ist es erforderlich, dass dem Fragebogen ein Anschreiben mit adressiertem und frankiertem Rückumschlag beigelegt wird. Der Rücklauf kann mit Nachfassaktionen verbessert werden. Wenn die Befragung nicht anonym ist, können die Nicht-Antworter gezielt angeschrieben werden. Eine Variante ist die Postwurfsendung mit Rückantwortschein, bei der allerdings der Rücklauf nicht kontrollierbar ist.
In Ländern, in denen ein hoher Anteil der Bevölkerung mit Computern ausgestattet ist, oder bei Fragestellungen, für die spezielle Populationen mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Computerausstattung befragt werden sollen, ist es auch möglich, den Fragebogen per Diskette zu verschicken. Das Verfahren [44]»Disk by Mail« (DBM) findet im Unterschied zum elektronischen Versand mit dem herkömmlichen Postversand statt.
Bei der Beilagenbefragung werden die Fragebögen einer Zeitschrift beigelegt oder in sie eingeheftet. Dies sind zumeist entweder vierseitige Fragebögen in der Heftmitte oder zweiseitige heraustrennbare Fragebögen bzw. Fragekarten im Postkartenformat, die irgendwo im Heft platziert werden. Die Beilagenbefragung senkt die Kosten der postalischen Befragung, da keine Versendungskosten entstehen. Allerdings muss ein Rückumschlag mit dem Aufdruck »Gebühren zahlt Empfänger« eingeheftet oder punktuell aufgeklebt werden.
| 2.3.2 | Stichprobe |
Die Bildung repräsentativer Stichproben erfolgt bei schriftlichen Befragungen vom Prinzip her ähnlich wie bei persönlichen oder telefonischen Befragungen; sie hängt aber insbesondere von der gewählten Variante ab. Eine postalische Verschickung von Fragebögen erfordert die Kenntnis von Adressen. Diese können etwa von Einwohnermelderegistern oder aus Telefonbüchern bzw. von CD-ROMs mit Telefonverzeichnissen ermittelt werden. Je nach Fragestellung der Untersuchung liegen Adressen mitunter bereits vor, etwa wenn die Abonnenten einer Zeitung befragt werden sollen (vgl. Nötzel 1987a: 153). Für die Beilagenbefragung gilt dies ebenfalls. Hier kann eine einfache Zufallsauswahl aus dem Abonnentenstamm gezogen oder – wenn der Anteil des freien Verkaufs hoch ist – der Fragebogen jedem x-ten Exemplar beigelegt werden.
Eine besondere Variante ist die Einrichtung von Access-Panels. Das ist ein Pool von vorrekrutierten Haushalten, die sich zur Zusammenarbeit bereit erklärt haben und ad hoc für Befragungen und Tests zur Verfügung stellen. Diese Panels werden auf unterschiedliche Weisen rekrutiert: Entweder kauft sich das betreffende Institut die Adressen, oder der Interviewer fragt im Anschluss an mündliche oder telefonische Interviews den Befragten, ob er prinzipiell zur Panelteilnahme bereit sei. Als Schneeballaktion werden die Befragten auch um die Namen weiterer Personen gebeten, um diese dann für die Teilnahme am Access-Panel zu gewinnen. Bei der »Panelpflege« muss darauf geachtet werden, dass die Panelhaushalte weder zu oft noch zu selten (durchschnittlich sechsmal im Jahr) befragt werden. Wichtig ist auch ein abwechslungsreicher Themenmix. Ist ein solches Panel aufgebaut, erfolgt die Befragung schriftlich (vgl. Hoppe 2000: 147, 151, 159f.).
| 2.3.3 | Vorteile der schriftlichen Befragung |
Schriftliche Befragungen erfordern organisatorisch, zeitlich und finanziell deutlich weniger Aufwand als andere Formen der Befragung. Sie benötigen [45]keinen Interviewerstab, der Ablauf der Erhebung ist zeitlich gestrafft. Bei der Online-Befragung ist der Aufwand – zumindest für den Forscher – noch geringer, weil die wesentlichen Schritte des Forschungsprozesses, die Erstellung und Gestaltungsmöglichkeiten des Fragebogens, die Durchführung der Befragung, die Datenerfassung und die Datenanalyse automatisiert und protokolliert werden (vgl. Gadeib 1999: 108f.).
Es gibt kaum Probleme bei der Erreichbarkeit der Zielpersonen: Die postalische Befragung kann geografisch sehr weit streuen, und die Fragebögen können zeitlich fast simultan zugestellt werden. Das Verhältnis zwischen der Stichprobengröße (Anzahl der zu befragenden Personen) und dem Zeitraum und der geografischen Verbreitung der Stichprobe ist günstig. Außerdem sind Zielpersonen, die zu bestimmten Tageszeiten nicht interviewt werden können, weil sie zum Beispiel berufstätig sind, besser erreichbar.
Externe Effekte durch sichtbare Merkmale, Erwartungen und Verhaltensweisen von Interviewern treten nicht auf. Das bei mündlichen und telefonischen Interviews gelegentlich auftretende Problem der sozial erwünschten Beantwortung der Fragen wird auf diese Weise entschärft, obgleich es auch hier nicht ganz zu vermeiden ist (etwa bei heiklen Fragen nach Normverletzungen, vgl. Nötzel 1987a: 152). Da es keinen persönlichen Kontakt zwischen Forscher bzw. Interviewer und Befragtem gibt, ist die Anonymität der Befragung für den Befragten offensichtlicher gewahrt.
Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Beantwortung. Der Befragte kann sich in einem gewissen Rahmen den genauen Zeitpunkt selbst aussuchen, kann ferner seine Antworten überdenken, sich benötigte Informationen beschaffen und den Kontext der Fragen bzw. die Logik des Fragebogens erkennen. Die schriftliche Befragung ist also insbesondere geeignet, wenn es um Themen geht, bei denen der Befragte über die Antworten nachdenken muss. Sie nimmt damit die Selbstbestimmtheit des Befragten ernst.
Der Fragebogen kann visuelle Unterstützungen und lange Batterien mit ähnlichen Fragen enthalten, da diese nicht von einem Interviewer vorgelesen werden müssen. Der Befragte hat dann viel stärker die Möglichkeit, das Tempo seines Antwortprozesses selbst zu bestimmen (vgl. Bourque / Fielder 1995: 9ff.).
| 2.3.4 | Nachteile der schriftlichen Befragung |
Die Grundgesamtheit muss bekannt sein, damit aus ihr konkrete Adressenstichproben gezogen werden können. Gerade bei postalischen Befragungen ist nicht jede Grundgesamtheit definierbar, etwa die Leser einer Zeitschrift, [46]da nur aus der Abonnentenkartei Stichproben gezogen werden können. Dieser Nachteil tritt dagegen bei einer Beilagenbefragung weniger auf, weil damit alle Leser der betreffenden Zeitschrift erreichbar sind. Andere in der Umfragepraxis übliche Verfahren der Zufallsstichprobe wie das Random-Route-Verfahren sind nicht einsetzbar.
Bei postalischen Befragungen schwankt die Ausschöpfungs- bzw. Rücklaufquote erheblich und ist in der Regel deutlich geringer als bei den auf Interviews basierenden Befragungsformen. Dabei bleiben die Ausfallursachen weitgehend unbekannt. Die Zielpersonen vergessen oft einfach, den Fragebogen auszufüllen. Außerdem ist es durch die fehlende Interviewsituation leichter, die Beantwortung insgesamt oder einzelner Fragen zu verweigern. Die Motivationsleistung durch den Interviewer fallen aus. Dies gilt verschärft für die Beilagenbefragung, bei der selten Rücklaufquoten mit mehr als zwanzig Prozent realisierbar sind, weil Nachfassaktionen mit diesem Verfahren nicht durchführbar sind. Sie ist deshalb überhaupt nur dann einsetzbar, wenn die Grundgesamtheit sehr homogen ist, wie im Fall der Leserschaft einer Zeitschrift.
Verzerrungseffekte treten vor allem dadurch auf, dass durch die postalische Zustellung der Eindruck einer behördlichen Zustellung erweckt wird. Diese Kommunikationsform wirkt einerseits verbindlicher, weckt andererseits aber auch eher die Angst, kontrolliert zu werden, als dies beim konversationsähnlichen Interview der Fall ist. Weiterhin dürfte der Mittelschichtbias bei der schriftlichen Befragung noch stärker sein, als er für andere Befragungsformen bereits festgestellt wurde, weil die Beantwortung eines Fragebogens vergleichsweise hohe Lese- und Schreibfähigkeiten voraussetzt. Insbesondere offene Fragen sind davon betroffen und eignen sich für schriftliche Befragungen deshalb weniger. Die Selbstselektion der Befragten vermindert die Stichprobe damit nicht nur quantitativ, sondern auch in qualitativer Hinsicht.
Der Anwendungsbereich erstreckt sich aufgrund der schriftlichen Fixierung der Meinungen hauptsächlich auf im weiteren Sinn kognitive Sachverhalte. Spontane, unreflektierte und irrationale Äußerungen dürften eher die Ausnahme sein und eignen sich weniger als Untersuchungsziel einer schriftlichen Befragung. Auf der anderen Seite sind jedoch Abfragen über individuelles Wissen ebenfalls kaum möglich, da der Befragte auf fremdes Wissen zurückgreifen kann (vgl. Richter 1970: 142ff.; Bourque / Fielder 1995: 14ff.).
Die Befragungssituation ist nicht kontrollierbar. Weder ist hinreichend zu garantieren, dass die angeschriebene Zielperson den Fragebogen selbst oder allein ausfüllt noch dass sie ihn gemäß den Instruktionen bearbeitet und die Reihenfolge der Fragen einhält. Für spontane Antworten ist die schriftliche [47]Befragung aufgrund der mangelnden Kontrollierbarkeit ungeeignet. Schließlich sind keine Stichtagserhebungen möglich (vgl. Hafermalz 1976: 23).
Da kein Interviewer eventuelle Nachfragen zur Verständlichkeit beantworten kann, hängt die korrekte Beantwortung allein vom Fragebogen ab. Er muss inhaltlich vollständig selbst erklärend und visuell klar gestaltet sein (vgl. Mangione 1995: 6, 27ff.). Außerdem fällt mit der Abwesenheit des Interviewers eine Quelle für die Einschätzung der Qualität der Antworten weg.
| 2.3.5 | Spezielle Empfehlungen für schriftliche Befragungen |
Sowohl die aufgeführten Vorteile als auch die Nachteile sind nicht absolut, sondern relativ zu verstehen und hängen weitgehend vom Untersuchungszweck, von der Definition der Grundgesamtheit und von der Untersuchungsanlage ab. Die Vorteile der relativ niedrigen Kosten und des geringen Aufwandes können verloren gehen, wenn die Rücklaufquote so gering ist, dass umfangreiche Nachfassaktionen erforderlich sind. Umgekehrt können die Probleme der postalischen Befragungen gemindert werden. Deshalb werden in den Lehrbüchern zahlreiche Empfehlungen zur Gestaltung des Fragebogens gegeben (vgl. Hafermalz 1976: 28ff., 63ff., 192ff.). Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die Erhöhung der Ausschöpfungsrate, um die Repräsentativität der Stichproben zu gewährleisten.
Das Anschreiben (der Begleitbrief) muss kurz, inhaltlich prägnant, klar gestaltet sowie inhaltlich und visuell motivierend sein. Es sollte persönlich gehalten sein und ein Datum des Einsendeschlusses angeben (vgl. Hafermalz 1976: 111; Koch 1993: 79; Bourque / Fielder 1995: 106ff.). Zusätzlich kann eine gesonderte Benachrichtigung der eigentlichen Fragebogenaktion vorgeschaltet werden. Da die Gefahr besteht, dass der Begleitbrief eine bestimmte selektive Wirkung ausübt, die sich negativ auf die Repräsentanz auswirkt, muss er so formuliert und gestaltet sein, dass er auf alle Subgruppen der Stichprobe passt (vgl. Richter 1970: 149f.).
Für das Rückschreiben muss ein adressierter und frankierter Rückumschlag beiliegen.
Der Fragebogen muss klar anonym sein und darf keine versteckten Zeichen zur Identifizierung des Befragten enthalten.
Zur Erhöhung des Rücklaufs dienen auch Erinnerungsschreiben, die mehrfach wiederholt werden können. Bei anonymen Befragungen werden dadurch Kosten und Aufwand deutlich erhöht, sodass vor dem Einsatz eine Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen sollte (vgl. Mangione 1995: 63ff.).
[48]Um die Kooperationsbereitschaft zu erhöhen, werden oft Geschenke (»incentives«) – Kugelschreiber, Briefmarken oder Telefonkarten – mitgeschickt, entweder bereits im Voraus oder erst nach erfolgter Rücksendung. Letzteres funktioniert allerdings nur, wenn die Befragung nicht anonym erfolgt. Ob die Belohnung in Geld ausgezahlt oder ein Geschenk zugeschickt werden soll, ist ebenso umstritten wie die Höhe oder der Wert des Geschenks. Eine Variante besteht in der Teilnahme der Rücksender an einer Lotterie oder einem Preisausschreiben (vgl. Mangione 1995: 79ff.).21
Eine systematische Vorgehensweise zur Optimierung schriftlicher Befragungen entwickelte Dillman (1978) mit der »Total Design Method«, die er zur »Tailored Design Method« ausbaute (vgl. Dillman 2000). Sie umfasst konkrete Vorschriften zum Design des Fragebogens und zur Durchführung der Befragung. Der Fragebogen soll als Booklet gestaltet werden, wobei Vorderseite und Rückseite frei bleiben. Äußerliche Ähnlichkeiten zu Werbebroschüren sind zu vermeiden. Im Fragebogen werden nach der Einstiegsfrage zuerst die interessanten Fragen platziert, während problematische und demografische Fragen nach hinten gestellt werden (vgl. Dillman 1978: 362).Besonders wichtig ist der Versand, der zur Wochenmitte stattfindet. Eine Woche nach dem Erstversand wird eine Postkarte oder ein Brief verschickt, um den Teilnehmern zu danken und die Nicht-Teilnehmer freundlich zu erinnern und zur Teilnahme zu motivieren. Drei Wochen nach dem Erstversand wird der Fragebogen erneut verschickt zusammen mit einem weiteren, kürzeren Mahnschreiben. Eine letzte freundliche, aber bestimmte Mahnung erfolgt sieben Wochen nach dem Erstversand per Einschreiben (vgl. Dillman 1978: 366.; Bourque / Fielder 1995: 149ff.). Auf diese Weise kann der Rücklauf enorm erhöht werden, eine Erfahrung, die sich interkulturell übertragen und bei verschiedenen Populationen anwenden lässt (vgl. Hippler 1988: 247f.).
Generell darf die Feldzeit nicht zu stark mit der Urlaubszeit (auch Feiertage) überlappen (vgl. Nötzel 1987a: 154).
Der Rücklauf sollte kontrolliert und detailliert analysiert werden, um Subgruppen zu identifizieren, deren Rücklauf unterdurchschnittlich groß ist, und um Rücklaufcharakteristiken zu ermitteln (vgl. Richter 1970: 225ff.; Nötzel 1987a: 155; Blasius / Reuband 1996).
| [49]2.4 | Computerunterstützte Befragungsverfahren |
| 2.4.1 | Beschreibung und Varianten |
Ergänzend zu den herkömmlichen Verfahren der Befragung gibt es für jedes Verfahren eine computerunterstützte Variante, um deren Planung, Durchführung und Verwaltung effizienter und kostengünstiger zu machen.
Folgende Varianten sind derzeit hauptsächlich im Einsatz (vgl. Frey / Kunz / Lüschen 1990: 179ff.; Saris 1991: 30; Fuchs 1999: 120; Knobloch / Knobloch 1999: 63):
Persönliches Interview: Die konventionelle Vorgehensweise beim persönlichen Interview wird »Paper-and-Pencil Personal Interviewing« (PAPI) genannt, weil der Interviewer die Fragen von einem Fragebogen aus zusammengehefteten oder gefalteten Papierblättern abliest und mit einem Schreibstift die Antworten in den Fragebogen einträgt. Im Fragebogen stehen neben den Fragen und – bei standardisierten Varianten – den Antwortvorgaben auch Anweisungen an den Interviewer, in welcher Reihenfolge er die Fragen stellen muss, wie er vorgehen muss bei bestimmten Antworten usw. (→ Kapitel 5). Beim computerunterstützten Interview, »Computer Assisted Personal Interviewing« (CAPI), führt der Interviewer entweder einen Laptop mit, liest die Fragen (und Antwortvorgaben) vom Bildschirm vor und tippt die Antworten bzw. die zu den Antwortkategorien passenden Zahlen in den Computer ein, oder er benutzt ein Pentop, bei dem der Befragte selbst mit einem Stift die Antworten in die entsprechenden Felder antippt.
Selbstausfüller-Befragung: Bei diesem Hybridverfahren zwischen persönlicher und schriftlicher Befragung verteilt ein Interviewer entweder den Fragebogen einer bestimmten Gruppe von Befragten an einem Ort (Klassenzimmer-Befragung) und bleibt in dem Zeitraum, in dem die Befragten den Fragebogen ausfüllen, anwesend, oder er hinterlässt dem Befragten den Fragebogen und sammelt den ausgefüllten Fragebogen zu einem vereinbarten Termin wieder ein. Beide Varianten des »Self Administered Questionnaire« (SAQ) sind auch computerunterstützt möglich: Der Interviewer überlässt dem Befragten einen mitgebrachten Computer, damit er selbstständig den Fragebogen am Bildschirm durcharbeitet. Diese Vorgehensweise wird »Computer Assisted Self-Interview« (CASI) oder »Computer Assisted Self-Administered Questionnaire« (CSAQ) genannt. Hier übernimmt der Befragte neben der Bearbeitung des Fragebogens auch noch – nebenbei – die Dateneingabe. Die Dateneingabe mit der Tastatur kann durch den Touchscreen ersetzt werden.[50]Neuere Varianten mit Spracherkennungsprogrammen, »Audio Computer Assisted Self-Administration« (ACASI), erlauben es, dass der Befragte nur noch die Fragen vom Bildschirm ablesen, aber die Antworten nicht mehr eintippen muss, sondern mündlich in den Computer sprechen kann. Es gibt auch die umgekehrte Variante der »Audio Computer Assisted Self-Administration« (Audio SAQ), bei der der Befragte die Fragen vom Walkman oder Diktiergerät abhört und die Antworten in den Computer eintippt.
Telefoninterview: Während die bisher genannten Techniken noch nicht flächendeckend verbreitet sind, ist das computerunterstützte Telefoninterview, »Computer Assisted Telephone Interviewing« (CATI), weitgehend etabliert; ein CATI-Studio gehört für die meisten Markt- und Sozialforschungsinstitute zum Inventar. Die zentrale Organisation des Interviewerstabs bei telefonischen Befragungen begünstigt die computerunterstützte Variante, weil hierfür keine portablen Computer notwendig sind. Die CATI-Technik erlaubt nicht nur die Unterstützung und Kontrolle der Durchführung, sondern integriert die Stichprobenziehung durch rechnergesteuerte Erzeugung von Zufallszahlen.
Auch über das Telefon sind weitere technische Varianten möglich: Beim »Touchtone Data Entry« (TDE) gibt der Befragte Ziffern über das Telefon ein, die für bestimmte Antwortmöglichkeiten stehen; beim »Voice Recognition Entry« (VRE) spricht der Befragte ins Telefon, und die Antworten werden über Spracherkennung automatisch digitalisiert.
| 2.4.2 | Vorteile der computerunterstützten Befragung |
Den größten Anteil an der Entwicklung hat die CATI-Technik. Die Vorzüge beziehen sich aber prinzipiell auch auf die Techniken der anderen Verfahren (vgl. Frey / Kunz / Lüschen 1990; Saris 1991: 20ff.; Müller-Schroth 1995; Fuchs 1999: 120f.; Knobloch / Knobloch 1999: 67ff.):
Die Computerunterstützung entlastet den Interviewer bei der Handhabung des Fragebogens. So können komplexe Filterführungen oder Gabelungen im Fragebogen automatisch verwaltet werden. Weiterhin können Konsistenzprüfungen programmiert werden, sodass der Interviewer nachfragen kann, wenn der Befragte widersprüchliche Angaben macht. Auf diese Weise widmet der Interviewer seine Aufmerksamkeit stärker der Interviewführung selbst.
Wenn längere Listen mit Antwortvorgaben oder Statements verwendet werden, können diese zufällig rotiert und somit Reihenfolge- oder Präsentationseffekte verhindert werden. Im persönlichen Interview ersetzt diese Möglichkeit die etwas umständliche Verwendung von Karten, die der Interviewer vor jedem Interview neu mischen muss.
[51]Die Schritte der Dateneingabe und der Datenübermittlung werden abgekürzt. Die Fragebogeneinträge müssen nicht mehr gesondert elektronisch erfasst werden, weil das Ausfüllen des Fragebogens und die Dateneingabe identisch sind. Dadurch entfällt ein fehleranfälliger Schritt, und die Daten können schneller ausgewertet werden. Durch die automatische Konsistenzüberprüfung verkürzt sich auch der Prozess der (inhaltlichen) Datenüberprüfung und der Datenbereinigung, die zum Teil schon während des Interviews erfolgen.
Mit der computerunterstützten Datenerfassung ist als Nebenprodukt auch die Aufzeichnung weiterer Daten verbunden: So wird die Zeit, die für die Beantwortung einer Frage benötigt wird, automatisch protokolliert. Darüber hinaus kann das Interviewerverhalten dem Computer gegenüber mit »Keystroke-Files«, also mit Protokolldateien aller Tastenbetätigungen des Interviewers, inklusive der Reihenfolge und Kennung der dazugehörigen Frage, analysiert werden. Indirekt lässt sich mit dieser Technik auch die Handhabbarkeit der eingesetzten Computerprogramme evaluieren.
Speziell mit der CAPI-Technik sind zwei weitere Vorteile verbunden:
Zum einen wird die Hoffnung geäußert, dass der Einfluss des Interviewers auf den Befragten geringer wird, weil mit dem Computer der Interaktion zwischen Interviewer und Befragtem ein Medium zwischengeschaltet ist. Die Interviewsituation ist neutraler und insofern weniger anfällig für Eindrucksmanipulationen seitens des Befragten oder für unwillkürliche Einflussnahmen durch den Interviewer.
Es gibt mehr optisch-visuelle Möglichkeiten am Bildschirm als mit dem herkömmlichen Fragebogen. Bei Mediennutzungsabfragen können etwa aktuelle Titelblätter statt nur Titelkarten präsentiert werden und somit die Erinnerung der Befragten besser unterstützen. Außerdem können Bewegtbilder vorgeführt werden. Insgesamt finden die meisten Befragten die Interviewsituation mit dem Einsatz von Multimedia als attraktiver und abwechslungsreicher als das herkömmliche persönliche Interview.
Im Unterschied zu anderen Techniken verwaltet die CATI-Technik zusätzlich die Stichprobe. Auf diese Weise können nicht nur automatisch Telefonnummern generiert werden (für das Random-Digit-Dialing), sondern auch die (Wieder-)Wählversuche gesteuert werden.
Insgesamt wird die Feldphase der Befragung kürzer, es fallen geringere Kosten an, die Datenqualität steigt und die Möglichkeit der Qualitätskontrolle verbessert sich (vgl. Dethlefsen 2000).
| [52]2.4.3 | Nachteile der computerunterstützten Befragung |
Da die Verfahren computerunterstützter Befragung bisher nur beim Telefoninterview etabliert sind, kann man kaum prinzipielle Nachteile ausmachen. Vielmehr gibt es derzeitig Probleme und Herausforderungen, die durch die technische Entwicklung zu lösen sind. Insofern betreffen die folgenden Problempunkte nur am Rand das computerunterstützte Telefoninterview (CATI), sondern eher die noch nicht flächendeckend eingesetzten anderen Verfahren (CAPI und CASI) (vgl. Frey / Kunz / Lüschen 1990: 182f.; Fuchs 1999: 120; Knobloch / Knobloch 1999: 70f.).
Für persönliche Interviews erweist sich der technische Apparat insbesondere dann als ungünstig, wenn die Interviews auch als Haustürgespräche möglich wären, denn der Interviewer ist mit der Geräteausstattung darauf angewiesen, dass er in die Wohnung gebeten wird.
Befragte mit geringer Computererfahrung empfinden den Einsatz eines Computers möglicherweise als bedrohlich und neigen deshalb eher zur Verweigerung des Interviews.
Auch in der Interviewsituation selbst können die auf die technische Durchführung konzentrierte Aufmerksamkeit und die reduzierten Interaktionen des Interviewers vom Befragten als störend empfunden werden. Die Situation im computerunterstützten persönlichen Interview ist künstlicher als im konventionellen persönlichen Interview.
Im Telefoninterview fallen diese Nachteile weg, da der Befragte die Computerunterstützung des Interviews nicht bemerkt. Die nachfolgenden Nachteile beziehen sich allerdings eingeschränkt auf die CATI-Technik:
Die Handhabung der Technik erfordert von den Interviewern Zusatzkompetenzen und macht eine gesonderte technische Schulung nötig.
Die Vorbereitung auf und Vorarbeit für die Befragung muss intensiver sein als bei konventionellen Verfahren, weil alle Probleme bezüglich der Beantwortung der Fragen, der Konsistenzprüfung antizipiert werden müssen. Für die Erstellung des Fragebogens sind Programmierkenntnisse notwendig.
In der konkreten Interaktion des Interviews ist eine computerunterstützte Befragung weniger flexibel, weil der Interviewer auf die logischen Vorgaben der Fragebogenkonstruktion angewiesen ist. Nicht vorhergesehene Antwortkombinationen, die trotzdem korrekt sind, müssen extra vermerkt werden. Korrekturen oder Anmerkungen sind auf Papier leichter durchzuführen.
Die Handhabung der Technik erfordert zudem vom Interviewer eine sehr hohe Aufmerksamkeit, die zu Lasten der Interaktion mit dem Befragten geht. [53]Auf diese Weise dauern zumindest die computerunterstützten persönlichen Interviews etwas länger als die herkömmlichen persönlichen Interviews.
Wie bei allen Computeranwendungen besteht prinzipiell die Gefahr des Systemabsturzes mit weitreichenden Folgen in Form von Datenverlust. Dies gilt insbesondere, wenn die Computer vernetzt sind wie in einem CATI-Studio.
Während sich die Einrichtung eines mit CATI ausgestatteten Telefonstudios als mittel- und langfristig sinnvolle Investition erweist, ist die Anschaffung von Laptops für CAPI nach wie vor sehr teuer. Noch kostenintensiver ist die Ausstattung eines Befragtenpanels mit Hardware und Software, wenn die Befragten im Gegenzug bereit sind, regelmäßig an Umfragen teilzunehmen.
Die genannten gelegentlichen nachteiligen Auswirkungen schränken die Verwendung der Computerunterstützung etwas ein: Technische Verfahren eignen sich offenbar eher als Unterstützung für den Interviewer und weniger für die eigenständige Nutzung durch die Befragten. Außerdem lassen sie sich am besten bei (hoch) standardisierten Befragungen und Fragebögen einsetzen (vgl. Knobloch / Knobloch 1999: 75).
| 2.5 | Die Online-Befragung |
| 2.5.1 | Beschreibung und Varianten |
Online-Befragungen sind streng genommen computerunterstützte schriftliche Befragungen. Allerdings sind sie netzbasiert und finden im WWW statt. Die Fragebögen sind mit HTML oder anderen Techniken (wie Javascript oder Flash) programmiert; sie können interaktive und multimediale Elemente enthalten.
Das Internet ist als Technik und Organisationsform gleichzeitig Methode bzw. Instrument (Fragebogen), Kommunikationskanal (Vertrieb) und Forschungsgegenstand (Nutzung, Rezeption, Produktion von Internetinhalten). Online-Befragungen sind dann besonders sinnvoll, wenn alle drei Komponenten zusammenkommen, wenn also das Internet und seine Nutzer auch der Forschungsgegenstand selbst sind (vgl. Jackob / Schoen / Zerback 2009; Jackob et al. 2010). Demnach ist auch die Definition der Grundgesamtheit in der Regel auf die Internetnutzer bezogen, etwa alle Personen in deutschsprachigen Haushalten, die in den letzten drei Monaten mindestens einmal das Internet genutzt haben (vgl. Welker / Werner / Scholz 2005: 5, 34f.; → utb-shop.de, Kapitel 1.3).
[54]Bei der netzbasierten oder Online-Befragung werden die Fragebögen im Internet verschickt. Diese Art der Befragung kann prinzipiell per E-Mail, per Newsgroup, Mailingliste oder Newsletter sowie im WWW stattfinden. Der erste Weg ist allerdings nur in geringem Maß erfolgreich, da viele Nutzer unerwünschte kommerzielle E-Mails abblocken. Zudem fallen die Telefonkosten zum Herunterladen beim Nutzer an. Auch die Variante per Newsgroup, Mailingliste oder Newsletter birgt weitere Probleme, denn der Empfänger bleibt unbekannt. Außerdem ist die Akzeptanz oft gering, weil viele Gruppen Netiquette-Regeln aufgestellt haben, die eine Weitergabe von externen Anfragen als unerwünscht betrachten. Vom Prinzip her gleicht diese Variante eher den TED-Umfragen im Fernsehen und hat deshalb nur begrenzten wissenschaftlichen Wert.In der Regel finden Online-Befragungen deshalb im WWW statt (vgl. Hauptmanns 1999: 22ff.; Starsetzki 2007: 78f.). Dabei wird der mit einer Befragungssoftware erstellte Fragebogen auf einem Webserver hinterlegt. Der Befragte ruft die betreffende Internetadresse auf und füllt den Fragebogen per Computer aus. Die eingegebenen Antworten werden auf dem Webserver gespeichert und verwaltet und können dann mit der Befragungssoftware oder einer anderen Statistiksoftware ausgewertet werden.
Online-Interview: Obwohl die Online-Befragung hauptsächlich noch als textbasierte (schriftliche) Kommunikationsform durchgeführt wird, verschwimmen die Grenzen zukünftig, wenn sie audiovisuell gestützt wird. Dazu werden die Befragten mit Webcams und Headsets ausgestattet, sodass sie mit dem Interviewer eine Art Desktop-Konferenz durchführen können (vgl. Mühlenfeld 2002; zur technischen Ausrüstung und zur notwendigen Software vgl. Mühlenfeld 2004: 63ff.).Da die Interviewsituation keine direkte Interaktion mit räumlicher Nähe ist, stellt sie ein Hybridverfahren zwischen persönlichem Interview und Online-Befragung dar. Durch diese Variante der audiovisuell gestützten, webbasierten Telekommunikation können aber im Unterschied zu rein schriftlichen Versionen der Online-Befragung die nonverbale Kommunikation der Befragten zusätzlich berücksichtigt werden, sodass weitere Kontextinformationen zum Antwortprozess zur Verfügung stehen und etwaige Uneindeutigkeiten besser interpretierbar sind (vgl. Mühlenfeld 2004: 3ff.).
| 2.5.2 | Stichprobe |
Bei Online-Befragungen ist die Onlineziehung einer kontrollierten (oder gar bevölkerungsrepräsentativen) Stichprobe derzeit kaum möglich, weil die Teilnahme [55]weitgehend von der Selbstselektion der Befragten abhängt. Die im Jahr 2000 gemeinsam vom ADM, ASI und BVM herausgegebenen und 2007 aktualisierten »Richtlinien für Online-Befragungen« bleiben bei der Lösung dieses Problems sehr allgemein, formulieren aber einige ethische Regeln (vgl. auch www.adm-ev.de; noch skeptischer: Schnell 2012: 291ff.).
Für die Ziehung von Online-Stichproben bestehen mehrere Möglichkeiten (vgl. Welker / Werner / Scholz 2005: 39ff.; Starsetzki 2007: 78ff.):
Der Fragebogen wird mit einem Link einer bestimmten Website beigefügt, und die Nutzer dieser Website werden aufgefordert, den Fragebogen auszufüllen. Dies kann mit einem Banner erfolgen, der auf den Fragebogen aufmerksam macht und den die Zielperson anklicken muss, um zu dem Fragebogen zu gelangen. Hier ist allerdings die Selbstselektion der Befragten hoch, sodass motivierte Personen deutlich überrepräsentiert sind.
Alternativ kann ein Intercept-Auswahlverfahren gewählt werden, bei dem der Vorgang der Onlinenutzung durch ein Pop-up mit der Aufforderung zur Teilnahme an einer Studie unterbrochen wird. Um die Selbstselektion der Befragten zu mindern, kann diese Aufforderung zufallsgesteuert eingesetzt werden, sodass nur jede x-te Nutzung (»n’th visit«) durch das Pop-up unterbrochen wird. Solche Pop-ups sollten am besten am Anfang oder am Ende der Nutzung der betreffenden Website platziert werden und mindestens ein Viertel der Bildschirmseite ausfüllen.Die Zielpersonen können allerdings diese Pop-ups durch bestimmte Einstellungen ihres Browsers blockieren, sodass der Rücklauf unkontrollierbar geringer wird. Mit Hilfe einer HTML-Layer-Technologie kann dagegen wiederum ein grafisches Element über die Webseite gelegt werden, sodass die Blockierung wiederum umgangen wird.
Die genannten Auswahlverfahren stellen eine passive Rekrutierung dar, bei der die Befragten nach deren Gutdünken und Motivation ausgewählt werden. Einige Pseudozufallsverfahren ermöglichen eine seitens des Forschers aktivere Rekrutierung (vgl. Bandilla / Bosnjak / Altdorfer 2001: 9f., 15f.; Welker / Werner / Scholz 2005: 51ff.; Starsetzki 2007: 83f.):
Aus verfügbaren Online-Verzeichnissen können Links von Webseiten oder E-Mail-Adressen von Nutzern gezogen werden. Wie diese Online-Verzeichnisse allerdings angelegt wurden, entzieht sich meist der Kenntnis des Forschers, sodass der erste Auswahlschritt dadurch unkontrollierbar ist.
Mit Hilfe von Suchmaschinen können Listen nach bestimmten Suchbegriffen erstellt werden, aus denen wiederum Einträge per Zufall ausgewählt werden. Allerdings basieren diese Listen auf nicht nachvollziehbaren Sammelkriterien [56]oder Suchalgorithmen, sodass der Zufallsauswahl im zweiten Schritt eine willkürliche Auswahl im ersten Schritt vorgeschaltet ist.
Auch für Online-Befragungen wurden bereits Access-Panels eingerichtet, bisher vor allem in den USA. Die per Zufallsstichprobe ausgewählten Personen bekommen kostenlos die nötige Hardware und Software zur Verfügung gestellt, müssen sich aber als Gegenleistung an Kurzbefragungen beteiligen. Dieser Ansatz verursacht allerdings sehr hohe Kosten, und die Repräsentativität der Stichprobe ist nicht gewährleistet oder muss an bekannte Strukturdaten, die offline ermittelt wurden (etwa mit dem ADM-Stichprobensystem → Kapitel 2.1.2), angeglichen werden. Mittlerweile gibt es Qualitätsstandards, die sogar als DIN/ISO-Norm überprüfbar sind (vgl. Smahlun 2007: 151f.).Eine besondere Variante ist das vom Berliner Markt- und Sozialforschungsinstitut Forsa entwickelte forsa.omninet, das noch nicht einmal am Computer durchgeführt wird, sondern per Telefon und Fernsehen, die durch eine Übertragungsbox (»Set-Top-Box«) miteinander verbunden werden, sodass über das Telefon eine Online-Schaltung ermöglicht wird. Die offline (mittels Telefoninterviews) rekrutierten Panel-Teilnehmer bekommen auf ihrem Fernsehgerät eine Nachricht mit der Bitte einen Fragebogen auszufüllen. Die Menüführung verläuft ähnlich wie beim Videotext (vgl. Güllner / Schmitt 2004: 17, 19). forsa.omninet umfasst etwa 10.000 bundesweit repräsentative Haushalte mit 20.000 Personen (vgl. www.forsa.de/).
Sieht man von den Online-Access-Panels ab, besteht das Hauptproblem von Online-Befragungen darin, dass Nutzer und Nutzung nicht kongruent sein müssen, da IP-Adressen nicht fest, sondern dynamisch durch den jeweiligen Provider zugewiesen werden. So können sich hinter einer IP-Adresse auch mehrere Nutzer verbergen, die gemeinsam auf einen Computer zugreifen (vgl. Welker / Werner / Scholz 2005: 34). Der Forscher hat mehrere Möglichkeiten, den Nutzer (als Person) zu identifizieren (vgl. Funke / Reips 2007: 54f.):
Man kann Cookies beim zu befragenden Nutzer hinterlassen und so die betreffende Website, auf der der Fragebogen platziert ist personalisieren. Allerdings sind Cookies leicht zu deaktivieren oder zu löschen, sodass insbesondere versierte Computernutzer die Identifikation verhindern können.
Eine andere Möglichkeit sind Session-IDs, also eindeutige Identifikationsvariablen für eine Sitzung. Mit beiden Maßnahmen kann nicht verhindert werden, dass der Fragebogen mehrfach beantwortet wird, was bei wissenschaftlichen Befragungen allerdings selten vorkommen dürfte.
Die beste Vorgehensweise ist die Vergabe eines individuellen Login-Codes, weil sie den Nutzer und das Ausfüllen des Fragebogens identifiziert.
| [57]2.5.3 | Vorteile der Online-Befragung |
Die Online-Befragung bietet aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten mehrere Vorteile in Bezug auf das Instrument (Fragebogen) und die Durchführung (Erhebung und Aufbereitung der Daten):
Bei Online-Befragungen besteht zusätzlich die Möglichkeit multimedialer Präsentation, indem Audio- und Videosequenzen mit Text verknüpft werden können. Dies kann zwar prinzipiell auch in anderen computergestützten Befragungsformen realisiert werden, ist aber online am besten einsetzbar.Außerdem besteht zusätzlich die Möglichkeit des Feedback für den Befragten, der parallel zur Erhebung bereits die bis dahin vorliegenden Zwischenergebnisse einsehen kann. Solche erweiterten technischen Möglichkeiten machen die Teilnahme an der Befragung interessanter (vgl. Pötschke / Simonson 2001: 12f.).
Während bei konventionellen schriftlichen Befragungen die Befragungssituation nicht kontrollierbar ist, kann dieser Nachteil bei Online-Befragungen etwas kompensiert werden, indem die automatisch anfallenden Server-Log-Protokolle, ausgewertet werden. Sie geben Hinweise auf den Prozess, wie die Frage bearbeitet wurde. Die übliche Typologie in Personen, die a) alle Fragen beantworten, b) einzelne Fragen nicht beantworten und c) den ganzen Fragebogen nicht ausfüllen, kann auf diese Weise differenziert und ergänzt werden, indem auch Personentypen berücksichtigt werden, die sich zwar den Fragebogen anschauen, ihn oder einzelne Fragen aber nicht ausfüllen (»Lurker«). Außerdem kann das Antwortverhalten von Abbrechern (»Dropouts)«, die zwar einen Teil des Fragebogens ausfüllen, aber ab einer bestimmten Frage aussteigen, detailliert erfasst werden (vgl. Bosnjak / Tuten / Bandilla 2001: 10ff.; Funke / Reips 2007: 62f.). Solche nicht-reaktiven »Paradaten« machen den Befragungsprozess transparenter und können für die Verbesserung der Qualität von Befragungen genutzt werden (vgl. Kaczmirek / Neubarth 2007: 294ff.).Durch automatische Plausibilitätschecks, die bei der Fragebogenprogrammierung eingebaut werden können, sind Fehlerkontrollen möglich. Die Filterführung ist ebenfalls automatisiert, sodass – ähnlich wie beim computerunterstützten Telefoninterview – keine Interviewerfehler mehr vorkommen können. Weiterhin können Items oder Statements zufällig rotiert werden (→ Kapitel 5.8), um Reihenfolgeeffekte (→ Kapitel 7.2.2) zu vermeiden (vgl. Welker / Werner / Scholz 2005: 70, 82).
Online-Befragungen verursachen nur geringe Kosten. Dazu gehört auch die automatische Verwaltung der Durchführung oder der kostengünstige Einsatz [58]verschiedener Fragebogenvarianten, etwa bei Methodentests (»Split-Ballot-Experimente« → Kapitel 7.1) oder bei mehrsprachigen Umfragen (vgl. Welker / Werner / Scholz 2005: 80f.).
Online-Befragungen führen tendenziell zu höherer Offenheit seitens der Befragten und erzeugen offenbar weniger häufig durch soziale Erwünschtheit verzerrte Antworten (→ Kapitel 7.3.1). Der Grad der Anonymität wird von den Befragten als noch höher als bei der herkömmlichen schriftlichen Befragung empfunden (vgl. Taddicken 2007: 98f.).
| 2.5.4 | Nachteile der Online-Befragung |
Neben den allgemeinen Nachteilen von schriftlichen Befragungen treten bei
Online-Befragungen zusätzliche Probleme auf:
Ein nach wie vor ungelöstes Problem stellt die Repräsentativität der durch Online-Befragungen erzielten Ergebnisse dar, denn die Grundgesamtheit der Internet-Nutzer ist (bislang) undefiniert, sodass eine echte Zufallsstichprobe (noch) nicht möglich ist.Hinzu kommt das Problem der geringen Abdeckung, weil nach wie vor das Internet nicht von der gesamten Bevölkerung genutzt wird, auch wenn die Nutzerzahlen steigen (vgl. Bandilla / Bosnjak / Altdorfer 2001: 8). Dies ist insbesondere dann ein Problem, wenn nicht nur Internetnutzer zur Grundgesamtheit der betreffenden Studie zählen.
Jede technische Neuerung bietet nicht nur Verbesserungspotenziale, sondern auch verursacht auch Folgeprobleme, insbesondere im Hinblick auf die Kompetenz, etwa bei der Fragebogenerstellung. Umgekehrt werden technisch versierte Forscher dazu verführt, Fragebögen durch Multimediaelemente zu überfrachten. Dies gilt analog auch für die Befragten, die durch den Online-Einsatz nach wie vor je nach eigener technischer Kompetenz bevorzugt oder benachteiligt werden, sodass bestimmte Bevölkerungsgruppen überrepräsentiert und andere unterrepräsentiert werden (vgl. Welker / Werner / Scholz 2005: 80f.).
Der Vorteil der größeren Offenheit und höheren Anonymitätserfahrung kann aber auch in einen Nachteil umschlagen, wenn dadurch die Verbindlichkeit der Befragung sinkt. Im Internet ist das Spiel mit der Identität und die strategische Selbstdarstellung überdurchschnittlich verbreitet, sodass bei Online-Befragungen bei bestimmten Fragen mit erhöhten Verzerrungen zu rechnen ist (vgl. Taddicken 2007: 98).
| [59]2.6 | Vergleich der Befragungsverfahren |
Die bisherigen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass der Einsatz der vorgestellten Verfahren von der Fragestellung abhängt. Jedes Verfahren hat seine Vorteile und Nachteile oder Stärken und Schwächen; das betrifft sowohl die Möglichkeiten der Stichprobenziehung als auch der Durchführung der Befragung selbst. Damit erübrigt sich eine Sichtweise, die von der wechselseitigen Substitution der Verfahren ausgeht. Eher können sich die Verfahren ergänzen.
Studien zur vergleichenden Methodenforschung belegen, dass sich die Ergebnisse der Verfahren bei gleicher Thematik (Fragestellung) und gleichem Instrument (Fragebogen) unterscheiden. Die Unterscheidungen betreffen die Struktur der Stichprobe, die prozentuale Verteilung und möglicherweise auch die Qualität der Antworten der Befragten (vgl. Ostermeyer / Meier 1994). Bei Telefonbefragungen werden das Vorkommen trivialer Ereignisse unterschätzt und höhere Zufriedenheitswerte auf betreffende Fragen erzielt. Die postalische Befragung begünstigt die Erinnerung an vergangene Ereignisse, und die Antworten sind »ehrlicher« (vgl. Reuband / Blasius 1996; Reuband 2000: 219). Das persönliche Interview erweist sich gegenüber dem Telefoninterview als empfindlicher und störanfälliger bei geringfügigen Veränderungen des Instruments (Frageformulierungen, Antwortvorgaben), dafür ist es differenzierter und variabler: Unbewusste, emotionale und moralisch-geladene Sachverhalte gehen beim Telefoninterview (etwas) verloren (vgl. Noelle-Neumann / Petersen 2000: 198).
Im persönlichen Interview ist die soziale Interaktion zwischen dem Interviewer und dem Befragten am intensivsten und die Möglichkeiten, das Instrument (den Fragebogen) inhaltlich komplex anzulegen, am größten, weil der Interviewer Nachfragen des Befragten klären kann. Außerdem ist der Kontakt zum Befragten am verbindlichsten, sodass die Ausschöpfung der Stichprobe höher ist als bei den anderen Verfahren. Allerdings ist es das aufwändigste und kostenintensivste Verfahren. Die Verbindlichkeit der Interviewsituation hat die Kehrseite der geringen Anonymität, sodass bei heiklen oder sensiblen Fragen das Risiko unehrlicher Antworten besteht.
Die schriftliche Befragung erfordert einen geringeren logistischen Aufwand, und sämtliche Möglichkeiten der Fragebogengestaltung können eingesetzt werden. Allerdings ist der Kontakt zwischen dem Forscher und dem Befragten am unverbindlichsten; das Hauptproblem besteht deshalb in der geringen Ausschöpfung der Stichproben. Durch den Wegfall des Interviewers ist die Befragung anonymer, was ehrliche Antworten bei heiklen Fragen begünstigt. Dafür hängt die Qualität der Beantwortung allein vom Befragten ab.
[60]Die Online-Befragung ähnelt von der Qualität her der schriftlichen Befragung. Bei ihr ist die Stichprobenproblematik noch gravierender, weil man die Ausschöpfung kaum ermitteln kann. Dafür kann sie andere Nachteile der schriftlichen Befragung ein wenig kompensieren, etwa deren mangelnde Kontrollierbarkeit der Befragungssituation.
Das Telefoninterview steht bei vielen Aspekten in der Mitte zwischen persönlichem Interview und schriftlicher Befragung. Es ist weniger leistungsfähig im Hinblick auf den vielfältigen Einsatz von Befragungsinstrumenten, aber dafür leichter zu organisieren und durchzuführen. Der Interviewer kann im Vergleich zur schriftlichen Befragung das Verständnis der Fragen beim Befragten verbessern; durch die flüchtigere und distanzierte Situation beeinflusst er aber das Befragtenverhalten weniger als im persönlichen Interview. Die geringere Verbindlichkeit des Kontaktes führt auch tendenziell zu etwas niedrigeren Ausschöpfungen der Stichprobe als beim persönlichen Interview (vgl. Schnell 2012: 308f.).
Abb. 1: Befragungsverfahren im Vergleich
Alle aufgeführten Vorteile und Nachteile sind nicht absolut, sondern relativ zu verstehen. Durch geeignete Maßnahmen können die jeweiligen Nachteile zumindest verringert werden. Zu diesen Maßnahmen gehört auch der kombinierte Einsatz unterschiedlicher Verfahren. Dieser will allerdings gut bedacht sein, weil sich die Verfahren nicht notwendigerweise gegenseitig validieren, sondern unter Umständen einfach unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen.
16 Bei Telefoninterviews kommen weitere qualitätsneutrale Ausfälle hinzu: kein Anschluss unter dieser Nummer, kein ankommender Ruf, falsche Telefonnummer, (nur) Faxanschluss.
17 Bei Telefoninterviews kommen weitere systematische Ausfälle hinzu: automatischer Anrufbeantworter, ständig besetzt, trotz Freizeichen niemand erreicht, nach Abnahme des Telefonhörers sofort aufgelegt (vgl. Porst 1991: 61).
18 Dieser Aspekt ist nicht nur für persönliche Befragungen relevant und wird an dieser Stelle stellvertretend für die Beurteilung aller Zufallsstichproben in Befragungen behandelt.
19 Selbstverständlich können auch für Telefoninterviews andere Stichprobenverfahren verwendet werden, wie das Schneeball-Verfahren, wenn etwa seltene Populationen befragt werden sollen (vgl. Fuchs 1994: 137ff.).
20 Allerdings können auch mit diesem modifizierten Verfahren Geschäfts- und Privatnummern nicht unterschieden werden, wenn niemand antwortet. Nicht belegte Nummern können nur über einen entsprechenden Ansagetext identifiziert werden, und es kann keine vorherige Mitteilung über die geplante Befragung erfolgen, da die Adressen unbekannt sind.
21 Das Versprechen eines Geschenkes beruht auf der Hypothese der strikten Rationalität, wonach die Ankündigung der Belohnung einen zusätzlichen Anreiz bewirkt; für ein beigelegtes Geschenk wird dagegen die Reziprozitätsnorm unterstellt, weil das Geschenk als Vorleistung empfunden wird, die eine Gegenleistung erfordert. Experimentelle Untersuchungen sprechen eher für die Gültigkeit der Reziprozitätsnorm (vgl. Diekmann / Jann 2001).