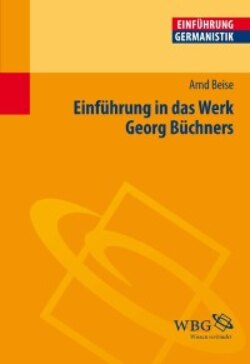Читать книгу Einführung in das Werk Georg Büchners - Arnd Beise - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Unzeitgemäßer Klassiker. Wandlungen des Büchner-Bilds im Spiegel der Forschungsgeschichte
ОглавлениеBüchners Debüt 1835: Karl Gutzkows Präsentation eines Genies
„Die Kritik ist immer verlegen, wenn sie prüfend an die Werke des Genies herantritt.“ So beginnt Karl Gutzkows Artikel vom 11. Juli 1835 über Danton’s Tod, der zwischen dem 26. März und dem 7. April 1835 in der Zeitung Phönix auszugsweise vorabgedruckt worden war (vgl. Gesammelte Werke 1987, Bd. 3). „Die Kritik kann hier nicht mehr sein, als der Kammerdiener, der die Tür des Salons öffnet und in die versammelte Menge laut des Eintretenden Namen hineinruft; das übrige wird das Genie selbst vollbringen. […] Das Genie bedarf keiner Empfehlung. Das fühlen wir, wenn wir von Georg Büchner reden.“ Und Gutzkow schloss seine kritische Empfehlung des Debüts eines bis dahin völlig Unbekannten: „Ich bin stolz darauf, der erste gewesen zu sein, der im literarischen Verkehr und Gespräch den Namen Georg Büchners genannt hat“ (Gutzkow 1974, 177f., 180).
Es mag überraschend sein, wie sicher der gerade 24 Jahre alt gewordene Jungredakteur Karl Gutzkow (1811 – 1878) war, ein „Genie“ entdeckt zu haben. Sein Artikel zeigt aber auch, dass der Schriftsteller Georg Büchner von Anfang an als Ausnahmeerscheinung anerkannt war.
Mythos: Verdrängter Autor
Es gehört zu den längere Zeit gepflegten Mythen einer sich selbst als kritisch verstehenden Literaturwissenschaft, Büchner zu „einem der flagranten Beispiele der Verdrängung“ (Knapp 2000, 41) zu stilisieren. Er sei „spät und immer wieder anders entdeckt worden“, schrieb Paul Rilla (1950, 139): „Entdeckt als ein Nachfahr der Sturm und Drang-Epoche und als ein Vorläufer des Naturalismus. Entdeckt als ein Nachfahr der Romantik und als ein Vorläufer des Expressionismus“, aber immer erst frühestens ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod entdeckt und nie richtig gewürdigt als gerade durch einen selbst. Noch in Heinz Schlaffers Kurzer Geschichte der deutschen Literatur (München 2002, 130f.) paradiert Büchner als „das intellektuelle Zentrum des 19. Jahrhunderts“, vor dem jedoch die Zeitgenossen „wie vor einem Abgrund zurückschreckten“, weil die „schweren Kränkungen, welche die revolutionären Geister des 19. Jahrhunderts der Menschheit nicht ersparen konnten“ – gemeint ist „die Erkenntnis, daß der Mensch vom Tier abstammt (Darwin), daß die Ökonomie das Bewußtsein bestimmt (Marx) und daß das Ich vom Trieb regiert wird (Freud)“ –, allesamt „in Büchners Werk vorgebildet“ seien. Das zu erkennen sei freilich dem 20. Jahrhundert vorbehalten geblieben.
Büchners Talent von Freunden und Gegnern anerkannt
Etwas genauer besehen war Büchner zu keinem Zeitpunkt ein verkanntes Genie. Selbst der seinerzeit schärfste Kritiker Büchners, der unter dem Pseudonym „Felix Frei“ Gutzkows überschwängliches Lob des Revolutionsdramas im Oktober 1835 im Namen „des Classischen“ zurückwies, meinte, das „Schlimmste von alle dem aber“ sei „dieses, daß […] ein Talent aus dem Werke hervorblickt“, das seinesgleichen suche (vgl. Hauschild 1985, 188). Auch Hermann Marggraff (1809 – 1864) anerkannte, obwohl er das Drama „gar zu wild, wüst und cynisch“ fand, die „wahre Genialität“ des Autors (III.2, 325).
Georg Herwegh
Mochten manche also die ästhetischen Zumutungen Büchners nicht goutieren, so war doch allen klar, dass es sich bei ihm um einen bedeutenden Autor handelte. Es enthalten daher „fast alle Konversationslexika und Enzyklopädien bereits ab 1838“ einen Büchner-Artikel, und seit 1840 wird Büchner in den Literaturgeschichten seiner Zeit behandelt (Hauschild 1985, 194). Angesichts des Totalausfalls bedeutender Dramatik auf der Buchmesse desselben Jahrs 1840 fragte Georg Herwegh (1817 – 1875) öffentlich, „wann“ denn „endlich“ die angekündigte „Sammlung der Georg Büchner’schen Productionen“ erscheine (Deutsche Volkshalle, Nr. 102, 26. Mai 1840, 404; Hauschild 1985, 196). Allerdings hatte er wie viele andere Publizisten offenbar übersehen, dass immerhin Leonce und Lena und das Erzähl-Fragment Lenz schon erschienen waren. Es blieb also nur das „beinahe vollendete Drama“ zu erwarten, von dem Wilhelm Schulz in seinem Nachruf von 1837 gesprochen hatte (Grab 1985, 140).
Hermann Marggraff
Der schon erwähnte Hermann Marggraff vermutete 1838 auf Grund der mitgeteilten Partien von Leonce und Lena, dass Büchner vermutlich bald schon „der versöhnenden Kunstform mächtig geworden“ wäre, hätte ihn „nicht der Tod mitten in der Blüte seiner stürmenden Jugendkraft überrascht“ (VI, 333), dass Büchner also auf dem besten Weg zum Klassiker war. 1843 wiederholte Marggraff noch einmal das positive Urteil über Leonce und Lena und schloss eine eindrückliche Charakteristik der Erzählung Lenz an, die etwas „wüst Träumerisches“ habe: „sie wälzt und wühlt und kugelt sich so unheimlich durch seltsame bald knapp abgebrochene, bald traumhaft verlängerte Wortwindungen und Satzverschlingungen, […] daß es dem Leser fast erscheint, als lese er hier nicht die Novelle eines Zweiten über einen Wahnsinnigen, sondern habe es mit diesem selbst zu tun“ (VI, 334). Kurz vor der Märzrevolution pries ein pseudonymer Autor als quasi einzige deutsche Lustspiele Grabbes Scherz, Ironie, Satire und tiefere Bedeutung und Büchners Leonce und Lena an (vgl. Beise 2005 / 08, 90f.).
Büchner seit 1848 ein „Classiker“
Büchner war also seit seinem ersten Auftreten mit seinen dichterischen Werken präsent und anerkannt. So muss es nicht verwundern, dass bereits 1848 eine Szene aus Danton’s Tod (IV/3) Aufnahme in die Anthologie Bildersaal der Weltliteratur (hg. v. Johannes Scherr. Stuttgart 1848, 935f.) fand; 1863 nahm dann Carl Arnold Schloenbach den I. Act, die letzte Szene des II. Acts und den III. Act von Danton’s Tod in die Bibliothek der Deutschen Klassiker auf (Bd. 22: Die Dramatiker der Neuzeit. Hildburghausen 1863, 21870, 149 – 186).
Julian Schmidts Abrechnung mit Büchner
Es war Büchners Präsenz, Prominenz und Ausstrahlung besonders auf jüngere Autoren, die Julian Schmidt (1818 – 1886) veranlassten, die Abrechnung mit den vormärzlichen Literaturkonzepten am Beispiel Büchners zu exekutieren, der vor Gutzkow, Hebbel und Lassalle zum Feindbild Nr. 1 für den Cheftheoretiker des sogenannten ,bürgerlichen‘ Realismus wurde. Schmidts Aufsatz erschien 1851 in den Grenzboten, dem von ihm und Gustav Freytag herausgegebenen Zentralorgan des programmatischen Realismus, und wurde jeweils mit geringen Veränderungen in die verschiedenen Auflagen seiner Geschichte der Deutschen Literatur im neunzehnten Jahrhundert (1853; 51866) übernommen. „Altkluge Ironie“ und „verfrühte Blasirtheit“ charakterisierten Büchner, der das „alle Poeten seiner Schule“ überragende „Talent“ aber „unkünstlerisch“ einsetzte, ja „an einen unglückseligen Gegenstand verschwendet“ hätte, zum Beispiel bei der literarischen Darstellung des Wahnsinns, wobei Lenz beweise, dass sich offenbar dem „Dichter […] selber die Welt im Fiebertraum“ drehte. Die Figur sei „Spiegelbild der eigenen Stimmung, welche zugleich die der Zeit war“: Weltschmerz und Nihilismus, gepaart mit einem krankhaften Interesse an den „Nachtseiten der Natur“. Leonce und Lena sei da nicht besser: „frostige Späße“ des „Spleens und der Blasirtheit“, „glaubenlos“, „hochmüthig“, „sophistisch“, „unheimlich“, „gefährlich“: „Denn wie die Realität sich in Visionen verliert, so bemächtigen sich die Visionen der Wirklichkeit.“ Noch „unheimlicher“ werde die Sache in Danton’s Tod, „denn wir fühlen Leben und Zusammenhang heraus“. Obwohl Büchner die Quellen weniger geschickt ausgebeutet habe als Goethe im Götz von Berlichingen, mache das Drama auf „jeden Unbefangenen“ immerhin einen durchaus wünschenswerten Eindruck, nämlich „daß die Revolution etwas Entsetzliches und Verabscheuungswürdiges sei“. Umso schlimmer, dass Büchner selbst sich an die „Spitze einer ziemlich weit verbreiteten geheimen Gesellschaft“ gestellt habe, „welche Brandpamphlete in die Hütten des Volks schleuderte, um einen Krieg der Armen gegen die Reichen zu erregen“. Der Landbote sei eine einzige „Lüge“, ja er sei der Versuch, eine „Revolution herauf[zu]beschwören aus Langeweile und Blasirtheit!“ Dies sei „die Consequenz jener skeptischen Selbstbeschauung, die uns die Romantik gelehrt; jenes Pessimismus, der aus aristokratisch frühreifer Ueberbildung hervorgeht, und der nachher in unserer äußersten Demokratie seinen Bodensatz gelassen hat“ (Schmidt 1856, 49 – 56).
Wirkung bei Naturalisten und Neoromantikern
Büchner vertrat gegenüber der propagierten bürgerlich-realistischen Mittelstraße für Schmidt zugleich den aristokratisch-romantischen und sozialistisch-naturalistischen Irrweg. Damit ist auch gesagt, wo Büchner weiterhin Wirkung entfaltete, während die programmatischen Realisten von Gustav Freytag (1816 – 1895) bis Karl Frenzel (1827 – 1914) den Ton angaben: Bei Spät- und Neoromantikern oder den Naturalisten, bei den Décadents und den Sozialdemokraten, wo sich sogar ein regelrechter „Büchnercultus“ entfaltete, wie Adolf Stern 1880 festhielt (Goltschnigg 2001 / 04, 1,143), auch wenn Franz Mehring 1897 insistierte, dass Büchner bei aller politischen Klarsicht, die ihn weit über seine Zeitgenossen heraushebe, kein Sozialist „im heutigen Sinn des Wortes“ gewesen sei (Mehring 1976, 78), was Georgs Bruder Ludwig Büchner gerade behauptet hatte (Goltschnigg 2001 / 04, 1,154 – 156). Dass Büchner in der Arbeiterbewegung ohne Abstriche verehrt wurde, lässt sich nicht sagen. Als der Chefredakteur der Magdeburger Volksstimme, damals noch eine linke Zeitung, 1891 Szenen aus Danton’s Tod in der Feuilletonbeilage abdruckte, protestierten die Genossen heftig, weil man die Zeitung „ängstlich vor den Frauen und Kindern wegschließen“ müsse, „die durch solches ,Schmutzwerk‘ nur verdorben würden“ (Hauschild 1985, 286).
Karl Emil Franzos
Es müsste noch genauer erforscht werden, wie Büchner an die 1848 und später geborenen ,Romantizisten‘ vermittelt wurde. Einer von ihnen, der sich einen „romantischen Realisten“ nannte (ebd., 236), Karl Emil Franzos (1848 – 1904) nämlich, entfaltete ab 1875, als in Zürich die von Adolf Calmberg (1837 – 1887) initiierte burschenschaftliche Büchner-Feier stattfand (ebd., 427 – 442), von Wien aus eine regelrechte Kampagne zugunsten des angeblich inzwischen eher „ungelesenen“ Darmstädter Schriftstellers (ebd., 109f.). Einer der Vermittler war zum Beispiel der seit 1864 als Professor für Literatur an der Wiener Handelsakademie lehrende Kritiker Emil Kuh (1828 – 1876), der Büchner für ein „Mittelglied“ zwischen Grabbe, Hebbel und Otto Ludwig hielt (ebd., 110); Kuckhoff meinte noch 1927, dass Büchner in Schopenhauers romantischem Pessimismus „die philosophisch durchgebildete Darstellung seines eigenen Gefühls“ gefunden hätte (WK 436).
Wedekind, Hofmannsthal und die Münchner Bohéme
Franzos brachte jedenfalls 1879 eine neue Gesammt-Ausgabe von Büchners Schriften heraus, die zur Grundlage der ,modernen‘ Büchner- Rezeption seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde. Durch sie lernten Autoren wie Frank Wedekind (1864 – 1918) oder Hugo von Hofmannsthal (1874 – 1929) den Autor kennen und schätzen; so wie die Münchner Bohème um Oskar Panizza (1853 – 1921), Ernst von Wolzogen (1855 – 1934), Franz Held (1862 – 1908), Otto Erich Hartleben (1864 – 1905) und Max Halbe (1865 – 1944), die 1895 Leonce und Lena in einem elitären Zirkel uraufführten (vgl. Goltschnigg 2001 / 04, 1,234 – 237).
Paul Landau
Um 1900 hatte sich Büchners Werk im literarischen Bewusstsein der Zeit in voller Breite durchgesetzt. Es schien den Neoromantikern ebenso nahezustehen wie den Avantgardisten. Es „führt in gerader Linie hin zu der naturalistischen Tragödie“, zu „der modernen Romantik“, zur balladesken Moritat, zur „psychologischen Analyse“ und zum „Impressionismus“ der Jahrhundertwende, so Paul Landau (1880 – 1951) in einem Artikel zum 100. Geburtstag des Dichters (Goltschnigg 2001 / 04, 1,193 – 195). Landau hatte nicht lange vorher mit der Studie „Georg Büchners Leben und Werke“, publiziert als Einleitung zu seiner zweibändigen Ausgabe der Gesammelten Schriften (1909) die erste moderne literaturwissenschaftliche Gesamtdarstellung Büchners geliefert (WK 237 – 351, Ausschnitte auch in Martens 1973, 16 – 81). Er entwarf hier gewissermaßen das Gegenbild zu Julian Schmidts Büchner-Porträt. In biografischen Details der romanesken Einleitung von Franzos in dessen Gesammt-Ausgabe (WK 137 – 233, ergänzt durch WK 120 – 134) verpflichtet, organisierte er die äußeren Fakten zunächst nach dem um 1900 üblichen, heute durch die Erzählungen von Thomas Mann noch vertrauten Muster von „Genie und Krankheit auf der einen, Gesundheit und philiströser Dummheit auf der anderen Seite“ (Dedner 1988, 207). Gesund und krank konnten bei Landau nicht nur Individuen, sondern auch Epochen sein; so war die Zeit Shakespeares ebenso krank wie die Romantik. Anders als Schmidt deutete Landau nun aber Büchner nicht als Repräsentanten der kranken Zeit, sondern im Gegenteil als von „Lebensdurst und Lebensmut“ strotzenden „Kämpfer gegen seine Zeit“, die eine „welke Epoche“ war. Der „Jüngling“ überwand „in den stagnierenden, dumpfen Jahren der Restauration […] alle Krisen, die ihn mit unerhörter Gewalt ergreifen und durchwühlen, ringt sich aus ihnen heraus zur Gesundung, zum festen klaren Eingreifen und Begreifen der Welt“ (WK 237f.). Anders als in der „modernen Dekadence“ (ebd., 349) war bei Landau das Genie also nicht notwendig krank, sondern konnte in vitalistischer Manier auch als einsamer Gesunder der allgemeinen Morbidität trotzen. Während der Expressionist Wilhelm Hausenstein (1882 – 1957) ein paar Jahre später den frühen Tod Büchners gewissermaßen als Erfüllung der „Vereinsamung“ eines unzeitgemäßen Genies („Die Spannung seiner Jugend war zu groß, die Zeit zu miserabel gewesen“) glorifizierte (WK 372f., 364), empfand ihn Landau als tragische Katastrophe, die „eine Entwicklung […] jäh abgebrochen“ habe, „den Jüngling fällte wie einen jungen starken Baum die Axt“ (WK 351, 237).
Repräsentant oder Widersacher seiner Zeit
Obwohl Landau gegen Schmidts Bild von Büchner als Repräsentant seiner Zeit das des Widersachers seiner Zeit profilierte, entwickelte sein Text unter der Hand ein vermittelndes, weil differenzierteres Porträt, das er in dem Geburtstagsartikel noch bestimmter formulierte: In jeder von Büchners Arbeiten flamme „etwas Neues auf“, woran „die moderne Literatur angeknüpft“ habe, doch zugleich stünden sie alle „auf dem Boden der Tradition, wachsen organisch hervor aus den literarischen Voraussetzungen ihrer Zeit“ (Goltschnigg 2001 / 04, 1,193). Landau konnte in seiner umfangreichen Einleitung auf Grund seiner profunden Kenntnis der Literaturgeschichte die inzwischen von der Forschung bestätigten unterschiedlichsten Bezugspunkte Büchners benennen: Aufklärung und Romantik, materialistischer Spinozismus und idealistische Naturphilosophie.
Arnold Zweig
Adam Kuckhoff
Widerspruchsvolle Büchner-Bilder waren in der Zwischenkriegszeit gängig. Arnold Zweig (1887 – 1968) konstatierte „vitalistische Lebensbejahung und melancholische Todesnähe“, Adam Kuckhoff (1887 – 1943) modellierte Büchner als Kreuzung aus „Schopenhauer und Lenin“ (Goltschnigg 2001 / 04, 1,56, 58; vgl. WK 377 – 411 bzw. 415 – 474). In der akademischen Literaturwissenschaft wurden diese eher dichterischen Synthesen in den folgenden Jahrzehnten wieder auseinandergenommen.
Karl Viëtor
Karl Viëtor (1892 – 1951), der seit 1925 zu Büchner publizierte, summierte in dem Buch Georg Büchner. Politik, Dichtung, Wissenschaft (Bern 1949) seine Forschungen, die Büchner als „Heros der Desillusion“ (1925) oder Vertreter eines „ausweglosen Pessimismus“ (1934) darstellten (vgl. auch Zelle 2005 / 08).
Hans Mayer
Gleichzeitig entwarf der damalige Sozialist Hans Mayer (1907 – 2001) ein Büchner-Porträt, das in der Germanistik sehr lange von großem Einfluss war. In dem Buch Georg Büchner und seine Zeit (Wiesbaden 1946), das in ergänzter Fassung 1972 (41980) als Taschenbuch neu publiziert wurde, stellte er Büchner in die Tradition des französischen Materialismus des 18. Jahrhunderts, der aber leider Hegels Dialektik nicht kannte und daher vom „Fels des Atheismus“ (III.2, 49) aus – anders als Karl Marx – nicht „ein gelobtes Land“, sondern „nur das Grau in Grau hoffnungslosen Elends“ sah (Mayer 1946, 356).
Wolfgang Wittkowski
In scharfer Wendung gegen Mayers atheistischen Materialisten Georg Büchner baute Wolfgang Wittkowski (* 1925) den Dichter als religiösen Revolutionär auf, dessen Denken zwischen Pascal und Kierkegaard anzusiedeln und dessen Dichtung als pietistisch motivierte Gewissenserforschung zu verstehen wäre, bei der es darum gehe, „die Adamsnatur“ zu überwinden, „um sich anzunähern an Moses, den Volkserlöser, und an Christus, den Welterlöser durch Ärgernis, Gericht, Verblenden“ (Wittkowski 1978, 369).
Gerhard Jancke, Henri Poschmann, Thomas Michael Mayer
Mit Wittkowskis christlicher Deutung ließen sich die zeitgleich entstandenen Büchner-Bilder von Gerhard Jancke (1938 – 2005) auf der linken und Henri Poschmann (* 1932) bzw. Thomas Michael Mayer (1946 – 2010) auf einer anderen linken Seite schwerlich vereinbaren; ersterer stellte Büchner als neojakobinischen Aktivisten dar (Jancke 1975; 31979), die beiden anderen als frühkommunistischen Sozial-Revolutionär (Mayer 1979; Poschmann 1983; 31988).
Ältere geisteswisseschaftliche Urteile
In gewisser Weise reflektierten diese Positionen und Streitigkeiten auch den Zeitgeist der APO-Ära und verraten oft mehr über die jeweiligen Interpreten als über Büchner, obwohl sie nicht unwesentlich zur Schärfung des zuvor nur verschwommenen und stets im Ungefähren geisteswissenschaftlicher Generalisierungen bleibenden Bildes beitrugen (Friedrich Sengle beobachtete 1952 / 69 die Auflösung des Historischen durch einen erotischen Nihilismus; Gerhart Baumann parallelisierte 1961 / 76 fragmentarisches Werk und unabgeschlossene Persönlichkeitsbildung; Walter Müller-Seidel entdeckte 1968 im Gegenteil Büchners szientifisches Totalitätsdenken; Walter Hinck stellte 1969 wieder eine unüberwindliche Dichotomie von Dichtung und Politik fest; Maurice Benn entdeckte 1976 in Büchner einen engagierten Existentialisten usw.).
Büchner-Symposien 1981 und 1987
Die 1980er Jahre waren in der Büchner-Forschung das Jahrzehnt der Sammlung vorliegender Spezialuntersuchungen und Formulierung literaturwissenschaftlicher Desiderata – zum größten Teil nachlesbar in den Akten des ersten (1981) und zweiten (1987) Internationalen Georg-Büchner-Symposiums (GBJb 2 u. 3; Dedner/Oesterle 1990) – und der Beginn einer neuen, textkritisch und neopositivistisch abgesicherten Forschung zu speziellen Fragen und übergreifenden Aspekten (vgl. in den Büchner-Studien: Grab 1985; Hauschild 1985; Dedner 1987; Wender 1988).
Ausstellungen 1985 und 1987
Wichtige Ausstellungen präsentierten Büchners Werk und seine Zeit der Öffentlichkeit (Marburg 1985: KatM; Darmstadt 1987: KatD; Düsseldorf 1987). Die Büchner-Forschung der DDR wurde in zwei Sammelbänden der internationalen Öffentlichkeit vorgelegt (Werner 1988; Poschmann 1992).
Editionen
Zugleich wurden die beiden gegenwärtig wichtigsten Editionen vorbereitet, die 1992 – 1999 von Henri Poschmann im Deutschen Klassiker Verlag herausgegebene „Frankfurter Ausgabe“ der Sämtlichen Werke, Briefe und Dokumente (2 Bde.; hier zitiert mit Sigle FA nach der 2006 publizierten Taschenbuch-Ausgabe) sowie die von Thomas Michael Mayer mitbegründete und von Burghard Dedner (* 1942) herausgegebene „Marburger Ausgabe“ der Sämtlichen Werke und Schriften (Historisch-kritische Ausgabe mit Quellendokumentation und Kommentar), die seit 2000 im Verlag der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erscheint (hier zitiert mit römischer Band- und arabischer Seitenzahl).
Biografie
1993 erschien die „erste großangelegte Biographie Georg Büchners mit wissenschaftlichem Anspruch“ (Knapp 2000, 46) aus der Feder von Jan-Christoph Hauschild (verbesserte Fassung 1997 als Taschenbuch). Trotz verschiedener Einwände gegen Details (vgl. Mayer 1995 / 99) wird sie auf noch nicht absehbare Zeit die Grundlage für jede Beschäftigung mit dem Leben des Autors bleiben; Hauschild selbst besorgte eine Kurzfassung seiner Biografie in der Reihe rowohlts monographien (1992; überarb. u. erw. 2004).
Neue Forschungen um 2000
Seit den 1990er Jahren und verstärkt seit der Jahrtausendwende werden auch bislang vernachlässigte Bereiche des Œuvres untersucht, zum Beispiel die Schülerschriften (Lehmann 2005), die Übersetzungen (Hübner-Bopp 1990; Bremer 1998; Beise 2008), die philosophischen Schriften (Vollhardt 1991, Osawa 1999; Stiening 2005) oder die naturwissenschaftlichen Schriften (Stiening 1999, Roth 2004), wobei der Zusammenhang von Naturwissenschaft und Dichtung generell, wenn auch zum Teil eher dekonstruktiv als konkret, in den letzten Jahren häufiger in den Blick gerät (Kubik 1991, Ludwig 1998, Müller Nielaba 2001, Müller-Sievers 2003, Borgards 2007). Auch die intermedialen Aspekte des Werks und der Rezeption (Hoff/Martin 2008; Neuhuber: 2009) geraten in einer sich kulturwissenschaftlich ausrichtenden Germanistik neuerdings stärker in den Blick. Seit der Jahrtausendwende mehren sich auch die einführenden Monografien (Knapp 2000, Martin 2007; Neuhuber 2009; das vorliegende Buch), die aber wie inzwischen üblich nicht mehr nur die vorliegende Forschung resümieren, sondern auch neue und eigene Akzente setzen, die den Literatur-Unterricht und die Forschung inspirieren können.