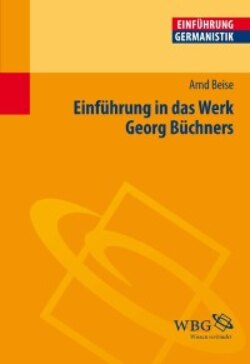Читать книгу Einführung in das Werk Georg Büchners - Arnd Beise - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Ein kurzes Leben. Biografischer Abriss
ОглавлениеEin Frühvollendeter?
Die Herausforderung einer Lebensbeschreibung Georg Büchners liegt vor allem in dem Kontrast zwischen der eminenten Bedeutung seines Werks und der unglaublich kurzen Zeit von dessen Entstehung. Büchner hinterließ mit dem Hessischen Landboten die meist zitierte und nachgeahmte politische Flugschrift Deutschlands, mit den Dramen Danton’s Tod, Leonce und Lena und Woyzeck drei der meist bewunderten Bühnenstücke deutscher Sprache, mit denen nach Heiner Müller (Goltschnigg 2001 / 04, 3,441) „eigentlich die moderne Dramatik“ anfange, und mit Lenz eine Erzählung, mit der nach Arnold Zweig „die moderne europäische Prosa“ (WK 401) begann; neben diesen fünf ,klassischen‘ Werken entstanden noch Übersetzungen von zwei Dramen Victor Hugos, eine zoologische Doktorarbeit und der Anfang einer philosophiegeschichtlichen Vorlesung, deren Bedeutung erst noch zu entdecken ist – und das alles in nur drei Jahren. Wie auf kaum einen anderen Schriftsteller passt auf Büchner, der nur 23 Jahre, 4 Monate und 2 Tage alt wurde, die Rede vom „Frühvollendeten“ (Loch 1988; vgl. Gutzkow 1837, 346; Georg Hermann: Die Frühverstorbenen, in: Das litterarische Echo 18 (1915 / 16), 1, 20 – 31). Kann man diesen ,Ausbruch an Genialität‘ aus seinen Lebensumständen, aus seinen ersten zwanzig Jahren erklären?
Geboren am 17. 10. 1813
Carl Georg Büchner, wie sein vollständiger Taufname lautet (vgl. das Taufprotokoll vom 28. Okt. 1817 in: KatM 19), wurde am 17. Oktober 1813 morgens um halb sechs Uhr als erstes Kind des Distriktarztes Ernst Büchner und seiner Frau Caroline in der großherzoglich-hessischen Ortschaft Goddelau geboren. An seinen Geburtsort, ein Bauerndorf mit etwa 80 Häusern und rund 550 Einwohnern (Hauschild 1993, 22), wird er allerdings nicht viele Erinnerungen behalten haben; schon 1816 übersiedelte die Familie nach Darmstadt, wo der Vater Assessor des Großherzoglichen Medicinal-Collegiums geworden war, dessen ordentliches Mitglied er 1832 und dessen Vorsitzender er 1854 als Obermedizinalrat wurde.
Kindheit und Jugend
In Darmstadt verbrachte Georg Büchner seine bewussten Kinder- und Jugendjahre bis zum Beginn seines Studiums im Herbst 1831. Die Hauptstadt des Großherzogtums Hessen galt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als außerordentlich „still, langweilig, zopfig, altväterisch, philisterhaft“, wie sich Wilhelm Hamm (1820 – 1880) erinnerte (KatM 31). Als der Komponist Carl Maria von Weber 1810 einmal in Darmstadt gastierte, begann er einen Brief mit dem Griff „nach einem langweiligen Gänsekiel, um Dir in dem langweiligen Darmstadt langweilig zu erzählen, daß ich Langeweile habe“ (Beise/Funk 2005, 109).
„Pensionopolis“
Auch Georgs Bruder Ludwig Büchner berichtete in einem Brief an Wilhelmine Jaeglé aus dem Jahr 1844, es sehe in seiner Heimatstadt „aus, just so, wie früher: breit, weit, leer, todt“ (KatM 31). Das Bild der Residenzstadt wurde in der Biedermeierzeit bestimmt durch einen besonders hohen Anteil an Militär-, Hof- und Regierungsbeamten und durch eine Quote von nicht erwerbstätigen Rentnern und Pensionären, die „von wenigen anderen deutschen Städten überhaupt erreicht worden sein“ dürfte, wie sich Ekkehard Wiest ausdrückte (KatM 26). Der jüngste Spross der Familie, Alexander Büchner, nannte daher in seinen „Erinnerungen“ (Das „tolle“ Jahr vor, während und nach. Von einem, der nicht mehr toll ist. Gießen 1900, 13) die Stadt „Pensionopolis“. Mit seinen Schulfreunden machte sich auch Georg Büchner weidlich lustig über die „residenzlichen […] Zustände“ (MA 373), wovon auch noch der Brief an Edouard Reuß vom 20. August 1832 Zeugnis ablegt: Aus Darmstadt lasse sich nichts „Vernünftiges“ schreiben, „ist auch noch nie geschehen“, man könne hier allenfalls als „so ein anständiger, so ein rechtlicher, so ein zivilisierter junger Mann […] bei einem Minister den Tee einnehmen, bei seiner Frau auf dem Kanapee sitzen und mit seiner Tochter eine Françoise tanzen“, kurz: „ich kann einmal diese Luft nicht vertragen, sie ist mir eben so zuwider, als zur Zeit, da ich fortging“ (FA 2,359f.).
Abb. 1 und Abb. 2: Von Büchner gibt es nur zwei zu Lebzeiten entstandene Porträts: eine Bleistiftskizze von Alexis Muston (1810 – 1888), die auf einer gemeinsamen Wanderung im Odenwälder Felsenmeer 1833 entstand; und das sozusagen offizielle Porträt, das Heinrich Adolf Valentin Hoffmann (1814 – 1896) für die Familie anfertigte (verbrannt 1944). Sie zeigen vor allem den primären Eindruck: die im Steckbrief 1835 erwähnte hohe, „sehr gewölbte“ Stirn und den Gesichtsausdruck einer „Katze, wenn’s donnert“ (so die Erinnerung des Kommilitonen Carl Vogt).
Büchners Mutter
Bei einem Autor, dessen Werk von weltliterarischer Bedeutung während des Studiums in nur drei Jahren und in einem Alter entstand, in denen andere überhaupt erst „zu leben anfangen“, ist „die Frage nach dem, womit er sich als Schüler beschäftigt und auseinander gesetzt hat“, von besonderer Relevanz (Hauschild 2004, 8 u. 23). Über die Anfänge von Büchners Bildung wissen wir indes nur sehr wenig. Bis 1821 wurde er im Wesentlichen durch seine Mutter Caroline Büchner unterrichtet. Diese war 1791 in Pirmasens als dritte Tochter eines hohen pfälzischen Beamten geboren worden und hatte am 28. Oktober 1812 den damaligen Hofheimer Amts-Chirurgus Ernst Büchner geheiratet. Sie war, so nannte sie Ludwig Wilhelm Luck 1878 rückblickend, „eine ehrenwerte, charakterfeste deutsche Hausfrau“, die „ohne alle Prätension auf außergewöhnliche Bildung“ nicht „sich selbst genießen und geltend machen“ wollte (MA 375), sondern für ihre Familie da war. Ihre zweite Tochter Luise schilderte sie in einem Romanfragment als „vernünftig und gerecht […] der Jugend und besonders ihren Kindern gegenüber“, womit sie diese „zur Mäßigung und Besonnenheit“ lenkte. „Dadurch, daß sie auf ihre Kinder einging, sie als urtheilsfähige Menschen betrachtet und mit ihnen discutirte, nicht disputirte, erwarb sie sich deren unbedingtes Vertrauen“ (KatM 14). Der Freund Eugène Boeckel, der sie 1836 kennen lernte, schrieb an Georg Büchner: „Deine Mutter ist übrigens eine der angenehmsten und unterhaltensten Personen welche ich jemalen gesehn habe“ (FA 2,425). Wie sie ihre Kinder unterrichtete und was sie ihnen speziell beibrachte, ist jedoch nicht bekannt. Immerhin wurde bei den Büchners nach dem Zeugnis der Tochter Luise stets darauf geachtet, dass es „bei den Kindern nie ein faules Herumschlendern“ gab, sondern dass diese immer mit „einer nützlichen Arbeit“ beschäftigt waren, wenigstens bis zum Abendessen. Georg Büchner soll sogar noch danach anstatt mit Freunden auszugehen „in seinem Zimmer […] angestrengt“ und „oft zu lange“ gearbeitet haben, „was der Mutter“ dann doch „oft bange Sorge bereitete“ (IA 34). Der Vater Ernst Büchner, der nach Karl Emil Franzos in seiner Jugend „von einem rein der Wissenschaft gewidmeten Leben“ geträumt habe (WK 141) und auch als praktischer Arzt noch gelegentlich Forschungsbeiträge publizierte (vgl. KatM 20 – 25; KatD 66 – 71), mochte den Studieneifer seines ältesten Sohns mit Genugtuung gesehen haben, so wie er sich 1836 freute, dass sein jüngster Sohn Alexander gute Anlagen zeigte, „ein ruhiger Gelehrter [zu] werden“, wie er in seinem letzten Brief an Georg schrieb (FA 2,460).
Primarschule 1821 – 1824
Im Herbst 1821 trat Georg Büchner in die „Privat Erziehungs- und Unterrichts-Anstalt für Knaben“ ein, die Carl Weitershausen (1790 – 1837) in Darmstadt gerade neu eröffnet hatte. Wie der Name seines Instituts schon zeigte, legte Weitershausen programmatisch Wert darauf, dass „Schule […] nicht nur Unterrichts- sondern auch Erziehungs-Anstalt seyn“ sollte (KatD 22). So wurden die Schüler nicht nur sechs Tage die Woche von morgens bis nachmittags in Geometrie, Geschichte, Physik, Latein, Griechisch und Französisch unterrichtet, sondern auch auf Exkursionen wie Wanderungen und Museumsbesuche geschickt und körperlich trainiert. „Gehorsam“, „Selbstüberwindung“, „strenge Ordnung und Pünktlichkeit“ waren nicht nur Sekundärtugenden, sondern bei Weitershausen „oberste Erziehungsziele“ (Hauschild 2004, 22). Nichtsdestoweniger bescheinigte Wilhelm Hamm (Jugenderinnerungen. Hg. v. Karl Esselborn. Darmstadt 1926, 76) dieser Schule einen „freigeistigen, demagogischen Anstrich“. In einem Programm dieser Schule wird Georg Büchner 1822 das erste Mal öffentlich erwähnt: als Deklamator eines lateinischen Texts über die „Vorsicht beim Genusse des Obstes“ (KatD 22). Aus dieser Zeit haben sich zwei Schulhefte Büchners erhalten, und zwar eines zur „Pflanzenkunde“ und eines zur „Geometrie“ (vgl. Lehmann 2005, 29 – 42). Letzterem Heft ist im Übrigen anzumerken, warum der Direktor des im Folgenden besuchten Gymnasiums dem Schüler Georg Büchner noch auf dem Abgangszeugnis bescheinigte, er habe „mangelnde Vorkenntnisse“ in „der Mathematik“ gehabt (FA 2,639): „Der Vergleich mit zeitgenössischen Lehrbüchern und möglichen Quellen zeigt, daß nicht nur bei Büchner […], sondern auch und vor allem auf seiten des Lehrers eine große Unsicherheit und Unkenntnis bestand“ (Lehmann 2005, 39).
Gymnasium 1824 – 1831
Entgegen früheren Annahmen wechselte Büchner wohl schon im Herbst 1824 (vgl. ebd. 14 – 16) auf das Großherzoglich-Hessische Gymnasium in Darmstadt, das sogenannte „Pädagog“. Hier wurde den Schülern eine humanistisch ausgerichtete Bildung gegeben, die sie zu einem universitären Studium befähigen sollte. Gerhard Schaub zufolge war das Pädagog zu Büchners Zeit „nicht nur die bedeutendste Gelehrtenschule des Großherzogtums Hessen, sondern auch ,eines der wichtigsten teutschen Gymnasien‘ überhaupt“ (KatM 45). Später berühmt gewordene Schüler waren neben den Brüdern Georg und Ludwig Büchner zum Beispiel Justus Liebig (1803 – 1873) oder Georg Gottfried Gervinus (1805 – 1871).
Schulischer Unterricht
Die „Instruction für den Unterricht“ von 1827 unterteilte die Fächer in: „I. Sprachen: 1) Hebräisch. 2) Griechisch. 3) Lateinisch. 4) Französisch. 5) Deutsch. II. Wissenschaften: 6) Encyclopädie der Wissenschaften und Literärgeschichte. 7) Religion. 8) Geographie und Geschichte. 9) Mathematik. 10) Naturkunde. III. Künste: 11) Zeichnen. 12) Kalligraphie. 13) Singen.“ (Ebd.. Aus der Gymnasialzeit Büchners sind immerhin 22 Hefte überliefert, bei denen es sich aber überwiegend „nicht um eigenständige Arbeiten, sondern vor allem um Übersetzungen, um ,gebundene Aufsätze‘ sowie um Mitschriften nach diktatähnlichen Vorträgen“ handelt. „Die vielen umfangreichen und ausgeprägt quellenabhängigen Diktatmitschriften belegen anschaulich, wie der Unterricht mit vermutlich nur wenigen Ausnahmen verlief: Die Lehrer hielten Vorträge, die sie anhand von Lehrbüchern u.Ä. vollständig ausformuliert hatten.
Öffentliche Rede-Actus
Die Schüler mussten diese wörtlich mitschreiben und als Grundlage für das häusliche Lernen sowie für Ausarbeitungen benutzen, d.h. schriftliche Aufsätze, Reden und Vorträge, die vor allem von den Schülern der oberen Klassen (Prima und Selecta) regelmäßig gefordert wurden. Besonders gelungene Abhandlungen und Reden wurden während des öffentlichen Redeactus vorgetragen, der den Hauptteil der jedes Semester beschließenden Schulfeierlichkeiten bildete“ (BHb 2). Büchner trat wegen „seiner bemerkenswerten rhetorischen Leistungen“ (Hauschild 2004, 25) sogar zwei Mal bei einer solchen Gelegenheit auf, nämlich am Ende des Sommersemester 1830 mit einer „teutschen Rede“ zur Rechtfertigung der Selbsttötung des Cato von Utica (FA 2,30 – 38) und die bei seiner eigenen Abiturfeier am Ende des Wintersemesters 1830 / 31 vorgetragenen „Rede des Menenius Agrippa an das römische Volk auf dem heiligen Berge“, die er allerdings schon ein Jahr zuvor verfasst hatte (nicht erhalten).
Rede über Cato von Utica
Unter den überlieferten Schülerschriften stellt die Cato-Rede das ausgereifteste Zeugnis von Büchners rednerischem bzw. schriftstellerischem Talent dar“, meinte Susanne Lehmann (BHb 5), die den Text in ihrer Dissertation über „ausgewählte Schülerschriften und ihre Quellen“ bisher auch am ausführlichsten analysierte (Lehmann 2005, 107 – 165). Bemerkenswert ist darin die starke Betonung der unbedingten Prinzipientreue, der Ehrliebe und des Pflichtbewusstseins, des Patriotismus und der Freiheitsbegeisterung des antiken Stoikers, gegen dessen Freitod alle christlichen Einwände beiseite gewischt werden, da es absurd sei, „einen alten Römer nach dem Katechismus kritisieren zu wollen“ (FA 2,31). Vielmehr werde seine Tat, nämlich „sich lieber den Tod geben, als den Sturz der römischen Republik und Freiheit erleben“ (Luise Büchner; IA 30), „ein Denkmal im Herzen aller Edlen“ behalten, „so lange das große Urgefühl für Vaterland und Freiheit in der Brust des Menschen glüht!“ (FA 2,38).
Aufsatz über den Helden-Tod der vierhundert Pforzheimer
Auffällig ist jedoch, dass der Anfang, den Büchner aus seinem eigenen Aufsatz über den Helden-Tod der vierhundert Pforzheimer (Wintersemester 1829 / 30) nahezu wörtlich abschreibt, einen Satz nicht enthält, den wir in dem früheren Text noch finden: „Solche Männer waren es, die ganze Nationen in ihrem Fluge mit sich fortrissen und aus ihrem Schlafe rüttelten, zu deren Füßen die Welt zitterte, vor welchen die Tyrannen bebten“ (FA 2,18). Vermutlich auf Wunsch Carl Diltheys, „welcher natürlich die Rede vorher geprüft“, so Luise Büchner (IA 30), sollte dieser Satz knapp acht Wochen nach der Pariser Juli-Revolution und wenige Tage nach dem Ausbruch einer Bauernrevolte im Norden des Großherzogtums Hessen nicht öffentlich ausgesprochen werden, auch wenn die Rede insgesamt trotzdem noch unüberhörbar die „hingebendste Liebe zu der Freiheit“ und den „unversöhnlichsten Haß gegen die Unterdrückung“ (Luise Büchner) atmete (vgl. Hauschild 2004, 26f.).
„Liebe zu der Freiheit“
Seit 1826 war der angesehene Pädagoge Carl Dilthey (1797 – 1857) Direktor der Schule. Bei Abiturfeiern oder anderen öffentlichen Anlässen warnte er wiederholt vor den aufrührerischen Tendenzen an den Universitäten und suchte an seiner Schule ein konservatives Klima zu halten. Doch konnte er nicht verhindern, dass seine Schüler von einer „Freiheit“ träumten, die nicht nur „Geist und Herz“ betraf, sondern auf die Abschaffung von „Tyrannei und Knechtschaft“ auch in Staat und Gesellschaft zielte (vgl. KatM 50 u. 58f.). In dem erwähnten Aufsatz über den „Heldentod der vierhundert Pforzheimer“, der insgesamt allerdings wenig originell ist (vgl. Hauschild 2004, 24), hatte Büchner in der Tradition von Kant und Fichte die Französische Revolution gefeiert, welche bewiesen habe, dass nicht nur die Antike vorbildliche „Freiheits-Kämpfe“ kenne: „Ich brauche mein Augenmerk nur auf den Kampf zu richten, der noch vor wenig Jahren die Welt erschütterte, der die [Welt] in ihrer Entwicklung um mehr denn ein Jahrhundert in gewaltigem Schwunge vorwärtsbrachte, der in blutigem aber gerechtem Vertilgungs-Kampfe die Greuel rächte, die Jahrhunderte hindurch schändliche Despoten an der leidenden Menschheit verübte[n], der mit dem Sonnen-Blicke der Freiheit den Nebel erhellte, der schwer über Europas Völkern lag und ihnen zeigte, daß die Vorsehung sie nicht zum Spiel der Willkühr von Despoten bestimmt habe. Ich meine den Freiheits-Kampf der Franken; Tugenden entwickelten sich in ihm, wie sie Rom und Sparta kaum aufzuweisen haben und Thaten geschahen, die nach Jahrhunderten noch Tausende zur Nachahmung begeistern können“ (FA 2,19).
„Bon jour, citoyen“
Zusammen mit dem Klassenkameraden Karl Minnigerode (1814 – 1894), der „sich sehr an politischen Angelegenheiten beteiligte und noch radikaler erschien als Georg Büchner“, träumte der Schüler von der Revolution. Beide begrüßten „sich in der letzten Gymnasialzeit nur mit den Worten […]: Bon jour, citoyen“ (MA 373f.). Überhaupt schienen die von Dilthey so gefürchteten „revolutionären Umtriebe“ auf den Darmstädter Schüler-Zirkel eine erhebliche Anziehung auszuüben: „Allein von Büchners Klassenkameraden, ihn selbst nicht mitgerechnet, wurden acht“ der späteren „Teilnahme an staatsverräterischen Handlungen“ bezichtigt (Hauschild 2004, 29); viele mussten in den 1830er Jahren polizeiliche Verfolgung erleiden und konnten sich zum Teil wenigstens ins Exil retten. „Übrigens sind wir Flüchtigen und Verhafteten gerade nicht die Unwissendsten, Einfältigsten und Liederlichsten! Ich sage nicht zuviel, daß bis jetzt die besten Schüler des Gymnasiums und die fleißigsten und unterrichtetsten Studenten dies Schicksal getroffen hat“, schrieb Georg Büchner in einem Brief an seine Eltern (15. März 1836); dagegen sei es „doch im Ganzen ein armseliges, junges Geschlecht, was eben in [Darmstadt] herumläuft und sich ein Ämtchen zu erkriechen sucht!“ (FA 2,431).
Opposition als Haltung
Kriechertum und Duckmäuserei war Büchners Sache nicht. Ihm konnte „keine äußerliche Autorität noch nichtiger Schein […] imponieren“ (MA 374). „Es fällt mir nicht mehr ein, vor den Paradegäulen und Eckstehern der Geschichte mich zu bücken“, schrieb Büchner im Januar 1834 an seine Verlobte Wilhelmine Jaeglé, kurz bevor er sich anschickte, als revolutionärer Aktivist tätig zu werden. Während der Darmstädter Schulzeit übten die Gymnasiasten die Opposition noch mehr oder weniger spielerisch und vor allem rhetorisch ein (vgl. FA 2,40: „Dieses subjektive ist aber das einzig richtige, widerspricht diesem das objektive, so ist dasselbe falsch“). Das trug der Schule bei Einigen allerdings trotzdem schon den Ruf ein, „eine Vorschule verbotener Verbindungen und Umtriebe“ zu sein (Hauschild 2004, 29). In der Hauptsache schien sich das Aufbegehren aber noch im Rahmen des „jugendlichen Übermuts“ zu bewegen, der im Gottesdienst „statt des jedesmal zu singenden Liederverses halblaut die Worte des Totengräbers im Hamlet sang“ (MA 375), oder in seinem Encyclopädieheft über seinen Lehrer herzog: „O du gelehrte Bestie lambe me in podice. ’s ist scheußlich“, „Dung-Kaute von Gelehrsamkeit“, „wenn ich mir all das Zeug in den Hirnkasten jagen wollt“, „s’ist gar so wichtig, wenn’s nur nicht so langweilig wär“, „Hilf Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen […] will denn die Zeit nicht verrinnen? Die Welt ist stehn geblieben“, „schaudervoll! Gott sei gelobt, es ist das letztemal“ (vgl. Sämtliche Werke und Briefe 1922, 763f., KatM 53, FA 2,48f., Lehmann 2005, 295 – 300).
Geistesbildung: Dichtung und Philosophie
Das Hauptinteresse der Heranwachsenden galt damals noch der gemeinsamen „Geistesbildung“, wozu zwar auch die Aufmerksamkeit für politische und gesellschaftliche Entwicklungen gehörte, noch mehr aber die „philosophierenden Gespräche auf Spaziergängen“ und die „Lektüre großer Dichterwerke“. Der Freund und Klassenkamerad Friedrich Zimmermann (1814 – 1884) erinnerte sich später besonders der Vorliebe für „Shakespeare, Homer, Goethe, alle Volkspoesie, die wir auftreiben konnten, Äschylos und Sophokles; Jean Paul und die Hauptromantiker wurden fleißig gelesen“. Bei aller altersüblichen „Verehrung Schillers hatte Büchner doch vieles gegen das Rhetorische in seinem Dichten einzuwenden. Übrigens erstreckte sich der Bereich des Schönliterarischen, das er las, sehr weit; auch Calderón war dabei. Für Unterhaltungslektüre hatte er keinen Sinn; er mußte beim Lesen zu denken haben. Sein Geschmack war elastisch. Während er Herders ,Stimmen der Völker‘ und ,Des Knaben Wunderhorn‘ verschlang, schätzte er auch Werke der französischen Literatur. Er warf sich frühzeitig auf religiöse Fragen, auf metaphysische und ethische Probleme […]. Für die Antike und das Seelenbezwingende in der Dichtung neuerer Zeiten hatte er die gleiche Empfänglichkeit, übrigens so, daß er sich dem einfach Menschlichen mit Vorliebe zuwandte. Sein mächtig strebender Geist machte sich eigne Wege […]; nur für edlere Genüsse des Geistes und Gemütes hatte er Sinn, das Gemeine stieß er unwillig von sich. Die Natur liebte er mit Schwärmerei, die oft in Andacht gesammelt war. Kein Werk der deutschen Poesie machte darum auf ihn einen so mächtigen Eindruck wie der Faust“ (MA 371).
Jugendgedicht
Eigene literarische Versuche – sieht man einmal ab von den wenigen kindlichen und kaum bemerkenswerten Texten wie beispielsweise dem 1828 verfassten poetischen Weihnachtsgeschenk von G. Büchner für seine guten Eltern (FA 2,15f.); Karl Emil Franzos meinte 1879, „daß sich in dem Knaben noch kein Hauch origineller Dichterkraft geregt“ habe (WK 149) – scheint Büchner in seiner Jugend nicht unternommen zu haben.
„ein gründlicher Beobachter“
1833 schrieb er einem Freund ins Stammbuch: „Verse kann ich keine machen“ (FA 2,467); und auch der enge Freund Friedrich Zimmermann meinte: „Gedichtet hat er, meines Wissens, damals nicht“ (MA 371). Vielmehr zeichnete er sich – so ein anderer Klassenkamerad – als „ein ruhiger, gründlicher, mehr zurückhaltender Beobachter“ aus, der „das Bedürfnis“ hatte, „in das Wesen der Dinge einzudringen“, um „das Lebensbrot der Wahrheit zu erwerben und es andern zu geben“. Triviale Geselligkeit war ihm zuwider. „Er lebte zurückgezogen […] und schien mit der Philosophie, mit sich und der Welt zerfallen.“ Durch sein „Streben nach Wesenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit“ war Büchner „frühe“ in „seinem Denken und Tun […] durchaus selbständig“ geworden: „Das Bewußtsein des erworbenen geistigen Fonds drängte ihn fortwährend zu einer unerbittlichen Kritik dessen, was in der menschlichen Gesellschaft oder Philosophie und Kunst Alleinberechtigung beanspruchte oder erlistete“ (MA 373f.).
„Büchner war uns nicht sympathisch“
Diese Haltung trug ihm später noch gelegentlich den Vorwurf ein, arrogant oder „hochmütig“ zu sein (FA 2,378f.), und der Gießener Kommilitone Carl Vogt (1817 – 1895), der an den gewöhnlichen studentischen „Vergnügungen“ mehr „Geschmack“ fand (ebd.), schrieb in seinen Lebenserinnerungen: „Offen gestanden, dieser Georg Büchner war uns nicht sympathisch. Er […] hielt sich gänzlich abseits, verkehrte nur mit einem etwas verlotterten und verlumpten Genie, August Becker, gewöhnlich nur der ,rote August‘ genannt. Seine Zurückgezogenheit wurde für Hochmut ausgelegt, und da er offenbar mit politischen Umtrieben zu tun hatte, ein- oder zweimal auch revolutionäre Äußerungen hatte fallen lassen, so geschah es nicht selten, daß man abends, von der Kneipe kommend, vor seiner Wohnung still hielt und ihm ein ironisches Vivat brachte […]. Er tat, als hörte er das Gejohle nicht, obgleich seine Lampe brannte und zeigte, daß er zu Hause sei.“ Eine „Annäherung“ sei unmöglich gewesen, „sein schroffes, in sich abgeschlossenes Wesen stieß uns immer wieder ab“ (MA 375f.). Sogar sein Freund Wilhelm Schulz gab zu, dass Büchner sehr ungesellig war und dass sein feineres Wesen von vornherein verhinderte, dass er jemals „mit jedem Kesselflicker in seiner eigenen Sprache zu trinken“ gelernt hätte, wie er mit einer Anspielung auf Shakespeares Henry IV.1 II/4 sagte (Grab 1985, 66).
Vorbereitung auf ein Medizinstudium
Bis zum Ende seiner Schulzeit hatte sich schon der Kreis von Freunden gebildet, aus dem später auch die „1834 gegründeten Gießener und Darmstädter Sektionen der Gesellschaft der Menschenrechte hervorging“ (Dedner 1989, 571), doch zu politischen Aktionen war es noch nicht gekommen. Vielmehr bereitete Büchner sich nach dem Abschluss der Gymnasialzeit auf das „academische Studium der Medicin“ (VIII, 175) vor, wie es der Wunsch seines Vaters war. In dem Abgangszeugnis hielt Carl Dilthey fest: „Bei guten Anlagen läßt sich auch in seinem künftigen Berufsstudium etwas Ausgezeichnetes von ihm erwarten, und von seinem klaren und durchdringenden Verstande hegen wir eine viel zu vortheilhafte Ansicht, als daß wir glauben könnten, er würde jemals durch Erschlaffung, Versäumniß oder voreilig absprechende Urtheile seinem eigenen Lebensglück im Wege stehen“ (MA 370; FA 2,640).
Büchners Vater
Ernst Büchner, 1786 als viertes Kind eines Odenwälder Arztes geboren, hatte seine medizinische Grund-Ausbildung in Holland erhalten und als Militär-Sanitäter fünf Jahre lang in der französischen Armee gedient. Dass er 1810 bei einer Truppenparade in der Nähe von Versailles einmal von Kaiser Napoleon angesprochen wurde („Tu montes bien à cheval; quel age as-tu?“) sei ein unvergessener „Glanzpunkt“ seines Lebens gewesen, erzählte der jüngste Sohn Alexander (vgl. Hauschild 1993, 2f.). Jedenfalls hielt Büchners Vater, der seit 1811 wieder in Hessen lebte, zeitlebens an seiner Napoleon-Verehrung fest und hatte eine generelle Vorliebe für alles Französische (vgl. MA 381).
Immatrikulation in Straßburg 1831
Da auch das wissenschaftliche Niveau der französischen Medizin zu Beginn des 19. Jahrhunderts anerkanntermaßen hoch war, war es sein „Wunsch“ (WK 107), dass der Sohn Georg in Frankreich studieren möge. Für Straßburg sprachen dabei nicht nur fachliche Gründe, sondern auch, dass dort Verwandte der Mutter lebten. Georg Büchner traf dort am 30. Oktober 1831 ein und immatrikulierte sich am 3. November 1831 als Student an der Straßburger Faculté de médecine.
Verlobung mit Wilhelmine Jaeglé 1832
Er wohnte zur Untermiete bei dem verwitweten Pfarrer Johann Jakob Jaeglé (1763 – 1837), mit dessen Tochter Louise Wilhelmine, genannt Minna, er sich im Frühjahr 1832 heimlich verlobte, nachdem sie ihn während einer zweiwöchigen Krankheit (vgl. FA 2,465) mit liebender „Hand“ wieder „erweckt“ hatte (FA 2,380). Erst zwei Jahre später offenbarten die Beiden ihr „stilles Geheimnis“ (383) den Eltern und Verwandten.
Studium in Straßburg
Welche Lehrveranstaltungen Büchner in seinen vier Straßburger Semestern belegte, ist nicht bekannt. Der Schulfreund Georg Zimmermann (1814 – 1881) schrieb später, Büchner hätte vor allem „die naturwissenschaftlichen Vorbereitungs- und Hülfsfächer der Medicin“ – Chemie, Physik, Zoologie, Anatomie, Physiologie (vgl. WK 107) – studiert und sich nur „nebenbei dem Verlangen seines Vaters entsprechend für den Beruf des Arztes“ vorbereitet. Offenbar sagte ihm der ärztliche Beruf „durchaus nicht zu“, sondern „seine Liebe zur Naturwissenschaft“ wurde immer stärker (GBJb 5,334f.). Vor allem aber radikalisierten sich in Straßburg Büchners politische Überzeugungen; er habe aus Straßburg „sehr revolutionäre Ansichten mit zurückgebracht“, erinnerte sich später Theodor Sartorius, ein Gießener Kommilitone Büchners (KatM 156).
Politischer Radikalismus
Seine eher liberal gesinnten Freunde August (1808 – 1884) und Adolph (1810 – 1892) Stöber oder Edouard Boeckel (1811 – 1896) provozierte er mit Auslassungen beispielsweise „über das Unnatürliche unsers gesellschaftlichen Zustandes, besonders in Beziehung auf Reich u. Arm“, oder indem er „Huß, Ravaillac u. Sand […] in eine Reihe“ stellte, wie es in dem Protokoll zur Sitzung vom 28. Juni 1832 der Studentenverbindung „Eugenia“ heißt (GBJb 6, 368). Am 5. Juli „schleuderte“ der „so feurige u so streng republicanisch gesinnte deutsche Patriot“ Büchner, wie es das Sitzungsprotokoll festhält, „einmal wieder, alle mögliche Blitzeu Donnerkeule, gegen alles was sich Fürst u König nennt; u selbst die constitutionelle Verfassung unseres Vaterlands bleibt v ihm nicht unangetastet“ (ebd.). Wie Heinrich Heine stand auch Büchner Anfang der 1830er Jahre „im Bann des republikanischen Kairos“ und wurde „bei der Begegnung mit der republikanischen Bewegung zutiefst von der politischen Programmatik der radikalen französischen Linken geprägt“ (Morawe 2010, 291).
Straßburger „Gesellschaft der Volksfreunde“
Wahrscheinlich hatte Büchner Kontakt mit der Straßburger Sektion der „Société des Amis du peuple“, der „Gesellschaft der Volksfreunde“, einer linksradikalen Vereinigung, in der sich Neojakobiner, Babouvisten und Frühkommunisten zusammengefunden hatten (KatM 94). In Büchners Briefe habe sich, so erinnerte sich Bruder Ludwig (WK 107), „das Bild der damals in Folge der Julirevolution noch tief aufgeregten Zeit“ gespiegelt. Er liebe „die französische Gewitterluft“, bekannte Büchner Anfang November 1832 (FA 2,365). Die realen politischen Zustände in Frankreich seien allerdings „eine Komödie“ und die in Deutschland glichen einer „Satyre auf die gesunde Vernunft“, heißt es in Briefen (365f.).
Legitimität revolutionärer Gewalt
Seiner Familie in Darmstadt gegenüber hielt er im Frühsommer 1833 mit seiner „Meinung“ nicht hinter dem Berg: „Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt. Wir wissen, was wir von unseren Fürsten zu erwarten haben. Alles, was sie bewilligten, wurde ihnen durch die Notwendigkeit abgezwungen. […] Man wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand? Weil wir im Kerker geboren und großgezogen sind, merken wir nicht mehr, daß wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Knebel im Munde. Was nennt Ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein Gesetz, das die große Masse der Staatsbürger zum fronenden Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen? Und dies Gesetz, unterstützt durch eine rohe Militärgewalt und durch die dumme Pfiffigkeit seiner Agenten, dies Gesetz ist eine ewige, rohe Gewalt, angetan dem Recht und der gesunden Vernunft, und ich werde mit Mund und Hand dagegen kämpfen, wo ich kann. Wenn ich an dem, was geschehen, keinen Teil genommen und an dem, was vielleicht geschieht, keinen Teil nehmen werde, so geschieht es weder aus Mißbilligung, noch aus Furcht, sondern nur weil ich im gegenwärtigen Zeitpunkt jede revolutionäre Bewegung als eine vergebliche Unternehmung betrachte und nicht die Verblendung Derer teile, welche in den Deutschen ein zum Kampf für sein Recht bereites Volk sehen. Diese tolle Meinung führte die Frankfurter Vorfälle herbei, und der Irrtum büßte sich schwer. Irren ist übrigens keine Sünde, und die deutsche Indifferenz ist wirklich von der Art, daß sie alle Berechnung zu Schanden macht. Ich bedaure die Unglücklichen von Herzen. Sollte keiner von meinen Freunden in die Sache verwickelt sein? […] Ich werde zwar immer meinen Grundsätzen gemäß handeln, habe aber in neuerer Zeit gelernt, daß nur das notwendige Bedürfnis der großen Masse Umänderungen herbeiführen kann, daß alles Bewegen und Schreien der Einzelnen vergebliches Torenwerk ist. Sie schreiben, man liest sie nicht; sie schreien, man hört sie nicht; sie handeln, man hilft ihnen nicht. Ihr könnt voraussehen, daß ich mich in die Gießener Winkelpolitik und revolutionären Kinderstreiche nicht einlassen werde“ (366f. u. 369).
Frankfurter Wachensturm am 3. 4. 1833
Mit den „Frankfurter Vorfällen“ war der sogenannte Frankfurter Wachensturm vom 3. April 1833 gemeint, eine groß angelegte, aber völlig fehlgeschlagene Aktion der demokratischen Opposition in Hessen. Nach der größten demokratischen Demonstration Deutschlands bis dato, dem sogenannten Hambacher Fest an der Weinstraße Ende Mai 1832 mit rund 40.000 Teilnehmern, hatten die restaurativen Mächte im Deutschen Reich mit scharfen „Maßregeln zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Ordnung und Ruhe in Deutschland“ (Bundestagsbeschlüsse vom 28. Juni und 5. Juli 1832) reagiert und die ohnehin schon geringe Pressefreiheit vollends eingeschränkt, das Versammlungsrecht beschnitten und alle politischen Vereine und Parteien verboten. „Eine Fortsetzung der politischen Arbeit war damit nur noch in der Illegalität, im Untergrund möglich“ (Hauschild 1993, 197).
Opposition in Hessen
In Hessen bereitete ein konspirativer Kreis um den Butzbacher Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig (1791 – 1837), zu dem auch ehemaligen Klassenkameraden Büchners aus Darmstadt gehören, seit Sommer 1832 eine bewaffnete Emeute vor, die zu einem politischen Fanal wenigstens für Südwestdeutschland werden soll. Angesichts des offenen Verfassungsbruchs durch die Regierenden schien den Oppositionellen „jedes Mittel […] zur Herstellung der Volksfreiheit erlaubt“ (Der Wächter am Rhein, Nr. 101, Mannheim, 12. Juli 1832; ebd.). Der Plan war, die Haupt- und die Konstablerwache in Frankfurt am Main zu erstürmen, um „die Soldaten sich vom Halse zu schaffen“ (ebd., 202); anschließend sollte die Delegiertenversammlung des Deutschen Bunds besetzt und die Gesandten als Geiseln genommen werden. „Dies sollte das Signal für eine gleichzeitige bewaffnete Insurrektion in Südwestdeutschland sein.“ Unterstützung würde man „durch elsässische Nationalgardisten, polnische Exiltruppen, Teile des württembergischen Heeres sowie Zehntausende hessischer Bauern“ erhalten, glaubten viele (Hauschild 2004, 40). Die Wachenstürmer hofften, „durch die Macht eines kühnen Beispiels, vielleicht durch einen momentanen kühnen Erfolg, die Trägheitskraft der Massen“ zu überwinden, reflektierte Büchners späterer Freund Wilhelm Schulz (1797 – 1860) die damalige Situation (Grab 1979, 136). Durch Verrat war die Obrigkeit jedoch gewarnt; außerdem war es eine „knabenhafte Einbildung“, wie man am 9. April 1833 im Frankfurter Journal lesen konnte, zu glauben, dass man eine Volksrevolution durch einen lokalen Putsch initiieren konnte.
Indifferenz der Bevölkerung
Die „Indifferenz“ – wie Büchner es nannte – der Bevölkerung war zu groß, „die Umstehenden“ blieben, wie es in einem Polizeibericht heißt, „ruhige Zuschauer“ (Görisch/Mayer 1982, 100). Binnen einer Stunde hatte das Militär mit dem Putsch aufgeräumt. „So war der Wachensturm zwar die spektakulärste Aktion der Republikaner zwischen dem Hambacher Fest und der Revolution von 1848, er blieb jedoch ohne fruchtbare Resultate und schadete der Opposition mehr als daß er ihr nutzte“ (Hauschild 1993, 203). Die Regierungen des Deutschen Bundes installierten sofort eine „Zentralbehörde“, die im nächsten Jahrzehnt sämtliche politischen Polizeiaktionen und Repressalien gegen die Opposition koordinierte und durch keine kleinstaatlichen Grenzen mehr behindert wurde.
Studium in Gießen
Büchner hatte die Ereignisse in Deutschland aufmerksam verfolgt, nicht zuletzt weil er ab Wintersemester 1833 / 34 sein Studium an der großherzoglich-hessischen Landesuniversität in Gießen fortsetzen und abschließen musste, wollte er ein in der Heimat anerkanntes Diplom erwerben. Seit August 1833 war er wieder zurück in Hessen, zunächst im Elternhaus, ab Oktober in Gießen. Die „Erinnerung an 2 glückliche Jahre“ in Straßburg, „und die Sehnsucht nach all dem, was sie glücklich machte“ verleidete ihm „die widrigen Verhältnisse“, unter denen er in Hessen lebe, zusätzlich. „Hier ist Alles so eng und klein“, schrieb er an den Freund August Stöber (9. Dezember 1833): „Natur und Menschen, die kleinlichsten Umgebungen, denen ich auch keinen Augenblick Interesse abgewinnen kann“ (FA 2,375). Schon Ende August hatte er an Edouard Boeckel geschrieben: „Eltern und Geschwister wiederzusehen, war eine große Freude; das entschädigt aber nicht für meine sonstigen furchtbar, kolossal, langweiligen Umgebungen. Es ist etwas großartiges in dieser Wüstenei, die Wüste Sahara in allen Köpfen und Herzen“ (371).
Als Rekonvaleszent im Elternhaus zum Jahreswechsel 1833 / 34
Zudem bekam Büchner in Gießen „einen Anfall von Hirnhautentzündung“, der ihn schon im November zwang, ins Elternhaus „zurückzukehren um mich daselbst völlig zu erholen“ (376). Vielleicht war die Erkrankung mit bedingt durch die auf ihm lastende Erwartung, nunmehr auch „mit der praktischen Medizin“ (MA 394) sich befassen zu sollen.
Studium der Philosophie sowie der Revolutionsgeschichte
Im Freundeskreis allerdings war es wohl schon länger bekannt, dass Büchner sich für „die praktische Medizin nicht interessiert“ hat (FA 2,461). Wahrscheinlich gelang es dem „Reconvaleszenten“ (FA 2,376) zu Hause, die Eltern endgültig davon zu überzeugen, dass er nicht zum Arzt, sondern zum Naturforscher berufen sei; ein fortdauernder Konflikt wegen des Wechsels der Studienrichtung scheint in die biografische Legende zu gehören, die freilich von Ludwig Büchner (1850; WK 107 – 134) bis Jan-Christoph Hauschild (1993; 2004) immer wieder gern erzählt wurde (vgl. VIII, 176f.). Schon in Darmstadt hatte Büchner sich jedenfalls „mit aller Gewalt in die Philosophie“ geworfen (ebd.), zurück in Gießen studierte er im Januar 1834 außerdem „die Geschichte der Revolution“ (FA 2,377).
Friedrich Ludwig Weidig
Anders als er es den Eltern 1833 versprochen hatte, hielt er sich nicht vom politischen Untergrund fern. Er hatte Friedrich Ludwig Weidig und andere hessische Revolutionäre kennen gelernt und versuchte, durch das Studium der Geschichte der Französischen Revolution die Probleme der revolutionären Bewegungen im Europa und Deutschland der 1830er Jahre zu verstehen.
Kontinuität der Revolution seit 1789
Für die oppositionellen Intellektuellen stand der Zusammenhang zwischen der eigenen Gegenwart mit dem Aufbruch von 1789 außer Frage. „Der heutige Tag ist ein Resultat des gestrigen. Was dieser gewollt hat, müssen wir erforschen, wenn wir zu wissen wünschen, was jener will. Die Revolution ist eine und dieselbe“ (HSS 3,166), meinte Heinrich Heine (1797 – 1856). Heinrich Laube (1806 – 1884) fasste diese Verbindung mit dem Buchtitel Die französische Revolution. Von 1789 bis 1836 (Berlin 1836) in die denkbar kürzeste Formel.
Gründung eines politischen Geheimbunds in Gießen 1834
Er schäme sich, so schrieb Büchner seinen Eltern im März 1834, „ein Knecht mit Knechten“ zu sein. Er war davon überzeugt, dass „die politischen Verhältnisse“ nicht nur ihn „krank“ machten (FA 2,386). Er gründete in Gießen mit August Becker (1814 – 1871) einen politischen Geheimbund, der später „Gesellschaft der Menschenrechte“ genannt wurde und dem unter anderem auch die Darmstädter Schulkameraden Karl Minnigerode, Jacob Koch (1815 – 1852) und später Hermann Wiener (1813 – 1897) beitraten, dazu kamen sowohl Wachenstürmer wie Gustav Clemm (1814 – 1866) und Hermann Trapp (1813 – 1837) als auch Handwerker wie die Küfer Georg Melchior Faber und David Schneider (vgl. Görisch/Mayer 1982, 331).
Agitation für die Revolution
Als erstes hatte Büchner eine Flugschrift entworfen, mit der die ausgebeutete Mehrheit der Bevölkerung, besonders die kleinen Handwerker und Bauern, für die Revolution gewonnen werden sollte, „was vor der Hand nur durch Flugschriften geschehen“ könne, so gab August Becker später die Argumentation Büchners in einem Verhör wieder: „Soll jemals die Revolution auf eine durchgreifende Art ausgeführt werden, so kann und darf das bloß durch die große Masse des Volkes geschehen, durch deren Ueberzahl und Gewicht die Soldaten gleichsam erdrückt werden müssen“ (FA 2,659).
Weidigs Doppelstrategie
Während Weidig mit einer Flugschriften-Serie unter dem Titel Leuchter und Beleuchter für Hessen oder der Hessen Nothwehr, die zwischen Januar und Oktober 1834 in fünf je vierseitigen Blättern erschien (faksimiliert in: Weidig 1987, 85 – 104), „die gebildeten Stände“ (Mathis 1839, 62) der Opposition mit politischen Reflexionen und Nachrichten zu gewinnen suchte, sollte Büchner – so war es mit Weidig verabredet – ein Flugblatt entwerfen, das „die niederen Volksklassen“ (Görisch/Mayer 1982, 340) zu agitieren in der Lage war.
Büchners Predigt gegen den Mammon
Büchners Entwurf war Weidig dann allerdings einerseits zu radikal, weil er gegen alle, auch die politisch liberal gesinnten „Reichen“, polemisierte, andererseits schien der Text für Weidigs Geschmack noch nicht politisch genug, da er zu wenig auf die „constitutionelle“ Wirklichkeit Hessens bezogen war. Büchners Entwurf sei „eine schwärmerische, mit Beispielen belegte Predigt gegen den Mammon, wo er sich auch finde“, gewesen, urteilte Becker, der den Text aus Büchners schwer lesbarer Handschrift ins Reine geschrieben hatte, rückblickend (FA 2,662f.). Weidig überarbeitete daher den Text, damit er die „vortrefflichen Dienste“ tun könne, die man von ihm erhoffte, und organisierte den Druck bei dem Offenbacher Kleinverleger Carl Preller (1802 – 1877).
Büchners Radikalität
Büchner, der sich damals sehr fundamentalistisch gebärdete und mit Weidigs kompromissbereiter Haltung (FA 2,662: man müsse „auch den kleinsten revolutionären Funken sammeln“ und „unter den Republikanern republikanisch und unter den Constitutionellen constitutionell“ sein) „sehr unzufrieden“ war, befand sich unterdessen wieder in Straßburg, wo er mit seiner Verlobten ,ein bisschen in Romantik machen wollte‘, wie er ihr brieflich ankündigte (FA 2,384: „Nous ferons un peu de romantique…“). Dass er seinen Eltern den Grund für sein „Ausbleiben“ in den Semesterferien zunächst nicht verraten habe, sei wenig lebensklug gewesen, meinte sein Onkel Georg Reuß, der den Neffen auf gut hessisch für einen wenn auch gelehrten „Schussel“ hielt (385). Büchner entschuldigte sich mit seiner „Schwermut“ (ebd.), für die er nur bei der, wie nun bekannt gegeben wurde, Verlobten hätte Heilung finden können. Ob seine Reise auch zur Tarnung konspirativer Tätigkeiten diente, ist nicht bekannt. Jedenfalls beschäftigte sich Büchner in Straßburg nicht nur mit seiner Verlobten, sondern auch mit Statut und Programm der französischen „Société des Droits de l’homme et du citoyen“, die für den eigenen Geheimbund auch in der Namensgebung vorbildlich wurde (vgl. Mayer 1979b, 376).
Gründung einer „Gesellschaft für Menschrechte“ in Darmstadt 1834
Im April gründete er aus Straßburg kommend in Darmstadt eine eigene Sektion der „Gesellschaft der Menschenrechte“, bevor er Ende April sein Studium in Gießen wieder aufnahm und zugleich die Gießener Sektion seiner geheimen Gesellschaft reorganisierte.
Geheime Versammlung der Opposition auf der Badenburg
Anfang Juli nimmt Büchner an der von Weidig initiierten „zentralen Versammlung der hessen-darmstädtischen und kurhessischen Demokraten zur Gründung eines geheimen ,Preßvereins‘ für die Volksagitation durch Flugschriften“ auf der Badenburg bei Gießen (ebd., 380) teil. Weidig propagierte hier sein doppelgleisiges Vorgehen und holte sich „ein verbindliches Plazet“ für die von ihm überarbeitete Flugschrift, die den Namen Der Hessische Landbote erhielt. Büchner störte sich an der Zurückhaltung der bürgerlichen Demokraten vor allem aus Marburg; er hielt sie für „undisciplinirte Liberale“, mit denen man keine Revolution machen könne. Er erzählte seinem Freund Becker hinterher äußerst „ungehalten“, dass „auch die Marburger Leute seien, welche sich durch ein Ammenmährchen, hätten erschrecken lassen, daß sie in jedem Dorf ein Paris mit einer Guillotine zu sehen fürchteten usw. (FA 2,666).
Differenzen zwischen Liberalen und Radikalen
Die Versammlung gab dem „Spötter“ (FA 2,379) Büchner „unerschöpflichen Stoff zur Satyre“ (Mayer 1979b, 381). Den verspotteten Marburgern dagegen kam der radikale Student aus Gießen zu unreif und „zu extravagant“ (Görisch/Mayer 1982, 341) vor, als dass man seinen Konzepten hätte bedenkenlos folgen können; der Marburger Arzt Leopold Eichelberg (1804 – 1879) meinte später: „Büchner schien mir die mit aller Vehemenz übersprudelnde jugendliche Kraft welche sich hier im Zerstören gefiel während sie sonst eben so leicht die ganze Welt liebend zu umarmen sucht“ (KatD 173). Dagegen schrieb der politische Publizist Wilhelm Schulz 1851: „In der Politik scheint Büchner keine Kinderjahre gehabt zu haben. Das Studium der Geschichte der französischen Revolution hatte frühe sein Urtheil gereift“ (Grab 1985, 70), was ihn vor manchen „Täuschungen“ bewahrt hätte, „welchen sich die Jugend“ sonst „willig hinzugeben pflegt“ (ebd., 141).
Erster Druck des Hessischen Landboten
Obwohl die Gießener ,Gesellschafter‘ mit ihren radikalen Forderungen an den Bedenklichkeiten der älteren Liberaldemokraten scheiterten, unterstützten sie weiter Weidigs Projekt einer parallelen Agitation der gebildeteren und der „niederen Volksklassen“ (FA 2,666) respektive der „mehr“ oder „weniger Intelligenten“ mittels „Blätter verschiedener Art“ (ebd., 670). Büchner und der Mitverschworene Friedrich Jakob Schütz (1813 – 1877) brachten selbst Weidigs Manuskript Anfang Juli in die Offenbacher Druckerei; Ende Juli konnten Schütz, Minnigerode und Carl Zeuner (1812– um 1880) die gedruckte Auflage von vermutlich rund 1.000 Exemplaren abholen. Aufgrund einer Denunziation – Verräter war der zum Weidig-Kreis gehörende, der Regierung Spitzeldienste leistende Butzbacher Kaufmann Johann Konrad Kuhl (1794 – 1855) – wurde Minnigerode am 1. August 1834 bei dem Versuch, 139 Exemplare an der Gießener Torwache vorbeizuschmuggeln, verhaftet.
Verfolgung der hessischen Opposition
Bei der nun folgenden Verfolgung und Aushebung der illegalen hessischen Opposition hatten die Behörden „jedoch offenbar keine Eile, unmittelbar zuzufassen“. Sie sammelten „unablässig Erkenntnisse“ und zogen „das Netz immer enger“ (Mayer 1987, 185). Viele der Verschworenen wähnten sich nicht in Gefahr, so auch Büchner: „Ich gehe meinen Beschäftigungen wie gewöhnlich nach, vernommen bin ich nicht weiter geworden. […] Es geht hieraus hervor, daß ich durch nichts compromittiert bin“, schrieb er am 8. August 1834 an seine Eltern (FA 2,388f.). Zwar gab es einen behördeninternen Steckbrief und es hatte es am 4. August 1834 eine Haussuchung in seiner Studentenbude gegeben, weil die Polizei sehr richtig annahm, dass eine plötzliche Reise nach Offenbach und Frankfurt im „Zusammenhang mit der Verhaftung Minnigerode’s“ (FA 2,387) stehe, doch konnten die Behörden zunächst nicht genug Belastendes finden. Der Universitätsrichter Georgi verzichtete auf eine Verhaftung Büchners, obwohl er mindestens ahnte, warum Büchner „verkleidet in geheimen Aufträgen zu Offenbach war“, wie es in einer Verhöraussage heißt (Mayer 1979b, 387). Allerdings hatten die Behörden zu dem Zeitpunkt noch nichts gerichtlich Verwertbares in der Hand, da man die Quelle (den Verräter Kuhl) noch decken wollte.
Erfolg des Hessischen Landboten
Soweit nicht beschlagnahmt, wurde die Auflage des Hessischen Landboten wie geplant verteilt und fand bei den Adressaten großen Anklang. Eichelberg sprach „von der guten Wirkung, die der Landbote“ beispielsweise „unter den kurhessischen Bauern der Umgegend“ von Marburg gehabt habe; auch Weidig berichtete von Bauern, „auf welche der Landbote einen ungewöhnlichen Eindruck gemacht habe“ (Mayer 1987, 180). Beide organisierten daher im November 1834 den Druck einer zweiten Auflage der Flugschrift im Marburger Verlag von Noa Gottfried Elwert.
Aufenthalt in Darmstadt ab Herbst 1834
Büchner war im September von Gießen nach Darmstadt zurückgekehrt, wohin auch seine Verlobte Wilhelmine Jaeglé gekommen war. Außerdem belebte er die dortige Sektion der „Gesellschaft der Menschenrechte“ wieder. Man debattierte über Menschenrechte und politische Grundsätze, übte „sich sehr eifrig in den Waffen“, verbarg „Schießvorräthe“ (WK 117), sammelte Geld für eine Druckerpresse und bereitete die Befreiung politischer Gefangener wie Minnigerode und Zeuner in Friedberg (vgl. MA 380) sowie des „wegen fortgesetzten Versuchs des Verbrechens einer gewaltsamen Veränderung der Staatsverfassung“ (Grab 1979, 132) seit Juni 1834 inhaftierten Journalisten Friedrich Wilhelm Schulz (1797 – 1860) in Babenhausen vor. Inzwischen war übrigens der jüngere Bruder Wilhelm Büchner (1816 – 1892), damals Apothekerlehrling, mit von der Partie. Warum Georg Büchner nicht zum Wintersemester nach Gießen zurückkehrte, ist nicht völlig klar. Sein Bruder Ludwig erklärte später, Georg sei „auf Wunsch seines Vaters im elterlichen Haus in Darmstadt“ geblieben und habe in dessen privatem Institut für unbemittelte künftige Wundärzte (vgl. VIII, 188) und unter dessen Anleitung „Vorlesungen über Anatomie für junge Leute“ gehalten, „die sich für das Studium vorbereiteten“ (WK 116).
Vorbereitung auf die Promotion; Danton’s Tod
Büchner sollte sich nach dem Wunsch der Eltern sowohl von den revolutionären Aktivisten fernhalten als auch seine Promotion vorbereiten, darf man wohl annehmen. Während der Vater auf Beschäftigung mit Gegenständen der vergleichenden Anatomie drang, studierte der Sohn auch und abermals die Geschichte der Revolution und stürzte sich erneut in die Philosophie, wie wir aus inzwischen verbrannten Ausleihlisten der Darmstädter Bibliothek wissen: Thiers’ Histoire de la Révolution Française und Tennemanns Geschichte der Philosophie machten im Oktober 1834 den Anfang (WK 482). Anders als zu Jahresbeginn aber versank Büchner dabei nicht in Schwermut, sondern wurde in unerwarteter Weise produktiv: Aus dem Leser wurde ein Autor. Seine Lektüre nicht nur der letzten Monate, sondern seit seiner Schulzeit verwandelte Büchner im Januar und Februar 1835 in einen „dramatischen Versuch“ über einen „Stoff der neueren Geschichte“ (FA 2, 391): Danton’s Tod.
Geburt eines Autors
Gelegentlich wurde spekuliert, dass Büchner zum Literaten wurde aus Enttäuschung über das Scheitern seines aktiven politisch-revolutionären Engagements. Weil „er alle seine politischen Hoffnungen in Bezug auf ein Anderswerden“ der Verhältnisse aufgegeben habe (FA 2,665), habe er dichterisch „das Sterben der gesamten Revolution“ gestaltet, nicht nur als Therapie der eigenen „Depression über den politischen Mißerfolg und quälender Furcht vor der Verhaftung“, also als Ausdruck „des Scheiterns eines einzelnen Revolutionärs“, sondern objektiviert als „Ausdruck einer ganzen gescheiterten Revolution“ (Mayer 1946, 184f.). Diese Annahme scheint mir aber in gewisser Weise Ursache und Wirkung zu vertauschen.
Literarische Reflexion politischer Praxis
Vielmehr wurde Büchner die literarische Bearbeitung einer bestimmten Phase der Französischen Revolution zum Medium der Reflexion über die revolutionäre Praxis seiner Gegenwart, die ihn einer schon früher gehegten Meinung versicherte. Im April 1833 schrieb Büchner, dass er „im gegenwärtigen Zeitpunkt jede revolutionäre Bewegung als eine vergebliche Unternehmung betrachte“ (FA 2, 367), nach Abschluss der Arbeit an Danton’s Tod aber war er „vollkommen überzeugt, daß Nichts zu tun ist, und daß Jeder, der im Augenblicke sich aufopfert, seine Haut wie ein Narr zu Markte trägt“; „an die Möglichkeit einer politischen Umwälzung“ sei „jetzt“ schlechterdings „nicht“ zu „glauben“, wie es in einem vermutlich Ende Juli/Anfang August 1835 geschriebenen Brief heißt: „Hoffen wir auf die Zukunft!“ (FA 2, 402 u. 458; zur Datierung vgl. Gillmann u.a. 1993, 43).
Büchners Flucht 1835
Während Büchner sich dichterisch über seine Situation klarer zu werden suchte, zog sich in der Tat „das Netz der gerichtlichen Untersuchung auch über ihm zusammen“ (Mayer 1946, 183). Gegenüber Karl Gutzkow (1811 – 1878) soll er gesagt haben: „Für Danton sind die Darmstädtischen Polizeidiener meine Musen gewesen“ (WK 118). Er muss über die Fortgang der Untersuchungen einigermaßen informiert gewesen sein, denn noch vor dem entscheidenden Verrat ausgerechnet des bei seinen Genossen als „Revolutionair par consequence“ (KatD 173) geltenden Gustav Clemm Ende März 1835 floh Büchner am 5. oder 6. des Monats Richtung Straßburg. Am 9. März hat er die französische Grenze passiert und schrieb seinen Eltern: „Ihr könnt, was meine persönliche Sicherheit anlangt, völlig ruhig sein. […] Nur die dringendsten Gründe konnten mich zwingen, Vaterland und Vaterhaus in der Art zu verlassen… Ich konnte mich unserer politischen Inquisition stellen; von dem Resultat einer Untersuchung hatte ich nichts zu befürchten, aber Alles von der Untersuchung selbst“ (FA 2,396). Büchner hatte schon das Resultat der Untersuchung sehr wohl zu fürchten, noch mehr aber wohl tatsächlich diese selbst. Sein Freund Minnigerode widerstand „der langsamen Folter“ (399) einer „sehr langwierigen Untersuchung“ (Görisch/Mayer 1982, 346) kaum und wurde „körperlich und geistig zerrüttet“ (FA 2,396), ja fast „tödlich krank“ (412) im Mai 1837 entlassen (vgl. FA 2, 1216f.). Weidig, der wie August Becker und andere im April 1835 verhaftet worden war, trieben die Haftbedingungen und die Untersuchungsmethoden im Februar 1837 zur Selbsttötung in seiner Gefängniszelle (vgl. Wilhelm Schulz: Der Tod des Pfarreres Dr. Friedrich Ludwig Weidig. Zürich 1843). Leopold Eichelberg, der damals gleichfalls verhaftet worden war, saß von „allen Inhaftierten […] am längsten (von April 1835 bis März 1848), und zwar in Einzel-, z. T. Dunkelhaft, in verschiedenen Gefängnissen und Zuchthäusern Kurhessens“ (KatM 147). „Ich danke dem Himmel, daß ich voraussah, was kommen würde“, bekannte Büchner (FA 2,412), „man würde mich auf keinen Fall verschont haben“ (402), „ich wäre in so einem Loch verrückt geworden“ (412f.). „Mich schaudert, wenn ich denke, was vielleicht mein Schicksal gewesen wäre!“ (417).
Debüt auf dem Buchmarkt
Büchners Exil ließ zwar seine „Zukunft […] problematisch“ erscheinen, setzte aber auch „Kräfte“ frei (FA 2,397). Er hatte kurz vor seiner Flucht erfolgreich Kontakte zu dem Frankfurter Verlager Johann David Sauerländer und dem Publizisten Karl Gutzkow geknüpft und sein Drama Danton’s Tod untergebracht. Zugleich übernahm er von Sauerländer den Auftrag, zwei Dramen Victor Hugos für eine geplante Werkausgabe des französischen Dichters zu übersetzen (BHb 45) und von Gutzkow die Anregung, „Kritiken über neueste franz[ösische] Literatur“ (FA 2,401) und eine „Novelle Lenz“ (405) zu schreiben. Gutzkow versprach ihm „Alles“, was es auch sei, unterzubringen (401). Diese Situation schien Büchner geeignet, wenigstens seine Eltern vorerst zu beruhigen: „Jedenfalls könnte ich von meinen schriftstellerischen Arbeiten leben“, schrieb er an sie, versprach ihnen aber zugleich, seinen spätestens zum Jahreswechsel 1833 / 34 gemeinsam besprochenen „Studienplan nicht aufzugeben“ (402).
Priorität des Studiums
Dieser Plan sah vor, „das Studium der medicinisch-philosophischen Wissenschaften mit der größten Anstrengung [zu] betreiben“, weil „auf dem Felde […] noch Raum genug“ sei, „um etwas Tüchtiges zu leisten und unsre Zeit ist grade dazu gemacht, dergleichen anzuerkennen“ (397). In der Tat hatte das Studium für Büchner gegenüber den literarischen Arbeiten Priorität. Gutzkow klagte schon bald, dass Büchner sich ihm gegenüber „in ein nebelhaftes Schweigen hülle“ (414) und dann sogar einen Korb wegen der Mitarbeit an seinem Zeitschriftenprojekt Deutsche Revüe gab (417). Doch das „Studium der Philosophie“ (420) und der „Medizin“ (430) beschäftigten ihn vollauf, besonders dann die zum „Diplom“ führende „Abhandlung“, über der er „Tag und Nacht“ gesessen habe, wie er nach einer Periode sehr langen Schweigens Anfang Juni 1836 an Gutzkow schrieb: Die „Leute“ seien schließlich „gar nicht geneigt“ gewesen, seinem „lieben Sohn Danton den Doktorhut aufzusetzen“ (439).
Theoretische Naturwissenschaft statt praktische Medizin
Zwar hatte sich Büchner dem ursprünglichen Wunsch des Vaters entsprechend sowohl 1831 in Straßburg als auch 1833 in Gießen an der medizinischen Fakultät immatrikuliert – anfänglich vielleicht wirklich mit dem Vorhaben, „die Arzeneykunst“ (FA 2,441) zu studieren –, er bemerkte aber schon bald, dass seine Neigung mehr den „naturwissenschaftlichen Studien“ (WK 122f.), namentlich „der Zoologie und der vergleichenden Anatomie“, und der „Philosophie“ galt (MA 394). In Straßburg schon zeichnete sich dabei ein Muster ab, das sich in Gießen wiederholen sollte: Büchner besuchte Lehrveranstaltungen, die zwei konkurrierende wissenschaftliche Methoden lehrten, nämlich zum einen die empirisch-beschreibende Analyse der belebten Natur und zum anderen die naturphilosophisch-spekulative Naturbetrachtung.
Zwei naturwissenschaftliche Schulen
Mit den beiden Professoren George-Louis Duvernoy (1777 – 1855) und Ernest-Alexandre Lauth (1803 – 1837) hatte Büchner, der beide im Juni 1835 als besondere Unterstützer erwähnte (FA 2,407), exponierte Vertreter dieser Richtungen schon bei seinem ersten Straßburger Aufenthalt kennen gelernt.
George-Louis Duvernoy
Ernest-Alexandre Lauth
Duvernoy war als Schüler und späterer Nachfolger des berühmten Pariser Zoologen und Paläontologen Georges Cuvier (1769 – 1832) ein dezidierter Gegner jeder naturphilosophischen Spekulation und verlangte stattdessen eine jederzeit verifizierbare Beschreibung einzelner Tatsachen; Lauth dagegen vertrat als Schüler Karl-Heinrich Ehrmanns (1792 – 1878) die Tradition der „ächten Naturphilosophie“, welche die einzelnen Beobachtungen in einem sinnvollen Ganzen zu bündeln suchte, das „jenseits der Tatsachen“ („au-delà des faits“) nur spekulativ erschließbar, weil nicht experimentell überprüfbar sei und uns daher nur durch Wahrscheinlichkeit, niemals aber durch Gewissheit überzeugen könne („qui peut […] nous fournir des probabilités, mais la certitude, jamais“) (vgl. Roth 2004, 29). Andererseits sollte man sich die Kluft zwischen beiden Wissenschaftsrichtungen nicht als unüberbrückbar vorstellen. Duvernoys Beobachtungen bildeten kein zusammenhangsloses Aggregat, da der Zusammenhang in seinen Augen durch den göttlichen Schöpfungsplan gegeben war und weil er sie selbstverständlich auch zu systematisieren suchte, wenn auch nicht in Hinsicht auf die „unité de plan“, sondern hinsichtlich des Darstellungsmodus. Lauth hingegen betonte trotz der methodischen Orientierung an der Naturphilosophie Schellingscher Provenienz die empirische Basis jeder wissenschaftlichen Spekulation, die erst dann einsetzen dürfe, wenn gegenwärtig verfügbare wissenschaftliche Verfahren („dans l’état actuel de la science“) ein genaueres Experiment nicht mehr zuließen. Lauths handwerkliche Fähigkeiten waren berühmt, er galt als bester Anatom Straßburgs und Büchner, der darin auch eine ungemeine Fertigkeit besaß, dürfte bei ihm Präparieren gelernt haben. Überhaupt scheint Lauth anfänglich Büchner näher gestanden zu haben als Duvernoy, der persönlich allerdings auch der unangenehmere Charakter gewesen zu sein scheint (vgl. Roth 2004, 33; WK 108; FA 2,362f.).
Friedrich Wernekinck
In Gießen begegnete Büchner abermals beiden Wissenschaftsrichtungen, wenn auch klarer geschieden. Bezeugt ist Büchners Teilnahme an den Kollegstunden von Friedrich Wernekinck (1798 – 1835), der ebenfalls eine bemerkenswerte „Geschicklichkeit und Gewandtheit im Präpariren feinerer Gegenstände“ besaß und die vergleichende Anatomie unter anderem nach Cuvier lehrte. Sein Spezialgebiet war die menschliche Neurologie, „die Anatomie des Gehirnsystems, der Sinnesorgane und ihrer Entwicklungsgeschichte“ (VIII, 186), so dass die Vermutung naheliegt, Büchner – dessen fachliche Diskussionen mit Wernekinck den Kommilitonen „Respekt einflößten“ (MA 376) – habe die „Anregung zur genaueren Beschäftigung mit der Anatomie des Zentralnervensystems“, um das es in seiner Dissertation geht, durch diesen Hochschullehrer empfangen (Döhner 1967, 45), zumal das Thema der Doktorarbeit relativ nah an das einer Lehrveranstaltung Wernekincks im Wintersemester 1833 / 34 anschließt (vgl. VIII, 187).
Johann Bernhard Wilbrand
Die spekulative Naturphilosophie begegnete Büchner in Person Johann Bernhard Wilbrands (1779 – 1846), der den Lehrstuhl für vergleichende Anatomie, Physiologie und Naturgeschichte innehatte und den Büchner in der Person des Doktors (deren Gestaltung freilich auch Züge von Selbstironie aufweist) im Woyzeck karikiert haben soll.
Joseph Hillebrand
Wichtiger für Büchner war aber wahrscheinlich die philosophische Ergänzung der empirischen Studien bei Wernekinck durch die schulphilosophischen Reflexionen in den Kollegs („Logik“, „Naturrecht“) von Heinrich Joseph Hillebrand (1788 – 1871), die Büchner nachweislich besuchte.
Hugo-Übersetzungen
Schon in Gießen scheint Büchner in seinem Studium nach insgesamt sechs Semestern einen Stand erreicht zu haben, der es erlaubt, ihn nach heutigen Begriffen als Doktorand anzusprechen. Auch deshalb war es wohl nicht unbedingt nötig, dass er im Wintersemester 1834 / 35 wieder Lehrveranstaltungen in Gießen besuchte. Während des zweiten Straßburgers Aufenthalts konzentrierte sich Büchner dann zunehmend auf den Abschluss seiner naturwissenschaftlichen und philosophischen Studien. Anfänglich verfolgte er wohl auch noch die Option, als freier Schriftsteller seine Existenz zu sichern.
Erzählfragment Lenz
Im Sommer 1835 entstanden die beiden Hugo-Übersetzungen und vielleicht auch schon einige kritische Bemerkungen zu französischen Neuerscheinungen, mit denen Gutzkow dann aber doch nicht viel anfangen konnte (FA 2,404: „Ihre Äußerungen über neure Lit. vermag ich nicht aufzunehmen, weil mir jetzt die Muße fehlt“), im Herbst das Fragment zu einer Lenz-Novelle, die Büchner nach dem Ende von Gutzkows Zeitschriftenplan nicht weiter ausarbeitete. Wissenschaftlich scheint für Büchner jetzt Duvernoy der wichtigste Lehrer geworden zu sein, der wohl auch seine Doktorarbeit hauptsächlich betreute.
Dissertationspläne
In seinen Leçons sur l’histoire naturelle des corps organisés (1839; VIII, 611) lobte Duvernoy die Arbeit Büchners ausdrücklich („beau travail“) und bezeichnete den Verstorbenen als seinen Schüler („mon élève“). Dieser schwankte allerdings noch im Oktober 1835, ob seine Dissertation „einen philosophischen oder naturhistorischen Gegenstand“ behandeln sollte (FA 2,419). Der am 31. Dezember 1834 aus dem Babenhausener Gefängnis entflohene Wilhelm Schulz, mit dem sich Büchner nach seiner eigenen Flucht 1835 in Straßburg anfreundete und mit dem er in Zürich, wo Schulz seit Juni 1836 lebte, bis zu seinem Tod in einem Haus wohnte, erinnerte sich 1837, dass Büchner „mit rastlosem Eifer“ gleichermaßen sich „dem Studium der neueren Philosophie“ und der „Naturwissenschaften“ widmete.
Abhandlung Sur le système nerveux du barbeau
Im Spätherbst war jedoch die Entscheidung zugunsten eines zoologischen Themas gefallen, da Büchner laut Schulz im „Dezember 1835“ mit „Vorarbeiten für seine Abhandlung: ,Sur le système nerveux du barbeau‘“ begonnen habe (MA 394). Initialzündung war laut der biografischen Skizze seines Bruders die „Entdeckung einer früher nicht gekannten Verbindung unter den Kopfnerven des Fisches“ (WK 123); überdies hatte sich die Aussicht ergeben, mit einer entsprechenden Abhandlung in Zürich promovieren zu können, wobei sich der ins Auge gefasste Zeitplan (FA 2,419: „Es wäre möglich, daß ich noch vor Neujahr von der Züricher Facultät den Doctorhut erhielte“) nicht halten ließ. Während der Arbeit an seiner Dissertation, die ihm im Winter 1835 / 36 „fast ausschließlich“ beschäftigte, wobei Büchner „meist anhaltend von Morgens früh bis um Mitternacht“ zu arbeiten pflegte (WK 123), weitete sich der ursprünglich ins Auge gefasste Plan, eine „comparative Deutung“ des „nervus recurrens des Trigeminus bei den Cyprinen“ zu geben (Johannes Müller 1837; VIII, 600), zu einer weiter angelegten Untersuchung aus, die außerdem noch das „Verhältnis der Hirnnerven zu den Spinalnerven, zu den Schädelwirbeln und zu den Anschwellungen des Gehirns“ und die Frage nach den „Gesetze[n], nach denen ihre Zahl zu- oder abnimmt, ihre Aufteilung komplexer oder einfacher wird“, klären sollte (VIII, 5). Dass all das nicht mehr im Wintersemester zu schaffen war, wurde Büchner wohl erst Ende Januar 1836 klar.
Öffentlicher Vortrag der Forschungsergebnisse 1836
„Im März 1836“ war die erste Fassung von Büchners Abhandlung fertig (WK 124), die er an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen der Straßburger Naturforschenden Gesellschaft zwischen dem 13. April und 4. Mai 1836 vortrug und anschließend für den Druck überarbeitete. „Erst gestern ist meine Abhandlung vollständig fertig geworden“, schrieb Büchner am 1. Juni 1836 an seinen Freund Eugène Boeckel, nachdem er das Manuskript für den Druck dem Redaktionskomitee der Mémoires de la Société du Muséum d’histoire naturelle de Strasbourg übergeben hatte: „Es ist mir unendlich wohl, seit ich das Ding aus dem Haus habe“, erklärt Büchner daraufhin erleichtert (FA 2,436f.). Er freute sich auf einen Besuch seiner Mutter und seiner Schwester Mathilde im Herbst, literarische Beschäftigung und mehr „Gemächlichkeit“ bei den kommenden akademischen Arbeiten (vgl. ebd. sowie WK 125).
Neue Dramenpläne
Die „Freude am Schaffen meiner poetischen Produkte“, von der Büchner in einem Brief an seine Verlobte einmal sprach (FA 2,465), musste er den ganzen Winter 1835 / 36 und das folgende Frühjahr entbehren: „Schreiben habe ich die Zeit nichts können“ (437). Das aber wollte er ab Juni 1836 nachholen, zumal er glaubte, damit Geld verdienen zu können. Möglicherweise wollte er seine Eltern nach Ende des verabredeten Studienplans im Frühjahr 1836 (vgl. 458) nicht mehr um Unterstützung angehen, daher schrieb er: „Wenn ich meinen Doctor bezahlt habe, so bleibt mir kein Heller mehr […]. Ich muß eine Zeitlang vom lieben Kredit leben und sehen, wie ich mir in den nächsten 6 – 8 Wochen Rock und Hosen aus meinen großen weißen Papierbogen, die ich vollschmieren soll, schneiden werde“ (ebd.). Gemeint war damit der Plan für zwei Dramen, eine Gattung, die ihm nach eigener Einschätzung mehr lag als die erzählende Prosa oder die literarische Kritik (vgl. 423: „Ich gehe meinen Weg für mich und bleibe auf dem Felde des Drama’s“), nämlich Leonce und Lena und Woyzeck.
Leonce und Lena; Woyzeck
Das Lustspiel beschäftigte ihn noch bis in den Januar 1837 hinein, das Woyzeck-Stück wurde gar nicht mehr abgeschlossen. Ein gerüchtehalber geplantes Aretino-Drama hat es wohl nie gegeben.
Philosophie-Kurs
Wahrscheinlich kostete ihn die Vorbereitung eines „Kurs[es] über Philosophie“ (FA 2,446), den er im Wintersemester 1836 / 37 in Zürich halten wollte, doch mehr Zeit als veranschlagt. In Büchners Nachlass überliefert ist auch keineswegs ein „vollständiger Lehrcurs über ,die philosophischen Systeme der Deutschen seit Cartesius und Spinoza‘“ (WK 124), sondern nur zwei im Sommer bzw. Frühherbst 1836 entstandene Vorlesungsskripten, das eine (vollständige) über Descartes’ Philosophie, das andere (abgebrochene) über Spinozas Wissenschaftslehre und Metaphysik. Die Vorbereitung eines zweiten „anatomischen Cursus“ (WK 124) muss wohl in das Reich der Legende verwiesen werden.
Promotion in Zürich
Büchners Plan, in Zürich als Privatdozent über Philosophie zu lesen, zerschlug sich erst gegen Ende Oktober 1836. Am 3. September 1836 war Büchner auf Grund der Ende Juli aus der Druckerei gekommenen Doktorarbeit, die er nach Zürich zur Einleitung des Promotionsverfahrens gesandt hatte, und des gemeinsamen Gutachtens der Professoren Lorenz Oken, Rudolf Schinz, Karl Löwig und Oswald Heer zum Doktor der Philosophie promoviert und zugleich zu einer „Probevorlesung“ eingeladen worden, die Voraussetzung war für „das Recht des Docirens“ (WK 127). Die „Zulassung zu der […] öffentlichen Probevorlesung“ beantragte Büchner am 26. September, am 28. September wurde ihm die Einreise in die Schweiz gestattet; am Tag nach seinem 23. Geburtstag reiste Büchner nach Zürich ab, wo er am 24. Oktober das Zimmer in der heutigen Spiegelgasse bezog, das er bis zu seinem Tod bewohnte. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Zürich hatte Büchner ein Gespräch mit dem Dekan der dortigen Philosophischen Fakultät, Johann Georg Baiter (1801 – 1877), der dem Kandidaten nahelegte, sich anders zu orientieren, da die philosophische Lehre bereits durch Eduard Bobrik (1802 – 1870) abgedeckt würde. Büchner berichtete darüber am 25. Oktober seinen Eltern, die Baiters Vorschlag, sich auf die vergleichende Anatomie zu konzentrieren, ausdrücklich unterstützten (FA 2,455).
Probevorlesung über Schädelnerven
Büchner hatte also höchstens zwei Wochen Zeit, eine naturwissenschaftliche Probevorlesung anzufertigen, die er am 5. November 1836 „vor einem sehr zahlreichen Publikum“ – der Hörer August Lüning erinnerte sich an „circa 20 Zuhörer“ (MA 385) – mit dem „allgemeinsten Beifall“ hielt (WK 127). Bei der Ausarbeitung der Habilitations-Vorlesung ging Büchner zwar „sehr ökonomisch“ (BHb 125) vor, d.h. er referierte im Wesentlichen die Ergebnisse seiner Dissertation, ging aber stellenweise auch über das schon Vorliegende hinaus, indem er sein künftiges Lehr- und Forschungsprogramm antizipierte (VIII, 217).
Ernennung zum Privatdozenten der Universität Zürich
Da das Wintersemester bereits am 26. Oktober begonnen hatte, wurde das Verfahren extrem beschleunigt und über Büchners Probevorlesung unter Umgehung des Senats der Universität (der das Verfahren am 23. November 1836 nachträglich billigte; vgl. Hauschild 1985, 399) noch am 5. November dem ,Erziehungs-Rath‘ des Kantons positiv Bericht erstattet, worauf dieser noch am gleichen Tag Georg Büchner die Bewilligung erteilte, „als Privatdocent an der hiesigen Hochschule aufzutreten“ (VIII, 213).
Büchner als Hochschuldozent
Büchner nahm seine Unterrichtstätigkeit im November 1836 auf. Offiziell hatten sich zwischen dem 15. November und 11. Dezember fünf Hörer für die Zootomischen Demonstrationen, die Büchner „auf seinem Zimmer hielt“ (MA 405), eingeschrieben, davon zwei nur pro forma; und von den anderen drei waren zwei „im Besuche“ des Privatissimums „sehr laessig“, so dass am Ende Johann Jakob Tschudi (1818 – 1889) Büchners „einziger Zuhörer“ war: „Büchner wurde aber dadurch nicht im mindesten entmuthigt, denn er hatte sich mit wahrem Feuereifer der vergleichenden Anatomie gewiedmet und fand an mir einen fleissigen und aufmerksamen Schüler. Er sagte mir oft: künftiges Semester werde ich schon mehr Zuhörer haben; ich bin der erste der an der Universitaet Zürich vergleichende Anatomie liest; der Gegenstand ist für die Studenten noch neu, aber sie werden bald erkennen wie wichtig er ist“ (Hauschild 1985, 392). Für das folgende Sommersemester 1837 hatte Büchner ein Kolleg mit dem Titel Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere angekündigt. Wahrscheinlich plante Büchner eine größere Publikation über dieses Themengebiet.
Anerkennung als Naturforscher
Von seinen Kollegen wurde Büchner offenbar gleich als künftige Kapazität akzeptiert. Neben dem Anatomieprofessor Friedrich Arnold (1803 – 1890), der Büchner „seine Bibliothek zur Verfügung“ stellte, war es besonders Lorenz Oken (1779 – 1851), einer der bekanntesten Naturphilosophen und Anatomen seiner Zeit sowie Herausgeber der Fachzeitschrift Iris (1817 – 1848), seit 1832 Professor in Zürich und 1833 – 1835 erster Rektor der neu gegründeten Universität, der „sehr für Büchner eingenommen“ war und „die Vorlesungen desselben vom Katheder herab“ empfahl (WK 127). Oken äußerte sich auch auswärtigen Besuchern gegenüber äußerst lobend über Büchner, von dem er überzeugt war, dass er „mit der Zeit […] als Naturforscher Bedeutendes leisten“ werde (VIII, 215; Hauschild 1985, 192). Ob der „Züricher Erziehungsrathe“ aber deswegen schon „die Absicht“ hatte, „sehr bald für ihn eine Professur der vergleichenden Anatomie zu creiren“ oder ob aus Georg Büchner, „wenn er am Leben geblieben wäre und seine wissenschaftliche Laufbahn weiter verfolgt hätte, derselbe große Reformator der organischen Naturwissenschaften geworden sein“ würde, welchen wir jetzt in Darwin verehren, wie sein Bruder Ludwig Büchner meinte (WK 127 u. 541), darf zweifelhaft bleiben.
Langeweile in Zürich
Auch wenn Büchner in Zürich „von allen Seiten auf das zuvorkommendste aufgenommen“ wurde (WK 127) und die politischen Verhältnisse (FA 2,457: überall ein gesundes, kräftiges Volk, und […] eine einfache, gute, rein republikanische Regierung) erträglich fand, befiel ihn schon bald eine gewisse Schwermut, die allerdings auch als Beginn des Prodromalstadiums einer Typhus-Erkrankung gedeutet werden kann.
Typhus-Erkrankung
„So im Anfange ging’s: neue Umgebungen, Menschen, Verhältnisse, Beschäftigungen – aber jetzt, da ich an Alles gewöhnt bin, Alles mit Regelmäßigkeit vor sich geht, man vergißt sich nicht mehr“, klagte er der Verlobten im Januar 1837: „Es wird immer öder.“ Um sich aufzuheitern, ging er abends für „eine oder zwei Stunden“ ins „Casino“ – ein Restaurationsbetrieb nicht weit von seiner Wohnung („Du kennst mein Vorliebe für schöne Säle, Lichter und Menschen um mich“) – und hoffte ansonsten auf die Osterferien, in denen er seine Verlobte in Zürich erwartete: „Du kommst bald? Mit dem Jugendmut ist’s fort, ich […] muß mich bald wieder an Deiner inneren Glückseligkeit stärken und Deiner göttlichen Unbefangenheit und Deinem lieben Leichtsinn und all Deinen bösen Eigenschaften“ (464 – 466). Aufgeschreckt von einem Eil-Brief, den die befreundete Caroline Schulz am 15. Februar 1837 nach Straßburg geschickt hatte, traf Wilhelmine Jaeglé schon am Vormittag des 17. Februar in Zürich ein. Büchner war seit zwei Wochen bettlägrig und fiel immer wieder in Fieberdelirien.
Tod am 19. 2. 1837
Am 19. Februar 1837 verlor er das Bewusstsein, am Nachmittag dieses Sonntags starb er.
Todesanzeige; Nachrufe
An der Beerdigung Büchners am 21. Februar 1837 nahmen fast die ganze Universität und einige Zürcher Honoratioren teil, insgesamt „mehrere hundert Personen“, „die beiden Bürgermeister u. andere der angesehensten Einwohner der Stadt, an der Spitze“ (Hauschild 1993, 606). Seine Eltern inserierten in der Großherzoglich Hessischen Zeitung (Nr. 56, 25. Februar 1837, S. 304) eine Todesanzeige: „Unser innigst geliebter Sohn Georg, Dr. philos. und Privatdocent an der Universität Zürich, ist uns durch den Tod entrissen worden. Er starb am 19. d. Mts. an dem Orte seiner Bestimmung, nach kaum zurückgelegtem 23. Jahre seines Alters, an einem bösartigen Fieber. Ihren lieben Verwandten und Bekannten, sowie den Freunden des Verewigten widmen diese Anzeige, mit der Bitte um stille Theilnahme, die tiefgebeugten Eltern.“ Sein Hauswirt, Hans Ulrich Zehnder (1798 – 1877), publizierte eine kurze Notiz im Schweizerischen Republikaner: „Wer ihn kannte, schätzte ihn als Mensch und als Gelehrten“ (Hauschild 1993, 607); in derselben Zeitung erschien am 28. Februar der erste ausführliche Nachruf aus der Feder von Büchners Freund Wilhelm Schulz.
Gedenkstein 1875
Als der nahe Büchners letzter Wohnung gelegene „Krautgarten“-Friedhof Anfang der 1870er Jahre aufgelöst wurde, überführten einige deutsche Studenten der Universität Zürich das noch fast vollständig erhaltene Skelett auf den sogenannten „Germania-Hügel“ am Zürichberg, wo sich noch heute neben der Bergstation der Seilbahn Rigiblick an der Krattenturmstraße der damals gesetzte Gedenkstein auf einem schmiedeeisern eingehegten Grab befindet.
Abb. 3 und Abb. 4: Nach der Auflösung des Krautgartenfriedhofs in Zürich, wo Büchner 1837 begraben worden war, wurden seinen Gebeine 1875 auf den Germaniahügel oberhalb Zürichs umgebettet. Um die Jahrhundertwende war sein Grab „Wallfahrtsort“ vieler „werdender Forscher und werdender Dichter“, wie sich Gerhart Hauptmann ausdrückte. Heute kann man mit der Zahnradbahn zu dem Grab fahren; seine geografischen Koordinaten sind: +47° 23' 15.58", +8° 33' 12.21" (siehe auch den „street view“ bei Google maps: 47.387662, 8.553392).