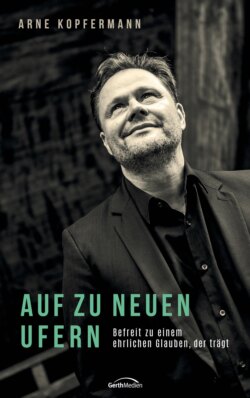Читать книгу Auf zu neuen Ufern - Arne Kopfermann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1
AUFBRUCH ZU NEUEN UFERN
ОглавлениеDie Notwendigkeit von Veränderung begreifen
Sören Kierkegaard hat die Aussage geprägt, dass man vorwärts gewandt leben muss, aber nur im Rückblick das Leben verstehen kann. Ich bin Jahrgang 1967, also beim Schreiben dieses Buches 52 Jahre alt. Das ist ein gutes Alter, um im vermutlich gerade auslaufenden zweiten Drittel meiner Existenz hier auf dieser Erde über das Leben und den Glauben zu reflektieren. Nicht, dass man das nicht auch schon mit 20 oder 30 tun könnte. Aber mit 50 habe ich schon mehr Facetten davon kennengelernt. Ich habe unterschiedliche Phasen miterlebt, die unsere Gesellschaft und auch die Kirche durchlaufen haben. Einige Ideale hinter mir gelassen und neue gefunden. Also reflektiere ich – und rede mit vielen unserer Freunde darüber.
Da gibt es die Gruppe von Freunden, die wie ich Zeit ihres Lebens in einer Kirchengemeinde aktiv gewesen sind. Die den Wandel der Zeit und verschiedene Entwicklungsstufen mitgemacht und für sich in den vergangenen Jahren wieder neu formuliert haben, wie sie sich heute Glauben und Kirche vorstellen. Eine Vorstellung, die dem Kinderglauben und auch dem Glauben der Junge-Erwachsenen-Jahre entwachsen ist. Was ihnen also heute wichtig ist und was an Gewicht verloren hat, obwohl es früher einmal einen großen Stellenwert hatte. Nicht selten ist ein starrer Dogmatismus einem spätmodernen Pragmatismus gewichen, und ihr Wahrheitsbegriff fühlt sich heute deutlich elastischer und biegsamer an als noch vor einigen Jahren.
Dann gibt es da die Gruppe von Freunden, die eigentlich nur an hohen Feiertagen, bei kirchlichen Festen wie Konfirmation und Hochzeit oder zu musikalischen Sonderveranstaltungen eine Kirche betreten – oder auf Reisen, dann aber aus touristischen Gründen. Auf ihren persönlichen Glauben angesprochen, sagen sie: „Ich habe durchaus einen eigenen Glauben, aber ich muss nicht Teil einer Kirche sein, um ihn auszuleben.“
Fast reflexartig stellt sich mir dann die Frage, warum es für diese Freunde in keiner Phase ihres Lebens sonderlich attraktiv war, im alltäglichen Leben Teil einer Glaubensgemeinschaft zu werden. Obwohl diese doch ihre Existenz bereichern könnte. Obwohl ich doch seit vielen Jahren den Satz vom Gründer der Willow Creek-Gemeinde in Chicago, Bill Hybels, in meinem Herzen verankert habe, dass „die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist“. Ich ahne, dass meine Freunde den Kirchen in diesem Land sowohl Alltagsrelevanz als auch Herzensweite absprechen würden. Dass sie nicht ausreichend als Orte wirken, die das Herz wärmen und die Seele trösten. Orte, an denen Liebe, Annahme und Vergebung das Miteinander prägen und weit über die Kirchenmauern hinaus in die Gesellschaft strahlen. Dass meine Freunde im Gegenteil zu viele moralinsaure, homophobe, bildungsfeindliche oder vorurteilsbeladene Christen kennengelernt haben. Fromme, die nicht nur meinen, ganz sicher in den Himmel zu kommen, sondern scheinbar auch eine gewisse Genugtuung dabei empfinden, dass es die anderen nicht tun. Dann mache ich mir bewusst, dass statistisch gesehen nur etwa 1,8 % der Bevölkerung unseres Landes, das ja einmal zum christlichen Abendland gezählt wurde, regelmäßig eine solche Gemeinschaft suchen – auch wenn sie ab und zu ein christliches Buch oder einen Internetartikel über Gott und Kirche lesen. Und das macht mich traurig.
Um es mit den Worten des Theologen Thorsten Dietz zu sagen, der in seinem wunderbar inspirierenden Buch Weiterglauben schreibt:
„Der Mensch lebt nicht vom Podcast allein, sondern auch von jeder sichtbar-leibhaften Gemeinschaft mit Menschen, denen Glaubensfragen wichtig sind. Christsein bedarf der Anregung durch konkrete Mitchristen, durch auf den ersten Blick schwer zugängliche Traditionen voller Weisheit und Tiefe. Christen brauchen die Erfahrungen gemeinsamer Aufbrüche, gemeinsamen Scheiterns und Weitermachens. Die Erfahrung, mit anderen zu singen, zu beten, das Abendmahl zu teilen …
Glaube ist eine Gemeinschaftsangelegenheit, die zugleich davor geschützt werden muss, in vorfindlichen Gemeinschaften des Glaubens aufzugehen …
Glaube entsteht nicht aus dem Nichts, sondern angeregt, angestoßen, hervorgelockt durch Vorbilder oder auch mal durch Gegenbilder. Glaube entsteht in Berührung mit Glaube.“ 1
Dieses Buch hat den Titel Auf zu neuen Ufern. Befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt. Ich habe den Titel nicht gewählt, weil ich der Meinung bin, in den vergangenen 40 Jahren keinen ernsthaften oder ehrlichen Glauben gelebt zu haben. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn erst jetzt so richtig finden kann, wo ich mich wieder auf die Reise begebe, denn das gesamte Leben ist in meinen Augen eine Pilgerreise in Richtung Ewigkeit, ob es uns nun bewusst ist oder nicht. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere Überzeugungen auch im fünften, sechsten, siebten oder achten Lebensjahrzehnt nachjustieren müssen (falls uns so viel Zeit gegeben ist), wenn unser Glaube nicht leblos oder zu einer eingefahrenen Gewohnheit werden soll. Um es mit den Worten des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann (1969 – 1974) zu sagen: „Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“
Veränderung ist in allen Bereichen des „Homo mutandis“ zu beobachten: in unserer Evolution, der Entwicklungsgeschichte unserer Menschheit. In unserer Schaffenskraft. Im Entdeckergeist. Im Fortschrittsdenken. In der volkswirtschaftlichen Entwicklung, wo Stillstand Rückgang ist und die Konkurrenz nicht schläft. In den Geistes- und Naturwissenschaften, die unablässig bemüht sind, sich aus dem Mysterium des Lebens in seinen mannigfaltigen Darstellungsformen einen Reim zu machen, wohl wissend, dass jede gefundene Antwort gleich mehrere neue Fragen aufwirft. In Kunst, Musik und Handwerk. In der Architektur, dort insbesondere im Dekonstruktivismus als Antwort auf die Postmoderne, die ja vor allem ein „Zeitalter der Mosaike“, also des Nebeneinanders von Einflüssen unterschiedlicher Epochen, ist:
„Ein dekonstruktiver Architekt ist deshalb nicht jemand, der Gebäude demontiert, sondern jemand, der den Gebäuden inhärente Probleme lokalisiert. Der dekonstruktive Architekt behandelt die reinen Formen der architektonischen Tradition wie ein Psychiater seine Patienten – er stellt die Symptome einer verdrängten Unreinheit fest. Diese Unreinheit wird durch eine Kombination von sanfter Schmeichelei und gewalttätiger Folter an die Oberfläche geholt: Die Form wird verhört.“ 2
Was für ein schöner letzter Satz, der sich auch auf das Anliegen dieses Buches übertragen lässt: Die Form meines Lebens und Glaubens wird verhört, mal sanft die Herzklappen umschmeichelnd und dann wieder scheinbar gewaltsam wie ein Orkan meine Gedanken- und Gefühlswelt durcheinanderwirbelnd! Wie alle anderen bin auch ich gezwungen, den Wandel zu umarmen, wenn ich nicht im Entwicklungsstrudel untergehen möchte. Dennoch will ich gleichzeitig das Wissen, die Werte, Erkenntnisse, Geheimnisse und Traditionen wahren und ehren, auf deren Fundament eine menschenwürdige und sinnhafte Existenz gegründet ist. Ein grundlegender DNA-Strang einer solchen Existenz ist der Glaube. Ich möchte mich also weiterhin auf die Suche nach einem Glauben begeben, der mir hilft, die schroffen Klippen und gefährlichen Stromschnellen des Lebens zu überwinden. Und der auch Heimat für meine Freunde wird, die darin bisher nur wenig von einem Zuhause haben ausmachen können. Wo die heiligen Dinge des Lebens nicht durch Abnutzung banal werden und die banalen Dinge keinen zu hohen Stellenwert bekommen. Diese Suche fängt in meinem eigenen Herzen an, aber sie betrifft zwangsläufig irgendwann auch mein Bild von Kirche und „Familie Mensch“.
Ich habe im September 2014 bei einem Autounfall meine zehnjährige Tochter Sara verloren. Damals war ich 47 Jahre alt, und es war für mich, als hätte ich in einem tieferen Sinne am Tag unseres Unfalls meine Unschuld verloren. Seit ich als Teenager zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus fand, ist er rund 40 Jahre lang Fokuspunkt, Gradmesser, Identitätsstifter und Korrektiv für mein Leben gewesen. Er hat nicht nur meine Ethik geprägt, sondern auch alle meine größeren Lebensentscheidungen maßgeblich beeinflusst: meine Berufswahl, meine Partnerwahl, meine Freizeitgestaltung, meinen Freundeskreis und sogar die Stadt, in der ich wohne. Ich habe in unzähligen Gottesdiensten gesessen und in ähnlich vielen Musik gemacht. Ich habe Hunderte von Liedern geschrieben, die zum Vertrauen auf und Festhalten an Gott ermutigen, und sie vor Tausenden von Menschen gesungen.
Auch in den Scherben meines Lebens, in denen ich mich nach unserem Unfall wiederfand, habe ich diesen Glauben nicht verloren. Aber ich musste in der Folgezeit erst mühsam lernen, mit Gott zu ringen und ihm mein Leid zu klagen. Denn das kam in meiner Frömmigkeit kaum vor. Ich musste mit einigen Glaubensbildern und -leitsätzen brechen, die ich zum Teil seit meiner Jugend in mir getragen hatte, weil sie meinen Lebenserfahrungen nicht mehr standhielten. Ich musste mir ehrlich Rechenschaft über mein Gottesbild ablegen. Wie ich mir wünschte, dass er ist und sich verhält, und wie ich ihn in meinem Leben tatsächlich erfahren habe. Diese Auseinandersetzung hat mir meinen Glauben nicht geraubt, hat ihn aber von einigen steilen Aussagen befreit, mit denen ich zum Teil schon lange vor unserem Unfall bewusst oder unterbewusst gerungen hatte. Und die spätestens jetzt nicht mehr zu mir gehörten.
Ich musste mir auch ehrlich Gedanken über mein Bibelverständnis machen. Wie wollte ich mich in Zukunft dieser wunderbar geheimnisvollen, ambivalenten Sammlung von Einzelschriften zwischen zwei Buchdeckeln nähern, die nicht nur das bedeutendste Stück Weltliteratur sind, sondern auch das umstrittenste? Alte Texte, in denen mir Gott unmittelbar entgegenkommt, bei denen ich aber gleichzeitig kulturelle und historische Übersetzungsarbeit leisten muss, damit die rund 2 000 Jahre alten Überlieferungen in mein Leben hineinsprechen können, auch wenn sie immer wieder in revidierte deutsche Texte gegossen werden. Ich werde im 3. Kapitel ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Hier schon einmal die Quintessenz in den Worten des Exegeten Adolf Schlatter:
„Man hat zur Glaubwürdigkeit der Schrift oft dies gezählt, dass sie in jedem Wort vollständig richtig sei, dass sich nirgends ein Versehen, nirgends eine Dunkelheit, nirgends eine Verschiedenheit zwischen dem Sachverhalt und der Darstellung zeigt. Diese Fehllosigkeit besitzt die Bibel nicht, weder in ihrer Geschichtsschreibung noch in ihrer Weissagung.“ 3
Viele Christen haben große Scheu davor, ihre oft über Jahrzehnte gewachsenen Überzeugungen von Gott und seinem Wirken auf den Prüfstand zu stellen. Zu laut gellen ihnen die Bibelverse im Ohr: „Es ist aber der Glaube … ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht“ (Hebräer 11,1; Luther). Oder: „Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen“ (Jakobus 1,6 – 8; Luther).
Andere finden gar nicht erst zu einer tiefen Glaubensüberzeugung, weil ihnen der Schritt ins Ungewisse, auf das Wasser hinaus, zu wagemutig erscheint. Wie es Berthold Brecht so treffend in seinem Gedicht „Lob des Zweifels“ ausdrückt:
„Den Unbedenklichen, die niemals zweifeln, begegnen die Bedenklichen, die niemals handeln. Sie zweifeln nicht, um zur Entscheidung zu kommen, sondern um der Entscheidung auszuweichen. Ihre Köpfe benutzen sie nur zum Schütteln. Mit besorgter Miene warnen sie die Insassen sinkender Schiffe vor dem Wasser. Unter der Axt des Mörders fragen sie sich, ob er nicht auch ein Mensch ist. Mit der gemurmelten Bemerkung, dass die Sache noch nicht durchforscht ist, steigen sie ins Bett. Ihre Tätigkeit besteht in Schwanken. Ihr Lieblingswort ist: nicht spruchreif.“
In meinem Lied „Irgendwo dazwischen“ geht es um eben diese Haltung:
Irgendwo dazwischen
Nicht heiß und nicht kalt, nicht jung und auch nicht alt
Nicht klug und nicht dumm
Nicht mal laut, und wenn doch, reden wir gern drum rum
Nicht ganz, nicht mal fast, fallen niemandem gerne zur Last
Nicht ja und nicht nein, lieber Opportunist als am Ende allein
Wir stehn irgendwo dazwischen
Sitzen zwischen allen Tischen
Ein bisschen Schatten, ein bisschen Licht
Denn nichts Genaues weiß man nicht
Oh, nichts Genaues weiß man nicht
Nicht schwarz und nicht rot, lieber Schaffner als Pilot
Nicht hü und nicht hott
Lieber gar nichts riskieren als am Ende bankrott
Nicht Muslim, nicht Christ, nicht zum Bund
Doch auch kein Pazifist
Nein, wir können nicht mehr ohne die neutrale Zone
Oh Mann, wann fangen wir endlich an, Stellung zu beziehn?
Oh Mann, am Ende geht es nicht nur um das Gleichgewicht
Steh nicht irgendwo dazwischen
Sitz nicht zwischen allen Tischen
Steh für die Wahrheit ein, versteck dich nicht
Stell dich ins Licht, zeig dein Gesicht
Stell dich ins Licht, zeig dein Gesicht
Und bleib nicht irgendwo dazwischen
Wenn wir nicht freiwillig von Zeit zu Zeit eine Inventur unseres Glaubens vornehmen, wird es das Leben irgendwann von ganz allein für uns erledigen. Die Brüche in unserer Biografie und unsere Verlust- und Leiderfahrungen oder die uns nahestehender Menschen werden Fragen aufwerfen, die wir nur eine gewisse Zeit ignorieren können. Wenn wir uns ihnen nicht sehenden Auges stellen, wird das Fundament des Glaubens marode und beginnt mit der Zeit zu bröckeln. Einer der Sätze des Judentums war mir dabei in meinem eigenen Prozess eine große Hilfe: „Es kommt nicht darauf an, die Antworten zu kennen, sondern die richtigen Fragen zu stellen.“ Der Rabbiner Jehuda Teichtal, Vorsitzender des jüdischen Bildungszentrums Chabad Lubawitsch in Berlin, sagt dazu in einem Interview des Deutschlandfunks:
„Die über Jahrtausende eingeübte Kultur des Fragens war nie einer theologischen Elite vorbehalten. Das Studium der Texte, der Diskurs zu Fragestellungen des Talmuds oder des Rechts war für breite Schichten der männlichen jüdischen Bevölkerung prägend. Und sie ist ebenso eingegangen in die Säkularkultur, was sich in dem berühmten jüdischen Witz niederschlägt. Der hat nur zwei Sätze: Warum antwortet ein Jude auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage? Warum nicht?“ 4
Um es mit einer Metapher zu veranschaulichen: Wasser kennen wir in drei unterschiedlichen Aggregatzuständen: fest, flüssig und gasförmig. Wenn man mit einem Hammer auf einen Eisblock schlägt, wird der Eisblock zersplittern, und die Eisbrocken werden in alle Himmelsrichtungen davonfliegen. Versucht man aber, mit einem Hammer auf ein fließendes Gewässer einzuschlagen, wird das Wasser an dieser Stelle nur kurz zur Seite gedrängt und fließt dann unbeirrt weiter – die Wucht des Schlages kann ihm nichts anhaben.
Ähnliches gilt für den Glauben: Wenn wir ein eher starres, mit vielen absoluten Sätzen gespicktes Bild des Glaubens haben und dann Schicksalsschläge erleben, besteht die Gefahr, dass unsere Glaubensbilder mit ihren für uns als selbstverständlich angenommenen Automatismen zersplittern. Wir haben uns so auf unsere Überzeugungen versteift, dass wir unbeweglich geworden sind. Weil die alten Sätze dem Erlebten jedoch nicht mehr standhalten, zerbricht das ganze Gebilde.
Wenn unser Glaube aber im Fluss, also in Bewegung, ist und unsere Vorstellung von Gott und wie er zu handeln hat, nicht in einen „Eisblock gemeißelt ist“, dann werden wir zwar die Kräfte spüren, die auf uns eindringen, aber wir müssen nicht daran zerbrechen.
Allerdings gibt es hinsichtlich des Glaubens auch einen dritten Aggregatzustand: „Gasförmig“ ist unser Glaube dann, wenn wir leichtgläubig und unreflektiert geistlichen oder ideologischen Modeerscheinungen nachlaufen, ohne eigene, tragfähige Glaubenssätze zu entwickeln. Wenn wir dann an die Grenzen unserer Existenz stoßen und unser Glaube sich bewähren muss, werden wir feststellen, dass er genauso wenig tragfähig ist wie Moleküle im Wasserdampf.
Es geht also darum, einen Glauben zu entwickeln, der weder beliebig noch in Stein gemeißelt ist. Stattdessen sollten wir zu den eigenen, eher starren Überzeugungen immer eine gewisse „demütige Distanz“ wahren: Ist mein beschränktes Verständnis von Gott, seinem Wesen, seinen Wegen und seinem Wirken wirklich stichhaltig? Wo kann ich ihn nicht begreifen, erfassen, durchdringen – wo bleibt er mir in seinem Wesen fremd, weil er Gott ist und ich nur ein Mensch bin?
Von diesen hoffentlich „richtigen“ Fragen handelt das vorliegende Buch. Es geht um einen Glauben, der sowohl Muskel als auch Geschenk ist: Einen Muskel kann man trainieren, ein Geschenk kann man nur erbitten und empfangen. Das eine kann man mit geistlicher Disziplin entwickeln, das andere bleibt ohne das souveräne Zutun Gottes unverfügbar. Und so wie es beim Körper eine Erkrankung der Muskulatur gibt, die als „Muskelschwund“ bezeichnet wird – also eine Rückbildung bereits vorhandenen Muskelgewebes –, greift das Bild auch in Bezug auf den Glauben: Einschneidende persönliche Leid- und Verlusterfahrungen können eine über viele Jahre gepflegte Spiritualität ins Wanken bringen. Wenn man den Glauben dann neu geschenkt bekommt, obwohl die Narben bleiben und wir hinkend durchs Leben gehen, dann kann sich das wie eine Neugeburt anfühlen.
Vor ein paar Monaten kam mir wieder ein kleiner, für mich aber sehr besonderer Moment in den Sinn, der sich am Heiligabend 2014, wenige Wochen nach Saras Tod, ereignete. Am Mittag jenes Tages rief mich meine Frau an, die im Ort gerade letzte Einkäufe tätigte. Sie machte mich auf den vielleicht größten Regenbogen aufmerksam, den ich je über unserem Ort gesehen hatte. Er stand einige Minuten lang am Himmel – gefühlt direkt über unserem Haus. Es war, als wollte Gott uns mitten in dem unsäglichen Schmerz, den dieses erste Weihnachtsfest im „Leben danach“ mit sich brachte, unmissverständlich daran erinnern, dass er uns nicht vergessen hatte. Dass er sein Versprechen, uns beizustehen, niemals brechen würde.
Regenbogen
Wenn der Himmel sich verfinstert
Und die Sonne selbst nur bitt’re Tränen weint
Mich das Leben nicht begünstigt
Sondern auslacht und aufzugeben scheint
Wenn nach ein paar frohen Stunden
Wieder dieser Kloß in meiner Kehle steckt
Komm so grad über die Runden
Mit den Händen zum Himmel ausgestreckt
Dann zwischen Sonne und Regen
Trübsinn und Glück
Blinzelnd durch Tränen heb ich den Blick
Seh einen Regenbogen, scheinbar aus dem Nirgendwo
Regenbogen aus Rot, Gelb, Grün und Indigo
Regenbogen, die Wolken ziert ein Lichterkleid
Und die Leuchtschrift: Der Himmel ist nicht weit
Manchmal brauche ich ein Zeichen
Um zu sehn, Du lässt mich wirklich nie allein
Wenn sich graue Tage gleichen
Es mir schwerfällt, mal unbeschwert zu sein
Wenn ich auf der Stelle trete
Sich der Sinn von dem, was war, mir nicht erschließt
Ich für einen Durchbruch bete
Doch die Hoffnung auf „Schwermutmauern“ stößt
Du setzt diesen Bogen als sichtbares Zeichen:
Dein Bund mit mir hat stets Bestand
Du bist mir gewogen, wirst nie von mir weichen
Ich kann nie falln aus Deiner Hand
Wenn ich mich auf die Reise mache zu meinen innersten Leitsätzen, Ent-Täuschungen und bleibenden Hoffnungen, berührt das immer auch den Bereich meiner Wahrheitsempfindung. Das ist zuerst einmal ein subjektiver Prozess, aber je stärker er voranschreitet, desto stärker ist man von der eigenen Wahrheit überzeugt, was wiederum immer auch zu einer Abgrenzung gegenüber dem Andersdenkenden und -empfindenden führt. Auf der anderen Seite geht inneres Wachstum oft nur aus einer Mischung aus Übereinstimmung und Reibung mit anderen Positionen hervor. Dazu gehört dann auch das Verlassen der eigenen Wohlfühlzone und das Setzen von Grenzen: Nur wer sich abgrenzen kann, kann sich auch verorten. Die Kunst besteht darin, sich im Dialog mit anderen nicht durch Abgrenzung zu definieren, sondern durch eine möglichst klar umrissene eigene Positionsbeschreibung! Daher gleich am Anfang dieses Buches noch ein Wort zu Toleranz in der Diskussion mit Andersdenkenden:
In unserer Zeit ist es eine ausgesprochen komplizierte Angelegenheit, in Glaubensdingen und Lebensfragen seine eigene Sicht kundzutun. In unseren Breitengraden hat sich ein merkwürdiger Toleranzbegriff breitgemacht: Toleranz scheint heute ein so komplexer Begriff zu sein, dass damit nicht länger die Duldung oder das Geltenlassen oder Stehenlassen anderer Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten gemeint ist. Im Zeitalter eines ausgeprägten Pluralismus, in dem alles möglich und nichts mehr absolut scheint, ist es nahezu unmöglich, einen Diskurs (Austausch von Meinungen) mit Trennschärfe anzustoßen, ohne den Vorwurf der Intoleranz zu riskieren.
Wenn ich eine Haltung kritisiere, die mir in Glaubensfragen als lückenhaft, gefährlich, veraltet oder nicht mit der Lehre von Christus vereinbar erscheint, wird mir heute so postwendend wie zielsicher Herzensenge vorgeworfen. Schließlich lasse ich ja die kritisierte Haltung nicht stehen und werde damit intolerant (in meiner Jugend hätte man dasselbe Vorgehen noch als couragiert bezeichnet). In dem Moment, wo ich Ab- und Ausgrenzung in der Kirche thematisiere, wo ich sage, dass sie nicht der Lehre und dem Lebensstil von Jesus entspricht, besteht die Gefahr, dass mir umgehend vorgeworfen wird, ich grenze mich ja selbst von den Ab- und Ausgrenzenden ab und sei damit kein Stück besser. Nur führt eine solche Herangehensweise leider auf Dauer zu einer Diskursunfähigkeit!
Es ist also eine knifflige Angelegenheit, einerseits Trennschärfe zu besitzen und andererseits das Bedürfnis nach Toleranz nicht zu verletzen. Man muss seine Worte konsequenterweise in noch mehr Watte packen. Muss das Für und Wider nicht nur abwägen, sondern auch zu Wort kommen lassen – als Sowohl-als-auch. Daher habe ich für dieses Buch viel gelesen, um die besten Argumente zu finden, zu sammeln und für mich sprechen zu lassen. Das war immer dann besonders wichtig, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich zwar einer wertvollen Spur folge, aber noch nicht in der Lage bin, meine Gedanken und Eindrücke auch schon adäquat in Worte zu fassen. Entsprechend kommen in diesem Buch immer wieder andere Autoren zu Wort, die ich in ihrem Ringen um alltagsfähige Wahrhaftigkeit schätze und die mir in meinem eigenen Prozess des Sortierens und Abwägens sehr geholfen haben.
Als ich meine Gedanken zum Thema „Toleranz“ im Vorfeld der Buchveröffentlichung in einem sozialen Netzwerk angerissen habe, erhielt ich postwendend den sehr bedenkenswerten Kommentar eines Journalisten:
„Vielleicht wäre es besser, weniger mit ,richtig – falsch‘, ‚entweder – oder‘, ‚gut – böse‘, ‚wahr – unwahr‘ zu operieren und zu argumentieren. Angesichts der eigenen Entwicklung fällt es leichter, von ‚sowohl als auch‘ auszugehen. Und davon, den Andersdenkenden einzuladen, die ungewohnte Position mitzudenken, ohne sie gleich annehmen oder übernehmen zu müssen. Ein Diskurs erwartet von allen Beteiligten, auch Ungewohntes zu erwägen.
Gleichzeitig ist der Aspekt des Prozesses wichtig. Wachsende Erkenntnisse kommen ja in der Regel nicht schlagartig, sondern gehen mit einer persönlichen Entwicklung einher. Die mögen dem anders denkenden Diskutanten ja noch bevorstehen. Oder auch nicht.
Ein Letztes: Es ist gut, in der eigenen Argumentation klar und deutlich und zugleich einladend und ermunternd zu bleiben. Also weniger Watte, mehr Wolle: ‚Man sollte dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, sodass er hineinschlüpfen kann – und nicht wie ein nasses Tuch um die Ohren schlagen.‘“
Er greift damit ein Zitat des Schweizer Schriftstellers und Architekten Max Frisch auf:
„Man begnügt sich nicht damit, dass man dem anderen einfach seine Meinung sagt; man bemüht sich zugleich um ein Maß, damit sie den andern nicht umwirft, sondern ihm hilft; wohl hält man ihm die Wahrheit hin, aber so, dass er hineinschlüpfen kann …
Warum so viel Erkenntnis, die … in der Welt ist, meist unfruchtbar bleibt: vielleicht weil sie sich selber genügt und selten auch noch die Kraft hat, sich auf den anderen zu beziehen – die Kraft: die Liebe. Der Weise, der wirklich Höfliche, ist stets ein Liebender. Er liebt den Menschen, den er erkennen will, damit er ihn rette, und nicht seine Erkenntnis als solche.“ 5
Worte haben Macht. Im besten Fall sind sie wie ein Skalpell, das nur das wirklich kranke Gewebe vom gesunden Organismus trennt. Wird das Messer aber stumpf oder grobschlächtig geführt, dann fügt es auch den gesunden Zellen Schaden zu. In diesem Sinne hoffe und bete ich, dass dieses Buch zur eigenen Sondierung beiträgt, ohne gesunde Stellen zu sehr zu beanspruchen oder das Gute zu verletzen. Ich habe es in der Hoffnung geschrieben, dass selbst in der mir manchmal notwendig erscheinenden Abgrenzung von manchen Lehrmeinungen und Gemeindemarotten auf jeder Seite des Buches mein Anliegen deutlich wird, im Sinne Christi liebevoll und nicht vereinnahmend zu sein. Ich möchte immer unterscheiden zwischen theologischen Leitsätzen, die ich nicht oder nicht mehr teile, und den kostbaren Menschen, die hinter anders gelagerten Positionen stehen.
Zum Schluss dieses Kapitels noch ein Zitat aus der Rede von Michael Diener, die er im Februar 2020 vor der Mitarbeiterversammlung des Gnadauer Verbandes hielt. Auch wenn er eine andere theologische Prägung hat als ich, bringt er das oben angesprochene Toleranz-Dilemma wunderbar auf den Punkt. Er führt aus, dass ein Präses, der nur noch das sagen könne, was alle mittragen, und dann auch nur mit homöopathisch dosierten Worten, die vor politischer Korrektheit nur so strotzen, im Grunde gar nichts mehr zu sagen habe:
„Ich tauge nur dann als Sprachrohr pietistischer Selbstverständlichkeiten, wenn ich auch das strittige, das aus meiner Sicht visionäre, das korrigierende oder verbindende Wort sagen darf. Und selbstverständlich geht das immer durch die Person hindurch: die Leidenschaft, mit der ich meinen Dienst lebe, drückt sich natürlich auch in meinen Themen und meiner Wortwahl aus. Ich bin nicht geklont, ich bin echt … ich überlege, wäge ab, und dann spreche oder schreibe ich. Und lebe mit den Folgen.“ 6
Schließlich noch ein Satz zu „gendergerechter Sprache“: Leider ist meine Sprachfähigkeit in dieser Hinsicht noch nicht sonderlich weit entwickelt, was mir durchaus bewusst ist. Für dieses Buch gilt, dass ich allein zur besseren Lesbarkeit nur die männliche, nicht geschlechtsneutrale Form verwende. Sofern nicht anders angegeben, sind aber immer beide Geschlechter gemeint und auch wertgeschätzt. So stand es jedenfalls in meinem Manuskript. Bis Christina Brudereck mir nach ihrer Vorablektüre in einer E-Mail folgende Sätze schrieb:
„Dass wir Schwestern, Freundinnen, Frauen, Künstlerinnen natürlich mitgemeint sind, ist schön. Ich erlebe es so, dass es wirklich etwas anderes ist, wenn Du sagst: ,In einer Gruppe von Freundinnen und Freunden habe ich erlebt …‘ Das ist eine bunte Gruppe. Ich könnte vielleicht dabei sein. Anders, als wenn Du eben sagst: ‚In einer Gruppe von Freunden …‘ Da habe ich nur Männer vor Augen. Auch wenn Du es nicht so meinst. Vielleicht passt es ja an ein paar wenigen Stellen. Ich fände es schön. Es würde mich ansprechen!“
Das ist nicht nur ein kostbarer Gedankenanstoß, sondern auch noch eine sehr liebevoll geäußerte Form von Kritik, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Das ist ein Veränderungsprozess, den ich bisher noch nicht ausreichend im Blick hatte, dem ich mich aber noch stellen kann und wahrscheinlich auch sollte. Anstatt jetzt in der Korrekturphase alle entsprechenden Stellen umzuschreiben, habe ich mich entschieden, die meisten Passagen unverändert stehen zu lassen. Bitte nehmen Sie mir diesen blinden Fleck nicht übel. Ich wünsche mir, dass Sie als Leserin sich im gleichen Maße angesprochen fühlen wie die männlichen Leser!
Natürlich möchte ich alle von Ihnen auf meine Lebensreise und in meine Gedankenwelt mit hineinnehmen. Vielleicht werden manche Gedanken in Zukunft auch ein Teil Ihrer Welt. Lassen Sie sich Zeit. Nehmen Sie nur die Sätze auf, die Sie weiterbringen und nicht überfordern. Überspringen Sie gern auch einmal einen Gedanken oder ein ganzes Kapitel. Wir müssen unser Leben selbst leben und wichtige Entscheidungen selbst treffen. Ob sie nun Bestand wahren oder Wandel bringen. In Verantwortung vor unserem eigenen Herzen und Gewissen. In Verantwortung vor unseren Partnerinnen und Partnern, Familien, Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Vor den Mitmenschen, auch denen auf der anderen Seite unseres wunderschönen Planeten. In Verantwortung vor jenen, mit denen wir unseren Glauben teilen, wenn wir einen persönlichen Glauben haben. In Verantwortung vor denen, die anders denken und anders glauben. Und in der Verantwortung vor Gott.
1 Thorsten Dietz: Weiterglauben. Warum man einen großen Gott nicht klein denken kann. Moers 2018, S. 155, 157.
2 Philip Johnson, Mark Wigley: Dekonstruktivistische Architektur. Stuttgart 1988, S. 11.
3 Adolf Schlatter: Die Bibel verstehen. Aufsätze zur biblischen Hermeneutik. Gießen 2002, S. 122 – 123.
4 https://www.deutschlandfunk.de/judentum-wer-nicht-fragt-bleibt-dumm.886.de.html?dram:article_id=425326, abgerufen am 14.03.2020.
5 Max Frisch: Tagebuch 1946 – 1949, Frankfurt 1985, S. 53.
6 Dr. Michael Diener: Der Kurs Gnadaus und die Rolle des Präses. Rückblick und Ausblick. Mitgliederversammlung des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes e. V., Elbingerode, 13. bis 15. Februar 2020, S. 8.