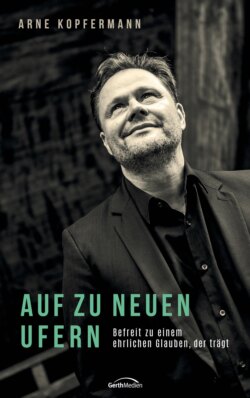Читать книгу Auf zu neuen Ufern - Arne Kopfermann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2
STATIONEN MEINER GEISTLICHEN LEBENSREISE
ОглавлениеDas Ringen um einen differenzierten Glauben
Herr, gib allen, die dich suchen, dass sie dich finden, und allen, die dich gefunden haben, dass sie dich aufs Neue suchen, bis all unser Suchen und Finden erfüllt ist in deiner Gegenwart.
Hermann Bezzel
Wenn ich rückblickend die unterschiedlichen Stationen meiner geistlichen Lebensreise betrachte, merke ich, dass ich wesentliche Überzeugungen und Verhaltensmuster der charismatischen Bewegung hinter mir gelassen habe, die viele Jahre zu meinem Glaubensleben dazugehörten.
Damit will ich jedoch keine Austrittserklärung abgeben. Ich will nicht mit meiner Vergangenheit abrechnen, denn ich verdanke ihr viel. Ich habe auch nicht vor, mich von Weggefährten zu distanzieren. Viele von ihnen gehören nach wie vor zu meinem Freundes- und Bekanntenkreis, und ich schätze ihre Überzeugungen und ihre Integrität weiterhin sehr. Ich versuche ebenfalls nicht, pfingstlerisch-charismatische Frömmigkeit über einen Kamm zu scheren. Ich behaupte nicht, alle Christen, die sich zu dieser Glaubensrichtung zählen, würden die Überzeugungen oder Missstände als richtig empfinden, die ich im Rückblick auf meine bisherige geistliche Reise kritisch beleuchten werde. Auch behaupte ich nicht, man könnte nicht mit inhaltlichen Sätzen der charismatischen Bewegung ringen und trotzdem aktiver Teil von ihr bleiben. Im Gegenteil: Viele Charismatiker leiden ebenfalls unter den Extremen in ihren Reihen und würden viele meiner Sätze unterschreiben.
So schrieb mir ein leitender Vertreter dieser Gemeinderichtung, den ich sehr schätze, nach der Veröffentlichung meines Artikels zum Thema „Warum ich kein Charismatiker mehr bin“ in der christlichen Zeitschrift „Aufatmen“ eine E-Mail:
„Mein Verständnis vom Charismatiker-Sein ist vielleicht ein anderes als Deines. Ich trage das Label nicht wie eine Monstranz vor mir her, und nach dem, was ich von Dir hier gelesen habe, stehen wir beide uns theologisch wahrscheinlich sehr viel näher als viele andere Charismatiker, denn ich verstehe mich nicht in irgendeinem institutionellen Sinne als solcher. Insofern muss ich auch nicht verantworten, was andere tun. Ebenso scheinst Du nur Erfahrungen mit einem bestimmten Feld der charismatischen Bewegung gemacht zu haben, nimmst aber alle in Haftung. Ich vermute, dass Du dadurch auf der anderen Seite vom Pferd fällst.“
Nun, genau das möchte ich nicht tun. Ich möchte nicht vereinnahmen und „zur Fahnenflucht anregen“. Ich möchte mit diesem Buch einen ehrlichen Einblick in Prozesse meiner Biografie geben. Denn wie schon am Anfang gesagt: Von manchen Leitsätzen und Verhaltensformeln musste ich mich im Laufe meines geistlichen Lebens trennen, und für mich persönlich gehört dazu auch, mich zumindest eine Weile von dem Milieu zu lösen, in dem sie mir am stärksten begegnet sind. Solche Prägungen können wie Schuhe sein, aus denen ich mit der Zeit herausgewachsen bin, auch wenn sie noch im Regal stehen. Sie passen mir nicht mehr, sind ausgetreten oder mittlerweile nicht mehr schön anzusehen. Sie gehörten eine Weile zu mir, aber wenn ich heute versuche, sie überzustreifen, hinterlassen sie beim Tragen Blasen.
Um Missverständnissen gleich vorzubeugen: Das Wort „Charisma“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Gnadengabe“. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff verwendet, um zu beschreiben, dass jemand eine besondere Ausstrahlung besitzt, also die Gabe, das Umfeld in besonderer Weise zu begeistern oder in den Bann zu ziehen. Die Anfang der 1960er-Jahre entstandene charismatische Bewegung bezieht sich jedoch auf die vom Heiligen Geist geschenkten Gnadengaben, die dem Aufbau der Kirche dienen sollen. Sie ist nach den Aussagen ihrer Gründungsväter auf dem Fundament der alten Pfingstbewegung entstanden. Ihre Initiatoren haben dort ihre ersten Erfahrungen gemacht und diese dann in ihre eigenen Kirchengemeinschaften hineingetragen. Der primäre Unterschied zwischen der traditionellen Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung bestand ursprünglich darin, dass Pfingstler eigene Gemeinden und Gemeindeverbände gebildet haben, während die charismatische Bewegung weltweit zuerst bewusst versuchte, in den bestehenden Kirchengemeinschaften zu wirken und sie „charismatisch zu erneuern“. Vor allem unter Anglikanern, Lutheranern, Katholiken, Methodisten und Baptisten. Ab dem Ende der 1980er-Jahre entstand dann auch in Deutschland eine Fülle von neu gegründeten freikirchlich-charismatischen Gemeinden.
Ausgangspunkt der neuzeitlichen Pfingstbewegung ist die „Heiligungsbewegung“, die wiederum ihre Wurzeln im Methodismus hat, insbesondere in Wesleys Vollkommenheitslehre. Es ging hier um die Sehnsucht nach „völliger Heiligung“. Daraus resultiert die Lehre vom „vollen“ oder „vierfachen Evangelium“, nämlich von Christus als Erlöser, Heiligender, Heilender und kommender König, der am Ende der Zeit ein tausend Jahre andauerndes Reich auf der Erde errichtet. Zum Erreichen dieser „völligen Heiligung“ oder des „vollen Evangeliums“ ist nach traditioneller charismatischer Theologie eine „Geistes- oder Feuertaufe“ nötig, die getrennt von der „Wiedergeburt“ ist (eine Bekehrungserfahrung durch eine bewusst vollzogene Lebenshingabe an Christus) und auf diese als besondere Zweiterfahrung folgt, nämlich als eine Erfahrung der „völligen Befreiung von der Sünde“. Dabei nimmt der Heilige Geist im Christen nun buchstäblich Wohnung, der bei der Wiedergeburt nur „mit den Gläubigen“ ist, aber noch nicht „in ihnen“. Der Heilige Geist rüstet sie mit seinen Gaben aus. Die „Charismen“ oder „Geistesgaben“ wie Sprachengebet, Prophetie und Krankenheilung werden als Zeichen für die Geistestaufe angesehen. In der Pfingst- und charismatischen Bewegung wird zumeist auch gelehrt, dass man sich nach diesen Gaben und dem Heiligen Geist „ausstrecken“, sie also im Gebet erbitten, soll, da sie für die Erneuerung und Ausbreitung der Kirche als notwendig betrachtet werden. Die klassische charismatische Bewegung entstand auf dem Fundament der traditionellen Pfingstbewegung, daher sind viele ihrer Lehrsätze in Grundzügen ähnlich.
Die Geistestaufe manifestiert sich nach Ansicht vieler Charismatiker in der „Zungenrede“ – auch „Sprachengebet“ genannt – und in der Gabe, prophetisch zu reden. Das Gebet um Krankenheilung spielt ebenfalls eine gewichtige Rolle, weil es aufgreift, dass christliche Verkündigung bei Jesus und in der Urkirche immer durch „Zeichen und Wunder“ beglaubigt wurde. Wie die Pfingstbewegung ist auch die charismatische Bewegung sehr erfahrungsorientiert. Das führt dazu, dass Theologie oft nicht dogmatisch und exegetisch betrieben, sondern durch die Brille der eigenen Erfahrung betrachtet und die Bibel zumeist wörtlich gelesen wird. Begleitet wird das Ganze oft durch die subjektiv als konkretes Reden Gottes empfundene Wahrnehmung ihrer Leiter.
Aus der Pfingst- und der charismatischen Bewegung ging zu Beginn der 1980er-Jahre die sogenannte „Dritte Welle“ oder „Power Evangelism“-Bewegung hervor. Ihr Ziel war es, in diejenigen Kreise vorzudringen, die bisher von Pfingstlern und Charismatikern nur wenig erreicht wurden: vor allem konservative evangelikale Gemeinden und die Brüderbewegung. Durch die Konferenzen der Vineyard-Bewegung mit ihrem Leiter John Wimber wurden die Leitsätze dieser Bewegung Mitte der 1980er-Jahre in viele deutschsprachige Kirchengemeinden getragen. Neben der Bibel werden in der „Dritten Welle“ die „Tradition der gesamten Kirche“ und auch Erfahrungen mit Gottes Wirken heute als weitere Offenbarungsquellen genannt. In der Folge bildete sich hier eine Art „Prophetenbewegung“. Die Dritte Welle teilt über weite Strecken die Überzeugungen der Pfingstler und Charismatiker, betont aber besonders die Bedeutung von Zeichen und Wundern und der Prophetie für den Gemeindeaufbau. Nach ihrer Auffassung sind diese unerlässlich für die Ausbreitung von Gottes Reich, denn Erweckung geschehe normalerweise nicht ohne solche göttlichen Kraftbeweise. Es sei für die Kirche unerlässlich, neben der Verkündigung auch „Gottes Macht“ zu erleben.
Von der Dritten Welle und der charismatischen Bewegung ist auch die sogenannte „geistliche Kampfführung“ aufgebracht worden. Diese Lehre geht davon aus, dass Städte, Regionen oder Länder unter dem Einfluss „territorialer Mächte“ (also von Dämonen) stünden und durch Gebetsversammlungen und sogenanntes „gebietendes Gebet“ vertrieben werden müssten. Erst dann könne eine geistliche Erweckung, also eine breit wahrnehmbare Hinwendung zum christlichen Glauben, geschehen. Im Zusammenhang mit der Dritten Welle und der charismatischen Bewegung trat als Phänomen auch vermehrt das sogenannte „Ruhen im Geist“ auf, bei dem meist unter Handauflegung dafür gebetet wird, dass Menschen mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden, und diese dann als Folge des Gebetes und der empfundenen Krafteinwirkung in einer Art geistlicher Trance zu Boden sinken.
Neben den aufgeführten Sonderlehren und besonderen Akzenten versteht sich die charismatische Bewegung zumeist als Teil der weltweiten Evangelikalen und teilt etliche ihrer grundlegenden Überzeugungen, zum Beispiel die Notwendigkeit einer bewussten Glaubensentscheidung („Lebenshingabe“ an Jesus Christus), eines missionarischen Lebensstils oder des Schutzes ungeborenen Lebens. Auch vertritt sie weitestgehend eine konservative Sexualethik und eine große Liebe zum Volk Israel.
Statistische Erhebungen haben 2018 ergeben, dass sich von den schätzungsweise zwei Milliarden Christen auf der Welt rund 279 Millionen zu den Pfingstlern zählen, was 12,8 % der weltweiten christlichen Population ausmacht. 304 Millionen zählen sich zu den Charismatikern (14 %) und 285 Millionen (13,1 %) zu den Evangelikalen oder den sogenannten „bibeltreuen“ Christen. Wobei man diese Zahlen mit Vorsicht genießen muss, da sich manche Pfingstler auch zu den Charismatikern zählen und manche Charismatiker zu den Evangelikalen … Pfingstler und Charismatiker machen dieser Statistik zufolge etwa 8 % der Weltbevölkerung und 27 % der weltweiten Christenheit aus.7
Falls Sie als Leserin und Leser mit „den Evangelikalen“ nicht vertraut sein sollten: Ich stelle sie im nächsten Kapitel noch näher vor.
Die 80er-Jahre gaben für mich als Teenager den Startschuss zu meiner Glaubenserfahrung. Damals konnte man relativ schnell umreißen, was die Charismatiker (und Pfingstler) von den Evangelikalen unterschied: Die Charismatiker betonten nicht nur wie oben beschrieben die Gnadengaben des Heiligen Geistes, sein übernatürliches Wirken und die damit verbundene bis ins Körperliche erfahrbare Gegenwart Gottes. Sie hatten auch eine ausgeprägte „Glaubenstheologie“.
Und sie hatten „Worship“, diese Ende der 1960er-Jahre in Neuseeland mitbegründete und dann in den frühen 1970er-Jahren durch die Jesus People-Bewegung an der Westküste der USA groß werdende Gebetsliederkultur, die allen voran von „Jugend mit einer Mission“ in den deutschsprachigen Raum gebracht wurde. Flankiert durch erste zarte Pflänzchen in Deutschland, wurden zunächst hauptsächlich Lieder aus dem angloamerikanischen Sprachraum importiert und übersetzt. Einflussreich war seit 1968 die im Zentrum der Jesus People-Bewegung agierende Calvary Chapel mit ihrem Musiklabel Maranatha! Music. Daraus ging 1977 die Vineyard-Bewegung um Gründer Kenn Gulliksen und ihren bekanntesten Protagonisten John Wimber hervor, die bald mit dem Label Vineyard Music auch musikalisch weltweit Gemeinden inspirierte.8
Fast zeitgleich sammelte das unabhängige, Kirchen übergreifende amerikanische Label Integrity Music nach seiner Gründung 1987 die beliebtesten Songs charismatischer Worship-Kultur. Ursprünglich als Subskriptionsmodell gestartet, das viermal im Jahr neue Kassetten und CDs auf den Markt brachte, wurde das Label innerhalb kürzester Zeit zu einem Global Player.
In England war bereits 1969 das Worship-Label Kingsway Music gegründet worden, das ab 1979 in der Liedersammlung Songs Of Fellowship eine Fülle neuer Anbetungssongs zusammenfasste.9 Auch heute noch, rund 50 Jahre danach, sind die führenden Vertreter der weltweiten Worship-Bewegung Charismatiker: Elevation Music, Bethel Music, Hillsong Music, Passion – oft sind die Musiklabel bekannter als die dahinter stehenden Kirchen selbst!
In charismatisch geprägtem Worship wird betont, dass Gott nahbar ist und „im Lobpreis seines Volkes wohnt“ (bezogen auf Psalm 22,4). Dass man sich folglich der Nähe und Aufmerksamkeit von Jesus gewiss sein kann, wenn eine Haltung von Lobpreis und Anbetung das alltägliche Leben prägt. Und dass der Worship damit auch zum Türöffner für das übernatürliche Eingreifen Gottes wird. Infolgedessen wurden charismatische Veranstaltungen wie Heilungsgottesdienste oder Zusammenkünfte mit Segnungsteilen (sogenannten „Ministry Times“, in denen auch der Weitergabe von prophetischen Eindrücken viel Raum gegeben wurde) oft von durchgehendem Worship begleitet.
Die Evangelikalen lehnten diese Form von Anbetung zunächst weitgehend ab und warnten wie schon ihre geistlichen Väter vor spiritueller Schwärmerei ohne Bodenhaftung. Oder um es mit anderen Worten zu sagen: vor einem allzu selbstbezogenen Glaubensvollzug, der den eigenen Erfahrungen und persönlichen Offenbarungen zu viel Bedeutung beimisst.
Seit den 1980er-Jahren ist viel passiert. Die Worship-Bewegung ist nicht länger die exklusive Domäne von Gemeinden pfingstlerisch-charismatischer Prägung. Christen unterschiedlichster Couleur sehnen sich nach einer unmittelbareren Form der Gottesbegegnung. Und auch wenn Prophetie in evangelikalen Kreisen lieber „Hören auf die Stimme Gottes“ genannt wird, hat sie dort im Laufe der vergangenen Jahrzehnte viel stärker Einzug gehalten, als dies aufgrund der langjährigen Ressentiments der Evangelikalen zu erwarten war. Und wenn geliebte Menschen erkranken, dann beten viele Evangelikale heute deutlich offensiver für körperliche Heilung als noch vor wenigen Jahren. An der Praxis dieser geistlichen Rituale kann man also die Unterschiede evangelikaler und pfingstlerisch-charismatischer Frömmigkeit nicht länger festmachen. Es sind dagegen die inneren Leitsätze und Haltungen, die sich oft unterscheiden.
Ich wurde als Kind der charismatischen Bewegung groß. Mein Vater Wolfram Kopfermann, ein begnadeter Prediger, Bibellehrer und Intellektueller, leitete zwischen 1977 und 1987 den Koordinierungsausschuss der Geistlichen Gemeinde Erneuerung (CHARGE, später GGE) innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Er lud in dieser Funktion prägende Prediger-Persönlichkeiten wie den schon erwähnten John Wimber oder auch Colin Urquhart zu Themen wie „Heilung“ und „Evangelisation in der Kraft des Heiligen Geistes“ nach Deutschland ein. Und er gestaltete an der Hauptkirche St. Petri, die an der Mönckebergstraße, der zentralsten Einkaufsstraße in der Hamburger Innenstadt, liegt, charismatische Gottesdienste. Diese verzeichneten rasch ein rasantes Wachstum: Innerhalb weniger Jahre wuchs die Besucherzahl auf über 1 000 Personen an. Über 80 Hauskreise, eine Jugendarbeit mit mehr als 150 Mitgliedern und Glaubensgrundkurse, an denen buchstäblich Tausende Gemeindeferne teilnahmen, sind nur einige Merkmale einer geistlichen Bewegung, die es bis auf die Titelseiten der einschlägigen Gazetten dieses Landes brachte. Sie polarisierte und fand gleichzeitig im gesamten deutschsprachigen Raum Sympathisanten und Nachahmer.
Inmitten dieses aufregenden geistlichen Aufbruches vertraute ich im Alter von zwölf Jahren mein Leben Jesus an und versprach, ihn als Herrn und Freund in alle wesentlichen Lebensbereiche zu integrieren – nachdem im „Kopfermanden“-Unterricht, dem Konfirmanden-Unterricht meines Vaters, an diesem Tag die „Notwendigkeit einer persönlichen Hinwendung zu Jesus Christus“ thematisiert worden war. Anfang 1980, wenige Wochen zuvor, hatte ich mich bei einem Konzert von Manfred Siebald noch nicht getraut, als der „Altarruf“ erfolgte: ein Aufruf von der Bühne, eine solche persönliche Lebenshingabe zu vollziehen. Doch nun, im Wohnzimmer meiner Großmutter auf dem Boden kniend, sprach mir mein Vater die Worte vor, die mich zu einem „hingegebenen Christen“ machen sollten. Die Entscheidung fühlte sich gut und richtig an, und schnell brachte ich mich voller Leidenschaft ins Gemeindeleben der St.-Petri-Gemeinde ein.
Ich lernte fast zeitgleich, Gitarre zu spielen, und begann noch im selben Jahr, meine ersten Lieder zu schreiben. Sie bestanden am Anfang fast ausschließlich aus Psalm- oder Kirchenliedneuvertonungen. Mit 14 Jahren übernahm ich Verantwortung als Jugend-, Teestuben- und Lobpreisleiter und lernte im Rahmen der Jugendarbeit meine spätere Frau Anja kennen. Wir sind also gemeinsam kirchlich groß geworden und teilen deswegen viele prägende Erinnerungen unserer Jugend miteinander, auch wenn wir erst neun Jahre später ein Paar wurden. Im Alter von 16 Jahren übernahm ich die musikalische Leitung in den charismatischen Abendgottesdiensten, die mittlerweile die größten regelmäßigen Veranstaltungen in der Evangelischen Landeskirche Hamburgs darstellten. Mein Bruder spielte Keyboard, und meine Mutter sang in der Band mit, die damals noch „Ansingeteam“ hieß. So stand in einem Zeitungsartikel recht plakativ: „Vater Wolfram predigt, die Familie macht Musik dazu.“ Über die Jahre haben uns viele Menschen erzählt, es habe sie sehr beeindruckt, dass wir als ganze Familie das Anliegen einer „Erneuerung der Kirche“ verkörperten.
Gottesdienste und Frühgebete unter der Woche, die Mitarbeit bei Bibelstunden und Glaubensgrundkursen sowie unzählige Aktivitäten in der Jugendarbeit füllten leicht vier bis fünf Nachmittage oder Abende meiner Woche. Da ist es fast müßig zu erwähnen, dass sich unsere Gespräche auch während des Mittagessens meist um Gemeindethemen drehten. Hinzu kamen Wochenendtagungen, Kongresse und Jugendfreizeiten in fast allen Ferien eines Jahres. Auch ein sogenannter „persönlicher Austauschpartner“ wollte im Wochenplan noch untergebracht werden. Gitarre spielen und Fußball (aktiv und passiv) nahmen da fast schon zu wenig Raum ein für einen normalen Jugendlichen, der allen Ballsportarten zugetan war und auch Tennis, Badminton und Tischtennis spielte. Erstaunlich, zu wie viel Bewegung man sich als Jugendlicher motivieren kann …
Auch war ich – wie viele Gleichaltrige in der St.-Petri-Kirche – stolz darauf, fast ausschließlich Musik mit frommen Texten zu hören und die einschlägigen Konzerte zu besuchen, die in unserer Stadt stattfanden. Kein Wunder, dass die Schule bei all dem geistlichen Programm häufiger zu kurz kam. Zumal ich in dem Elitegymnasium, das ich besuchte, schnell zum Außenseiter wurde. Zu wenig entsprach ich, was Kleidung, Statussymbole, Interessen, Musikgeschmack und nicht zuletzt auch meine Sexualethik anging, dem Verhaltenskodex meiner Mitschüler. Da war es mir nicht unlieb, dass es in unserer Jugendarbeit eine Community gab, die zu einem leidenschaftlichen Glauben ermutigte. Dort fand ich gleichgesinnte Gleichaltrige, Warmherzigkeit und Freundschaft, Kreativität und Ferienprogramme, eine ehrliche Sehnsucht nach Gott und der Begegnung mit ihm, Musik, die ich liebte, und den Stolz, Teil eines geistlichen Aufbruchs zu sein, der buchstäblich das Leben von Tausenden von Besuchern prägte und veränderte.
1988 trat mein Vater aus der Landeskirche aus und gründete die charismatisch-freikirchliche Anskar-Kirche. Ein Paukenschlag nicht nur in der christlichen Welt allgemein, sondern auch für die Mitglieder von St. Petri, die durch meinen Vater ermutigt worden waren, an eine Erneuerung der Kirche zu glauben, und die diesen Schritt nur schwer nachvollziehen konnten. Seine Entscheidung führte zu einer Gemeindespaltung, in deren Folge sich der größere Teil ihm und der neuen Anskar-Kirche anschloss. Ich hatte nach meinem Abitur gerade ein soziales Jahr bei dem charismatischen Missionswerk „Projektion J“ in Hochheim absolviert, das eng mit der geistlichen Gemeindeerneuerung in der Landeskirche verbunden war, und wurde direkt im Anschluss musikalischer Leiter der nun neu gegründeten Anskar-Kirche. Ich studierte nebenbei ein Semester lang Theologie an der Universität Hamburg, bevor ich das Studium abbrach, weil ich mir nicht länger eine Zukunft als Prediger mit Talar und Beffchen vorstellen konnte. Stattdessen besuchte ich für drei Monate verschiedene Vineyard-Gemeinden in den USA, um mir über meine Zukunft und meine Berufung klarzuwerden. Noch in den Staaten begann ich, ein erstes Arbeitsbuch über Lobpreispraxis im Anskar-Eigenverlag zu schreiben, veröffentlichte kurz nach meiner Rückkehr eine erste CD mit Gemeindeliedern und absolvierte fast nebenbei die ersten Semester in Soziologie. Ich verbrachte gemeinsam mit Anja ein halbes Jahr an einer „Jüngerschaftsschule“ (ein geistliches Laien-Ausbildungsprogramm für junge Erwachsene) von „Jugend mit einer Mission“ auf Hawaii und in Japan, heiratete und leistete danach meinen Zivildienst in der Heimstätte einer Pfingstgemeinde ab, während ich zeitgleich jüngster Ältester, also angestellter Teil der Gemeindeleitung in der Anskar-Kirche war. Ich studierte im Anschluss ein Jahr am Anskar-Kolleg Theologie und wurde dann hautnah Zeuge einer weiteren Gemeindekrise.
Die Gemeindeleitung hatte die „Naherwartung einer Erweckung“ ausgerufen und plante nun, eine „Erweckungshalle“ mit 2 000 Sitzplätzen zu bauen. Jetzt wurde richtig Gas gegeben: Die Frequenz der Erweckungswochen mit allabendlichen Zusammenkünften wurde erhöht. Vermögende sollten im Gebet prüfen, ob sie nicht einen Teil ihrer Erbschaften oder sonstigen Besitzstände für den Bau zur Verfügung stellen konnten. Die gesamte Gemeinde wurde aufgefordert, sich selbst zu einem „radikalen Lebensstil“ zu verpflichten, wozu zum Beispiel eine Gebetszeit von mindestens einer Stunde pro Tag gehörte. Das war dann vielen doch des Guten zu viel.
„Erweckung“ im Sinne der Erweckungsbewegung bezeichnet ein einschneidendes persönliches Erlebnis des plötzlichen Ergriffenseins durch Gott, das zu einer „radikalen Kehrtwende“ im Leben und zur „ganzheitlichen Hingabe“ an Gott führt. Von Erweckung ist insbesondere dann die Rede, wenn das Phänomen dieses Erlebnisses nicht nur bei einzelnen Gläubigen auftritt, sondern eine Gruppe von Personen oder eine ganze Region erfasst wird, wenn also die Veränderung im Leben Einzelner plötzlich die Veränderung einer Vielzahl von Menschen zur Folge hat. Heute werden vergleichbare kollektive Ereignisse eher „Geistlicher Aufbruch“ genannt.10
Für soziales Leben neben der Gemeinde blieb nicht nur für die Hauptamtlichen kaum noch Zeit. Unser Gemeindepastor (mein Vater fungierte als Hauptpastor) mahnte in seiner Verantwortung einige der daraus resultierenden Missstände an. Am Ende dieses schmerzlichen Prozesses von divergierenden Ansichten stand eine weitere Gemeindeteilung, in deren Folge er mit einigen Dutzend Austrittswilligen die erste Hamburger Vineyard-Gemeinde gründete. Die „Erweckungshalle“ wurde nie gebaut.
Anja und ich spürten in dieser Phase, dass eine Luftveränderung anstand. Es würde uns guttun, für eine Weile aus dem geistlichen Schatten meines Vaters herauszutreten und auf eigenen Beinen zu stehen. So zogen wir 1995 ins Rhein-Main-Gebiet und planten, dort nur die nächsten drei Jahre zu verbringen – wurden aber für die nächsten 23 Jahre aktiver und mitgestaltender Teil einer größeren charismatischen Gemeinde in Frankfurt. Ich reiste fortan aber auch als Lobpreismusiker und -referent durch den deutschsprachigen Raum, um Seminare und Konzerte zu geben, und wurde dazu von den unterschiedlichsten Kirchen und Prägungen eingeladen. Nach dem Hauptstudium der Soziologie mit Schwerpunkt Medien in Frankfurt und einem kurzen Popstudiengang in Hamburg übernahm ich von 1999 bis 2011 die Rolle als A&R Direktor11 und Haus-Produzent für den Bereich „Pop & Lobpreis Musik“ (national wie international) im christlichen Verlagshaus Gerth Medien, um mich danach als christlicher Musiker und Produzent selbstständig zu machen.
Gerade in diesen ersten Jahren bei Gerth Medien wurden wir hautnah Zeugen eines Schulterschlusses von evangelikalen und charismatischen Christen, wie es ihn bis dahin noch nicht gegeben hatte. Viele waren die Grabenkämpfe leid, die die alten Recken der Bewegungen über Jahre ausgefochten hatten, und begannen, sich nun im Rahmen von Veranstaltungen der Deutschen Evangelischen Allianz wohlwollend zu „beschnuppern“. Die alljährlich stattfindende Allianz-Gebetswoche, das Gemeindeferienfestival „Spring“, aber auch die Willow Creek-Konferenzen boten einen fruchtbaren Nährboden für eine wachsende Ökumene unter den Freikirchen, die auch vor den Landeskirchen nicht haltmachte. Bleibende Freundschaften entstanden nicht nur im „Fußvolk“, sondern auch unter einigen der geistlichen Leiter. Dies wäre vorher aus ideologischen Gründen oft undenkbar gewesen! Wenn es jedoch einen Klebstoff gab, der die evangelikale und die charismatische Welt auf diese Weise verbinden konnte, dann war es die sich nun auch in der evangelikalen Welt wie ein Lauffeuer ausbreitende Worship-Kultur. Anfänglich wurde oft nur das charismatische Liedgut übernommen und punktuell in die Gottesdienste eingestreut. Der eigentliche Schwerpunkt lag dort weiterhin auf der Predigt („Wortverkündigung“). Doch durch ökumenische Großveranstaltungen, Anbetungsseminare und Bücher der prägenden Leitfiguren, die in aller Regel pfingstlerisch-charismatischer Prägung entstammten, etablierte sich mit den Jahren im evangelikalen Lager eine neue Anbetungskultur. Diese maß der innigen Zwiesprache mit Gott wesentlich mehr Gewicht bei, als dies vorher in den deutlich kopflastigeren evangelikalen Veranstaltungen der Fall gewesen war.
Ich war eine dieser Leitfiguren, die den beschriebenen Prozess befeuerte – als Verlagsverantwortlicher in Sachen Worship, durch Übersetzungen und eigene Lieder, als Herausgeber von Liederbüchern, durch Musikproduktionen, Seminare und Lobpreisleitung auf diversen Kongressen und Großveranstaltungen. Aber auch durch Events in Kirchengemeinden unterschiedlichster Prägung, als Kontaktperson für viele christliche Künstler aus den USA, deren Vertriebe ich durch zähe Verhandlungen zu Gerth Medien geholt hatte und die nun verstärkt Deutschlands Festivalbühnen bereisten. Es war ein aufregendes und extrem kräftezehrendes Jahrzehnt. Wenn es mein übervolles berufliches Leben zuließ, brachte ich mich auch noch intensiv in die Musikarbeit unserer Gemeinde ein und initiierte die „Ichthys Worship Night“, einen regelmäßigen Event für Frankfurter Christen.
2007, ich wurde in diesem Jahr 40, spürte ich zum ersten Mal, dass ein größerer Einschnitt bevorstand. Damals empfand ich die dringende Notwendigkeit, mehr Ruhephasen in mein Leben einzubauen und ein bisschen vom sinnbildlichen Gaspedal zu gehen, das ich fast durchgängig durchgetreten hatte.
Damals schrieb ich dazu in einem Buchartikel folgende Zeilen:
„Berufung ist wohl, wenn einem irgendwann als Christ ein Thema besonders wichtig und man es danach nicht wieder loswird. Bei mir heißt dieses Thema ‚Lobpreis und Anbetung‘. Ganz früh habe ich gemerkt, dass ich eine brennende Leidenschaft dafür empfinde, Gott mit guter Musik und tief gehenden Texten anzubeten. Mehr noch, dass ich andere Menschen dazu ermutigen möchte, das ebenfalls zu tun und nicht reserviert oder emotional unbeteiligt zu bleiben, wenn sie ihrem Gott begegnen. Dieser Wunsch hat mich seit meinen Teenagerjahren begleitet. Und später haben mir immer wieder Menschen von außen bestätigt, dass Gott diesen Antrieb in mein Herz gepflanzt hat, weil er zu seinem Plan gehört …
Zurückschauend sieht mein bisheriger Lebensweg für Außenstehende sicher recht zielstrebig und vorgezeichnet aus; für mich selbst hat sich das aber durchaus nicht immer so angefühlt. Musiker neigen dazu, ihren Selbstwert davon abhängig zu machen, wie das Publikum auf ihre künstlerischen Ergüsse reagiert. Bleiben Erfolg und Zuspruch eine Zeit lang aus, dann fühlt man sich leicht unterschätzt und unverstanden, und die Zweifel beginnen, unablässig an der Seele zu nagen. In solchen Zeiten habe ich auf die harte Tour lernen müssen, dass mein Selbstwert von Gott definiert wird und nicht vom Beifall meiner Zuhörer oder den Verkaufszahlen meiner CDs.
Enorm geholfen hat mir dabei, bewusst daran festzuhalten, von Gott berufen zu sein. Mir die konkreten Worte in regelmäßigen Abständen wieder und wieder in Erinnerung zu rufen, die Gott durch andere Christen in mein Leben hineingesprochen hat. Oft erschienen sie mir am Anfang zwei oder drei Nummern zu groß, aber im Laufe der Jahre habe ich viele nachprüfbare Details Wirklichkeit werden sehen.
Dass Gott meinen Weg vorgezeichnet hat, ist mir auch an der großen Schwelle besonders bewusst geworden, als die ich meinen vierzigsten Geburtstag sehe. Seit meiner Bekehrung … habe ich kein Jahr erlebt, in dem Gott so deutlich und unmissverständlich zu mir gesprochen hat wie in dem Jahr vor meinem Vierzigsten. Und das auf ganz vielfältige Art und Weise. Da war diese zunehmende innere Unruhe, dass größere Veränderungen anstehen. Dazu einige konkrete Umbruchssituationen in meinem privaten Umfeld. Und parallel kam innerhalb von acht Monaten eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Menschen auf mich zu, die mir prophetische Worte auf den Kopf zugesagt haben. Manche aus Deutschland, andere aus dem Ausland; einige, die mich kannten, und andere, die ich noch nie im Leben persönlich getroffen hatte.
Was sich wie ein roter Faden durch alle diese Worte hindurchzog, war die Aussage, zur Ruhe zu kommen und auch mein Arbeitsaufkommen zu reduzieren, um Raum für meine Berufung zu schaffen. Einige berufliche Aktivitäten zu unterlassen oder erheblich einzuschränken, die zwar gut und richtig erscheinen, aber den Fokus wegnehmen von dem, was Gott für mich vorgesehen hat …
Der neue Weg erfordert momentan einige ganz konkrete Glaubensschritte. Eine der Konsequenzen wird sein, meine Arbeit in der Plattenfirma erheblich zu reduzieren, um Zeitressourcen freizusetzen und damit auch die Sicherheit einer vollen Anstellung aufzugeben, obwohl wir gerade als Familie ein Haus gebaut haben. Auch kann ich als Musiker – menschlich gesprochen – nicht zwingend davon ausgehen, dass meine Kompositionen und Konzerte in einigen Jahren immer noch so gefragt sein werden wie heute.
Aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann gibt es im Leben sowieso keine Sicherheiten, die nicht erschüttert werden können. Und wenn Gott so deutlich einen Auftrag gibt, dann ist es grob fahrlässig, nicht auf ihn zu hören und stattdessen auf die scheinbare ,Nummer sicher‘ zu gehen. Ich bin Jesus sehr dankbar, dass er so massiv und wiederholt angeklopft und um meine Aufmerksamkeit geworben hat. Das macht es mir jetzt in der Zeit des Übergangs leichter, nicht den alten Sicherheiten nachzutrauern, sondern aus der Perspektive des Glaubens zu leben.
Jeder, der mich besser kennt, weiß, dass ich zu einer Mischung aus Perfektionismus und Workaholismus neige und meine Finger unermüdlich Monat für Monat in mehreren Projekten gleichzeitig habe. Auch, dass ich meine Arbeit liebe und in ihr aufgehe. Das mag eine gewisse Stärke von mir sein, aber es kann zuweilen auch den Blick auf das Wesentliche verbauen. Und umso deutlicher nehme ich in dieser Lebensphase den Anspruch Gottes an mich wahr, nicht selbst ‚Macher‘ zu sein, sondern ihn ‚machen zu lassen‘ und noch viel stärker als bisher aus der Abhängigkeit von ihm zu leben.
Xavier Naidoo hat uns während der Fußball-WM 2006 ins Herz gesungen: ‚Dieser Weg wird kein leichter sein; dieser Weg ist steinig und schwer.‘ Das ist aber nur die eine Seite. ‚Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein … nichts Gegenwärtiges und auch nichts Zukünftiges!‘ (Römer 8,31 – 39). Und darum freue ich mich auf die neuen Herausforderungen des nächsten Lebensjahrzehntes. Denn das Leben aus der Abhängigkeit von Gott birgt erhebliches Wunderpotenzial in sich. Langweilig wird es da auch ab Vierzig nicht!“ 12
Ich ahnte nicht, dass mein Leben im nächsten Jahrzehnt auf den Kopf gestellt werden würde. Sieben Jahre nachdem ich geschrieben hatte, dass es keine Sicherheiten gäbe, die nicht erschüttert werden können, sah ich mich im September 2014 aus heiterem Himmel mit dem schmerzhaftesten Einschnitt unseres bisherigen Lebens konfrontiert. Bei einem Autounfall verloren wir unsere zehnjährige Tochter Sara. Nach der Kollision mit einem Taxi war unsere Kleine wahrscheinlich sofort tot, auch wenn wir mit ihr noch zehn Tage und Nächte zwischen Beten und Bangen, Festhalten und Loslassen auf der Intensivstation verbrachten.
Ich hatte geschrieben, dass das Leben aus der Abhängigkeit von Gott erhebliches Wunderpotenzial in sich berge. Und nun sah ich mich mit der niederschmetternden Situation konfrontiert, dass Tausende von Menschen mit uns um ein Wunder gebetet hatten, dieses Wunder aber ausgeblieben war.
Ich bin überzeugt: Es kann keine tragfähige Theologie geben ohne Einbezug der eigenen Lebensgeschichte! Innerhalb weniger Millisekunden wurde das Leben meiner gesamten Familie in seinen Grundfesten erschüttert. Ich war das Auto gefahren. Am helllichten Tag. Nur wenige Kilometer vom Ziel entfernt. Nicht alkoholisiert. Nicht übermüdet. Nicht mit überhöhter Geschwindigkeit, sondern beinahe im Schritttempo auf die Vorfahrtstraße abbiegend. Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit mit verheerenden Folgen. So abgrundtief sinnlos.
„Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen … Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest“ (Luther).
Stand es nicht so in Psalm 91? Derselbe Gott, der uns verspricht, dass uns nichts Böses zustoßen wird, hatte dennoch nicht verhindert, dass wir mit dem Taxi zusammenstießen. Es gab also zumindest für uns keinen versprochenen Schutzautomatismus, der uns vor Schlimmerem bewahrte. Im Gegenteil: Uns war das Schlimmste zugestoßen, was sich Eltern überhaupt vorstellen können. Meine Familie war auf die Urgewalt des Schmerzes nicht vorbereitet, der von einem Tag auf den anderen über unser Leben hereinbrach und seitdem seinen festen Platz einfordert – wenn auch in sich verändernder Intensität. Es ist sicherlich nicht übertrieben zu behaupten, dass Saras Tod alles auf den Prüfstand stellte. Auch wenn Anja und ich von der ersten Sekunde an die innere Gewissheit in uns trugen, dass sie an dem Ort, an dem sie jetzt war, gut aufgehoben ist.
Aber unser Beruf, unsere Prioritäten, unser Zusammenleben, unser Gottesbild und die zugehörigen Leitsätze, die wir uns für unser Leben zu eigen gemacht hatten, mussten erst einmal unter Beweis stellen, dass sie im Angesicht der Trauer nicht zerbröseln wie Sand im Wind. Schnell wurde mir klar, dass es meiner Art entspricht, diesen Prozess in Liedern und Texten öffentlich zu machen.
Das Erlebte hat tiefe Spuren hinterlassen. Wir hatten 2017 Silberhochzeit, haben sie aber nicht gefeiert. Zu tief saß auch knapp drei Jahre danach noch immer der Schmerz des Verlustes. Zu spürbar war die Zerbrechlichkeit des Lebens, die auch vor unserer Ehe nicht haltmachte. Es war mir auch nicht danach, meinen 50. Geburtstag groß zu feiern, obwohl es ja ein runder Geburtstag war. Ich hätte nicht mehr so vollmundig sagen können: „Und darum freue ich mich auf die neuen Herausforderungen des nächsten Lebensjahrzehntes“, wie mir das zehn Jahre zuvor noch so leicht aus der Feder geflossen war.
Alle Schätze der Erkenntnis
Wie ein Buch mit sieben Siegeln muten Deine Pläne an
Ich würd mich gern in Dir spiegeln
Spüre, dass ich das nicht kann
Warum bleibst Du mir verborgen
Wenn ich doch vertrauen will
Könnt ich mir Dein Wissen borgen
Wär wohl meine Seele still, doch ich weiß nicht viel
Alle Schätze der Erkenntnis sind verborgen, Gott, in Dir
Doch Du bleibst nicht im Verborgnen:
Wie ich bin, begegne mir
Wie gern würd ich tiefer graben und wie gerne weiter sehn
Wie gern Sicherheiten haben, wenn die Stürme um mich wehn
Doch im Auge dieser Winde finde ich den Gott, der trägt
Find ich erst in mir das Kinde, das sich Dir zu Füßen legt, in Deine Arme legt
Manchmal muss ich mit Dir ringen
Ist der Blick auf Dich verstellt
Dann will ich kein Loblied singen
Wenn die Not der Welt mich quält
Doch Dein göttliches Erbarmen
Trägt mich durch in schwerer Zeit
Ich vertraue Deinem Namen:
Du bist mit uns, auch im Leid, Du bist niemals weit
Meine Frau und ich haben uns nicht aufgegeben. Wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt oder den Glauben an den Nagel gehängt, obwohl wir menschlich gesprochen jedes erdenkliche Recht dazu gehabt hätten. Wir sind kein bitteres, zynisches Paar geworden, das nur noch rückwärtsgewandt lebt oder das Lebensende herbeisehnt. Und das ist gar nicht selbstverständlich! Ich sagte eingangs, dass Glaube ein Muskel ist, den man im Laufe seines Lebens trainieren kann. Dass es aber auch die Krankheit des Muskelschwundes gibt, die sinnbildlich gesprochen den Glauben erfassen kann, wenn tiefe Erfahrungen von Leid, Verlust oder himmelschreiender Ungerechtigkeit in unser Leben treten. Dann brauchen wir den Glauben als Geschenk.
Viele Menschen haben mich seit unserem Unfall gefragt, warum ich meinen Glauben nicht verloren habe. Meine erste, fast reflexartige Reaktion war, das könnte daran liegen, dass so viele Menschen für uns gebetet haben. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto unsinniger erschien mir die Antwort. Denn wenn der Vater im Himmel ein gerechter Gott ist, dann kommt es nicht auf die Anzahl der Gebete an. Dann kann jemand, der nicht wie ich in der Öffentlichkeit steht, genauso darauf hoffen, dass Gott die Gebete der wenigen Menschen in seinem Umfeld erhört. Viele Christen, die existenzielle Verluste erleiden müssen, verzweifeln erst einmal an ihrem Glauben. Das kann ich ihnen nicht verdenken. Ich kann nur meine Geschichte erzählen und hoffen und beten, dass sie ihnen Mut macht, nicht aufzugeben.
Eine wesentliche Aufgabe, die meine Frau und ich unabhängig voneinander bewältigen mussten, bestand darin, eine gründliche Inventur unseres Glaubenslebens vorzunehmen. Wir mussten die Leitsätze unter die Lupe nehmen, die wir zum Teil schon seit unserer Kindheit in uns trugen. Die Prinzipien, die wir für uns als Wahrheit erachteten. Die Begleiterscheinungen, die wir als Teil unserer Frömmigkeit begrüßten, akzeptierten oder wenigstens duldeten. Die Strukturen, in denen wir uns eingerichtet hatten, wenn auch manchmal mit einem mulmigen Gefühl in der Magengrube. Und auch die Methoden, mit denen in unserem geistlichen Umfeld gearbeitet und Gemeindeaufbau betrieben wurde. Wir mussten uns den bohrenden Fragen unserer vom Schmerz aufgewühlten Herzen stellen und einige drastische Schritte unternehmen, die zum Teil schon längst überfällig waren.
Ein aus unseren Überlegungen erwachsener Schritt, den Anja und ich glücklicherweise gemeinsam vollzogen, war das Verlassen unserer langjährigen Gemeinde. Kein leichter, denn sie war mehr als zwanzig Jahre lang unsere geistliche Heimat gewesen – also beinahe unser halbes Leben lang. Ich habe seitdem mit einigen Freunden und Wegbegleitern gesprochen, die in unserem Alter sind und aus den unterschiedlichsten Gründen in den vergangenen Jahren einen ähnlichen Schritt vollzogen haben. Ihre Berichte weisen viele Ähnlichkeiten auf. Für uns war die Entscheidung gut! Anja und ich erleben es heute als großen Segen, ein neues geistliches Zuhause gefunden zu haben, das zu uns und unseren teilweise im Erleben von persönlichem Leid neu gewonnenen Überzeugungen passt.
Der Würzburger Pastor Volker Halfmann hat ein Buch geschrieben, in dem er auf sehr authentische Art und Weise Einblick in seinen Kampf mit Zwangsstörungen, Depressionen und Süchten gibt. Es trägt den vielsagenden Titel Mein goldener Sprung in der Schüssel und hat ein bemerkenswertes Cover. Darauf ist das Foto seines Kopfes zu sehen, durch den kleine Linien aus Gold und Silber laufen. Das Bild nimmt Bezug auf die wunderschöne mittelalterliche japanische Kunstform des Kintsugi und benutzt diese als Allegorie für die Seele des Menschen:
„Kintsugi ist eine traditionelle japanische Reparaturmethode für zerbrochene Keramik. Der Legende nach geht diese Kunst zurück auf Ashikaga Yoshimasa, einen militärischen Anführer des 15. Jahrhunderts. Als ihm eine überaus wertvolle chinesische Teeschale zerbrach, gab er japanischen Kunsthandwerkern den Auftrag, eine Methode zu entwickeln, mit der sie in neuem Glanz erstrahlen würde. Das war die Geburtsstunde von Kintsugi. Das Einzigartige an dieser Reparaturmethode ist, dass die Zerbrochenheit der Keramik nicht verdeckt werden soll, sondern geradezu hervorgehoben wird. Dies geschieht, indem die einzelnen Bruchstücke mit Urushi-Lack geklebt werden, einem japanischen Speziallack, der anschließend mit Gold oder Silber verziert und lackiert wird. Sollten einzelne Scherben fehlen, so werden diese durch mehrere Schichten von Urushi-Kittmasse ergänzt. Das Ergebnis ist erstaunlich. Denn dort, wo vorher die Bruchstellen waren, ziehen sich nun Gold- oder Silberadern durch das Gefäß und verleihen diesem eine einzigartige Ausstrahlung.
Was mich an Kintsugi sofort fasziniert hat, ist das Schönheitsideal, das hinter dieser Kunst steht. In Japan wird diese Ästhetik ,Wabi-Sabi‘ genannt. Sie ist geprägt von der Überzeugung, dass man gerade auch im Fehlerhaften und Vergänglichen eine einzigartige Schönheit erkennen kann. Denn nicht die Makellosigkeit eines Objektes ist entscheidend, sondern vielmehr der besondere Glanz, der von ihm ausgeht. Bei Kintsugi entsteht dieser Glanz gerade in der Zerbrochenheit.“ 13
Einen ähnlichen Gedanken finden wir in 2. Korinther 4, Verse 6 und 7, wo Paulus schreibt: „Denn so wie Gott einmal befahl: ,Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen!‘, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst“ (Hervorhebung des Autors).
Zwei gemeinsame Konzertlesungen mit Volker haben mich inspiriert, das Bild von Kintsugi aufzugreifen und einen Song aus der Perspektive Gottes zu schreiben. Ich möchte ihn an das Ende dieses Kapitels stellen – „Kintsugi-Herz“:
Kintsugi-Herz
Es kam anders als erwartet und es ließ dir keine Wahl
Warst so lebensfroh gestartet, gehst jetzt durch ein tiefes Tal
Etwas in dir ist zerbrochen, das so schnell nicht heilen kann
Es bleibt meist unausgesprochen
Doch das ändert nichts daran
Ich seh dich, ich hör dich
Kintsugi-Herz, ich füll die Risse aus mit Gold
Kintsugi-Herz, du bist geliebt, du bist gewollt
Kintsugi-Herz, ich hüte dich wie ein Juwel
Denn du bedeutest mir so viel, Kintsugi-Herz
Da ist Winter in der Seele, eine Eisschicht um dein Herz
Und ein Kloß in deiner Kehle von Oktober bis zum März
Dieses Leben schlägt dir Narben, manche hast du gut verhüllt
Haben sich tief eingegraben und dein Inneres aufgewühlt
Ich seh dich, ich hör dich
Ich sehe dich voll Liebe an
Ein naher Gott, der deine Schmerzen spüren kann
Der mit dir weint und mit dir lacht
Und ich verspreche dir, ich geb gut auf dich acht
7 https://www.learnreligions.com/christianity-statistics-700533, abgerufen am 18.02.2020.
8 Ausführlicher beschrieben von einem der einflussreichsten Insider in der europäischen Worship Community und vielleicht auch darüber hinaus: Les Moir: Missing Jewel. The Worship Movement That Impacted The Nations. Eastbourne 2017, S. 125 ff.
9 https://www.crossrhythms.co.uk/articles/music/Songs_Of_Fellowship_Chronicling_the_history_of_the_popular_worship_series/36496/p1; abgerufen am 18.02.2020.
10 Vgl. Zwischen Aufklärung und Moderne. Erweckungsbewegungen als historiographische Herausforderung. In der Reihe Religion – Kultur – Gesellschaft. Studien zur Kultur- und Sozialgeschichte des Christentums in Neuzeit und Moderne, Band 5. Hrsg. von Thomas K. Kuhn und Veronika Albrecht-Birkner, Münster 2017.
11 A&R steht für Artist & Repertoire. Die Aufgabe dieser Mitarbeiter einer Plattenfirma besteht darin, die Künstler unter Vertrag zu nehmen und mit ihnen die Veröffentlichungen zu planen. Darüber hinaus sind sie mit dem vorhandenen Repertoire vertraut, dem sogenannten Back-Katalog, und kümmern sich um dessen Zweitverwertung in Form von Compilations (Sampler).
12 Martin Gundlach, Hrsg.: Jahrgang 1967. 14 Zwischenbilanzen zum Vierzigsten. Wuppertal 2007, S. 37 – 46.
13 Volker Halfmann: Mein goldener Sprung in der Schüssel. Wie ich als Pastor mit meinen Zwangsstörungen und der Alkoholabhängigkeit lebe. Holzgerlingen 2019, S. 162 – 163.