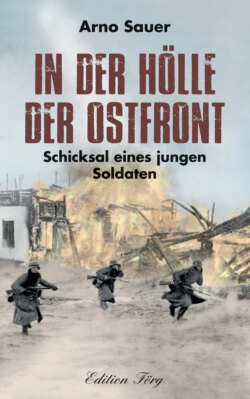Читать книгу In der Hölle der Ostfront - Arno Sauer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIm RAD-Musterlager Gau Moselland
An einem wunderschönen Frühlingsmorgen nach einem langen, harten Winter 1940/41 brachte mich der Zug an die luxemburgische Grenze. Beim Hinausschauen aus meinem 3. Klasse-Abteil, ausgestattet mit unbequemen, harten Holzbänken, konnte ich die herrliche Landschaft bewundern, die in voller Blütenpracht an mir vorbeizog.
Einige Tage zuvor hatte ich, vier Wochen nach Abschluss meiner Friseurlehre, den Einberufungsbefehl zum RAD (Reichsarbeitsdienst) erhalten. In dem amtlichen Schreiben wurde mir mitgeteilt, dass ich ein Jahr lang im »Musterlager Gau Moselland« in Irrel an der luxemburgischen Grenze eingesetzt werden würde und zu dem aufgeführten Termin dort pünktlich zu erscheinen hätte. Ich packte also am Vorabend neben einigen persönlichen Dingen die wenigen Utensilien, die in dem »Einladungsschreiben« aufgeführt waren, in einen kleinen alten Koffer, verabschiedete mich am nächsten Morgen schweren Herzens von Mutter und meinen Brüdern und marschierte zu unserem Bahnhof.
Die Bahnfahrt führte anfangs auf vertrauten Wegen über Mayen, wo ich die Berufsschule besucht hatte, weiter über Daun, Gerolstein, Kyllburg, Bitburg bis nach Irrel. So fuhr ich mit 17 Jahren zwar kostenlos, aber mit einem mulmigen Gefühl der Ungewissheit quer durch unsere schöne Eifel einem Ziel entgegen, das ich mir nicht ausgesucht hatte und das ich auch nicht aufsuchen wollte.
Mit jedem Kilometer, der mich weiter von zu Hause entfernte, wuchs in mir ein eigenartiges Unbehagen, gemischt mit Heimweh. Da halfen auch die guten Schmalzbrote nichts, die mir Mutter noch im letzten Augenblick eingepackt hatte und die ich nun mit mäßigem Appetit verdrückte. Viele Gedanken, Erinnerungen und Episoden meiner noch nicht allzu großen Vergangenheit liefen wie in einem Film an mir vorbei.
Ich 1940 während der Friseurlehre
Ich erinnerte mich an meine kurze Jugendzeit und an so viele schöne und traurige Begebenheiten, etwa den frühen Verlust meines Vaters, der mich auf all meinen Wegen nur in meinen Gedanken und in meinem Herzen begleiten konnte. Mit erst 17 Jahren musste ich mich den Anforderungen des Regimes im Kriegsalltag stellen, und die waren hart. Lamentieren, ausheulen und herumjammern lag uns fern, Unbotmäßigkeit konnte sogar das Leben kosten. Es blieb nur, den Blick nach vorne zu richten, hellwach zu bleiben und dabei im wahrsten Sinne des Wortes die »Flöhe husten zu hören«, wie das schöne Sprichwort lautete. Es war überlebenswichtig, sich auf spontane Situationen ohne Angst einzustellen, ohne gleich zu resignieren.
Während ich durch das monotone Fahrgeräusch der Eisenbahnwaggons über vergangene Begebenheiten vor mich hin grübelte, musste ich schmunzelnd an eine Geschichte zurückdenken, die dank meines Bruders Karl im letzten Moment zu meinen Gunsten entschieden worden war. War mir Karl bei unseren rivalisierenden »Böckchen-Kämpfen« draußen im Hof oder in der Scheune in jungen Jahren stets unterlegen gewesen, so hatte ich im fortgeschrittenen Alter jenseits der 14 gegen ihn keine Chance mehr. Karls enorme Körperkräfte luden nicht mehr zu einem Kräftemessen ein.
Ich weiß noch gut, dass Mutter sich eines Tages darüber beklagte, dass die Hühner in der Scheune kaum noch Eier legen würden, und sie führte den Verlust in erster Linie auf einen Marder zurück. Nach vielen Wochen wurde der Marder schließlich gefasst, doch er hatte nur noch zwei Beine und hieß mit Vornamen Karl. Der junge und schnell wachsende Knabe verspeiste heimlich und unentdeckt seit Langem an manchen Tagen zehn bis zwölf Eier, indem er sie einfach roh aussaugte. Er hatte angeblich immer Hunger, und der süße Eidotter schmeckte ihm besonders gut. Es waren aber nicht nur die vielen Eier, sondern auch unsere stets frische Kuhmilch, der zusätzliche Speck und der Extralöffel Schmalz beim Mittagstisch, die dazu führten, dass Karl so kräftig wurde. Ich wiederum mochte kein Fett, sodass mein Anteil auf dem Teller meines Bruders landete. Aber gewiss spielten auch die Erbanlagen und vor allem die schwere körperliche Arbeit von klein auf in unserem landwirtschaftlichen Betrieb eine nicht unwesentliche Rolle.
Nun, warum ich das erwähne? Es trug sich an einem Nachmittag zu, dass ich wieder einmal auf dem Sportplatz meinem Hobby nachging und mit anderen Jungs Handball spielte. Das ging so lange gut, bis auf einmal zwei etwas ältere Mitspieler meinen Ball klauen wollten, weil sie mir meine überlegene Technik neideten und sich über ein verlorenes Spiel ärgerten. Als sie damit abhauen wollten, gerieten wir uns heftig in die Wolle, wobei meine Chancen sehr schlecht standen. Noch während der Streiterei und angesichts meiner Hilferufe lief ein anderer Mitspieler zu uns nach Hause und rief unseren Karl, der seinem Bruder Fritz zu Hilfe eilte. Obwohl die beiden Gegner deutlich älter waren als er, mischte er sie ohne Probleme auf, sodass ich noch einmal glimpflich mit ein paar Kratzern davonkam und auch meinen geliebten Handball aus dem Getümmel retten konnte.
Die quietschenden Bremsen der Dampflokomotive beim Einfahren in den Bahnhof von Bitburg holten mich aus meinen Gedanken zurück in die Realität. Nun war es nicht mehr weit, und ich sah den auf mich zukommenden Ereignissen optimistisch entgegen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich darin eine erfreuliche neue Herausforderung sah, nach der ich mich gesehnt hätte. Ganz im Gegenteil wäre ich nur zu gerne bei Mutter zu Hause geblieben und als frisch gebackener Geselle meinem Beruf nachgegangen. Jedoch waren in dieser Zeit alle aus meinem Jahrgang und den älteren Jahrgängen irgendwo weit weg unterwegs, eingezogen zur Wehrmacht, in der militärischen Ausbildung oder bereits an der Front.
Ich nahm diese neue Herausforderung an und machte mich gemeinsam mit vielen anderen Kameraden meines Alters, die ich bereits auf der Hinfahrt im Zug kennengelernt hatte, auf den Weg. Wir alle hatten den gleichen Marschbefehl, und so marschierten wir gemeinsam vom Bahnhof in Irrel los, um zum festgesetzten Zeitpunkt durch das Tor an der Wache des RAD-Lagers Gau Moselland einzuziehen.
Nach kurzer Einweisung und dem Empfang von Uniform, Ausrüstungsgegenständen und dem berühmten Spaten, dem Symbol des Arbeitsdienstes, bezogen wir Quartier in einer der zahlreichen Baracken. Auf jeder Stube waren zwanzig Mann in zehn Doppelbetten untergebracht. Einen Spind teilten wir uns zu zweit.
Von nun an war täglich morgens um 5 Uhr Wecken angesagt, und dies erfolgte mit lautem Geschrei. Schon am ersten Tag begannen wir mit dem Frühsport. Anschließend ging es im Laufschritt mit freiem Oberkörper über den Appellplatz zu den Waschräumen. Danach stand Stuben- und Revierreinigen auf dem Plan, wobei man uns in kürzester Zeit eindeutig und unmissverständlich vermittelte, was zu tun war. Danach ging es zum Frühstück, das ständig sehr mager ausfiel, was zur Folge hatte, dass der Hunger unser ständiger Begleiter war.
Daran änderte auch die um 9 Uhr anstehende zweite Frühstückspause nichts, denn es gab meist nichts mehr, das wir noch hätten frühstücken können. Nur gelegentlich gab es noch ein paar trockene Brotscheiben, die vom Frühstück übrig waren, und wir verschlangen sie gierig.
Am zweiten Tag stand die medizinische Untersuchung zur Diensttauglichkeit an, und es waren alle tauglich. Auch einige luxemburgische Kameraden meines Jahrganges, die nur wenige Kilometer entfernt auf dem anderen Ufer des Flüsschens Sauer zu Haus waren, leisteten hier mit uns gemeinsam Arbeitsdienst. Diese Jungs waren verständlicherweise noch weniger begeistert als wir, und auch bei uns war die Motivation eher bescheiden. Ich fand allerdings die luxemburgische Sprache mit ihrem singenden Tonfall angenehm. Da wir auch Dialekt, das sogenannte Moselfränkisch, sprachen, konnten wir uns untereinander recht gut verständigen.
Die medizinische Untersuchung führte ein Unterarzt im Range eines Leutnants durch, und sie war schnell vollzogen. Größe, Gewicht, einmal bücken, noch ein paar Eintragungen, fertig.
Anschließend begann der allgemeine Dienst, der über Monate hinweg immer in ähnlicher Form ablief. Frühsport gab es an jedem Tag und bei jedem Wetter. Manchmal stand Sport auch noch ein zweites Mal am Nachmittag oder Abend auf dem Plan. Das spielte mir voll in die Karten, denn ich liebte den Sport und konnte mein Hobby auf diese Weise auch im Reichsarbeitsdienst weitestgehend zufriedenstellend ausüben.
Mit einem Kameraden beim RAD im Gau Moselland in Irrel
Weiterhin gab es täglichen Unterricht. Dazu gehörten selbstverständlich Mathematik, Deutsch, Erdkunde, Völkerkunde und Musik, aber auch Elemente der nationalsozialistischen Weltanschauung wie Rassenkunde. Wir bekamen aber auch eine Sanitätsausbildung und wurden in theoretischer Waffenkunde und Geländekunde geschult. Dann erfolgte eine Art militärischer Grundausbildung, bei der uns militärische Verhaltensweisen und exaktes Marschieren beigebracht wurden. Nachdem wir einige Lieder eingeübt hatten, marschierten wir auch mit Gesang. Hinzu kam das Exerzieren mit dem Spaten, das sich nicht viel vom späteren Exerzieren mit dem Karabiner 98, dem Standardgewehr der Wehrmacht, unterschied. Dazu mussten wir morgens auf dem Exerzierplatz antreten, den Blick nach Osten gerichtet. Wenn sich die aufgehende Sonne beim Präsentieren in 240 blank geputzten Spaten spiegelte, bot sich ein grandioses Schauspiel. Welche Absicht man mit diesem Drill verband, war auch insoweit unübersehbar, als wir mit dem Spaten tagtäglich an dem in dieser Region zu errichtenden Westwall mit seinem verzweigten Graben- und Bunkersystem zu arbeiten hatten. Schaufeln, graben, pickeln, Erdbewegungen durchführen, betonieren und so weiter. Wir mussten hier eine äußerst anstrengende Arbeit verrichten. Dabei mutete man uns diese körperlichen Strapazen bei permanent durchschnittlicher und, wie bereits erwähnt, nicht immer ausreichender Verpflegung zu.
Sport und Formalausbildung sah ich immer als willkommene Abwechslung an, und auch die extrem harte Ausbildung drückte nicht auf die Stimmung. Ganz im Gegenteil war die Stimmung unter uns gleichaltrigen Jugendlichen den Umständen entsprechend wirklich gut.
Man lernte schnell, kleine Freiheiten zu genießen und sich zu drücken oder gar auszuklinken, wenn sich eine günstige Gelegenheit bot. Wir machten auch die Erfahrung, dass der Zusammenhalt mit der Schwierigkeit der Anforderungen wuchs. Wir lernten rasch, in brenzligen Situationen füreinander einzustehen. Dabei war es unerheblich, aus welcher sozialen Schicht die Kameraden stammten und welchen Berufen sie nachgingen. Ob Bäcker, Metzger, Friseur, Maler oder Schmied, ob Schuster, Schornsteinfeger, Maurer oder Zimmermann, ob Dachdecker, Schreiner, Landwirt, Hilfsarbeiter oder Abiturient – man respektierte einander ohne jegliche Vorurteile. Das war der Garant für unsere Kameradschaft. Das Miteinander schweißte uns zu einer eingeschworenen Mannschaft zusammen, besonders dann, wenn der Ausbildungsdruck und die von uns erwarteten Leistungen hoch waren. Dieser Geist der Kameradschaft sollte sich später auch in den schlimmsten Situationen an der Front immer wieder bewähren.
In der Regel konnte sich jeder auf jeden blind verlassen, bis auf einige ganz wenige Sonderlinge, wie sie mir auch während des Krieges zwar nicht oft, aber immer mal wieder in manchen Lebenslagen begegneten. Komische Käuze, die einfach anders waren als die anderen. Darunter gab es Burschen, die extrem auffielen, die unsauber und wasserscheu waren, beim Stuben- und Revierreinigen durch Drückebergerei glänzten oder die Toiletten in einem fürchterlichen Zustand verließen, beim Spind-Aufräumen oder bei der Anzugskontrolle patzten oder die Kameradschaft in egoistischer Weise unterliefen.
Leidtragende waren dann natürlich in manchen Fällen wir alle. Früheres Wecken um 4 Uhr oder 3 Uhr, längerer Dienst am Abend, Ausgangsverbot am Wochenende und der Verlust sonstiger Vergünstigungen waren die Folge kollektiver Bestrafung. Dementsprechend war es durchaus möglich, dass nach irgendwelchen unliebsamen Gegebenheiten des Nachts bei der betreffenden Person der sogenannte »Heilige Geist« erschien und mit mehr oder weniger drastischen Strafmaßnahmen dazu beitrug, dass die Disziplin besser gewahrt wurde. Das war nicht unbedingt mit großen Schmerzen verbunden, obwohl etwa das Abschrubben der schwarzen Stiefelcreme im Genitalbereich schon eine nicht unerhebliche Rötung verursachte. Aber wie gesagt, diese Kameraden bildeten eine seltene Ausnahme.
Je mehr man uns in den ersten Wochen einer strengen, oft demütigenden Ausbildung unterzog, desto lebensbejahender erhoben wir uns anschließend, gestärkt an Körper, Geist und vor allem Selbstbewusstsein. Unserer Leistungs- oder auch Leidensfähigkeit in dieser eingeschworenen Kameradschaft wohl bewusst, konnten uns auch unangenehme Situationen nicht erschüttern, wie wir sie mit manch einem gehässigen Ausbilder immer wieder erlebten.
Sogenannte »Schweinepriester« gab es immer wieder, aber sie waren nicht die Regel. Im Allgemeinen erfuhren wir im Lager eine disziplinierte, strenge, aber auch menschenwürdige und anständige Behandlung. Ich traf nette Menschen sowohl unter den Ausbildern als auch unter den Kameraden. In Paul Seidenfuß, einem Metzgergesellen aus Koblenz, der am selben Tag mit mir eingezogen worden war, fand ich einen verlässlichen Freund. Wir hatten viel Spaß zusammen und gingen gemeinsam durch dick und dünn.
Nach zwölf Wochen lockerte sich der Dienst insoweit, als wir, wenn nicht kurzfristig wegen irgendwelcher neuen Parolen und Aktionen Ausgangssperre angeordnet wurde, Sonn- und Feiertagsfreigang erhielten. So erkundeten wir Irrel, die nähere Umgebung mit den Irreler Wasserfällen an der Prüm und spazierten schon mal die wenigen Kilometer Richtung Luxemburg. An der ehemaligen Reichsgrenze erreichten wir über die Staatsstraße die alte Grenzbrücke aus Stein, die uns über den Fluss Sauer bis hinein in das beschauliche Städtchen Echternach in Luxemburg führte.
Paul Seidenfuß und ich in der Gneisenau-Kaserne Koblenz im April 1942.
An Tagen ohne Ausgang nutzte ich immer die Gelegenheit, zusätzlich Sport zu treiben. Auch machte es mir Spaß, einigen Kameraden mit einem neuen, frisch erlernten und für diese Zeit äußerst modernen Fassonschnitt die Haare zu stylen. In der Praxis hieß das damals: an der Seite ganz kurz, oben lang und zurückgekämmt. Das galt damals als besonders chic, und jeder wollte natürlich dem Schönheitsideal entsprechen – besonders wenn im Ort eine Tanzveranstaltung stattfand, die wir in Uniform besuchten, wobei wir es genossen, dass uns so manches BDM-Mädel verstohlene Blicke zuwarf und auf ein Auffordern zum Tanz wartete. Niemand von uns wäre damals auf die Idee gekommen, mit Glatze oder einem Millimeter-Haarschnitt herumzulaufen, wie ihn die russischen oder amerikanischen Soldaten trugen. Das sah in unseren Augen unvorteilhaft und hässlich aus. Denn so liefen damals in Deutschland nur Strafgefangene oder alte Männer umher. Doch diese minimalistische Haartracht ereilte viele von uns in späteren Jahren, soweit sie das Glück hatten, den Krieg zu überleben, und das Pech in alliierte Kriegsgefangenschaft zu geraten. Doch an diese Möglichkeit dachte damals, in der ersten Jahreshälfte 1941, niemand von uns. Keiner ahnte, was uns noch bevorstand.
Unser Kamerad Franz Färber nutzte seine freie Zeit in anderer Art und Weise. Er war ein wirklich begnadeter Hobbymaler und wusste Gesichter ausgesprochen naturgetreu wiederzugeben. So zeichnete er einige von uns in Form einfacher Bleistiftskizzen. Das lange Stillhalten musste ich ertragen, und mein Porträt entstand in zwei Sitzungen mit ausgiebiger Zigarettenpause.
Am 22. Juni 1941 begann unter dem Decknamen Unternehmen »Barbarossa«, benannt nach dem deutschen Kaiser Friedrich I. Barbarossa, der Angriff der deutschen Wehrmacht auf Russland. Die Operation erfolgte von Ostpreußen im Norden bis in die Karpaten im Süden mit drei Heeresgruppen, zwei Luftflotten und 2,5 Millionen Soldaten.
Wir erfuhren es durch unsere Ausbilder im Unterrichtsraum und reagierten mit betroffenem Schweigen. Es gab keine Freudenbekundungen und keine »Hurra«-Rufe, hatten wir doch nicht damit gerechnet, dass die militärische Führung den bereits bestehenden zahlreichen Kriegsschauplätzen einen weiteren hinzufügen würde. Was würde das für uns bedeuten? Warum musste das sein? Welchem Zweck sollte dieses waghalsige, gar wahnwitzige Abenteuer dienen? Wir konnten uns keinen Reim darauf machen, nicht mit 17 Jahren hier im RAD Lager unweit der luxemburgischen Grenze. Diese äußerst bedenkliche Neuigkeit konnten wir nur stillschweigend zur Kenntnis nehmen. Aber wir spürten, dass dieser Gegner in einer anderen Liga spielte als wir es bisher kannten, dass etwas sehr Bedrohliches auf uns zukam. Wir verfolgten in den nächsten Tagen und Wochen wie gebannt die von Euphorie und Siegeszuversicht getragenen Meldungen im Rundfunk und in der Presse. Die Siegesmeldungen überschlugen sich.
Als der deutsche Angriff im Herbstschlamm erstmals ins Stocken geriet und durch den besonders frühen und starken Wintereinbruch einige Wochen später kurz vor Moskau schließlich ganz zum Erliegen kam, erhielten wir nach acht Monaten Dienstzeit im RAD kurz vor Weihnachten zehn Tage Urlaub. Auf diesen Tag hatten wir alle seit Langem sehnsüchtig gewartet, und ich kann es gar nicht beschreiben, welche Glücksgefühle in uns aufstiegen, als wir in Irrel den Zug bestiegen, um zum ersten Mal nach so langer Zeit nach Hause zu fahren. Die wenigen Briefe, die ich von Mutter erhielt, konnten mir mein Heimweh nicht nehmen und die Heimat nicht ersetzen. Jetzt war es endlich so weit, endlich!
Paul und ich wollten natürlich zusammen im gleichen Zug fahren und wählten die Verbindung über Trier-Ehrang, anschließend über Wittlich und dann entlang der lieblichen Mosel, vorbei an Cochem bis Koblenz. Der Winter hatte die Landschaft komplett mit Schnee bedeckt, und wir genossen die vorbeiziehende romantische Winterlandschaft des Moseltales in einem beheizten 2. Klasse-Waggon.
Es war bereits die dritte Kriegsweihnacht, und entsprechend mager fielen auch die Geschenke aus. Apfelsinen und andere Südfrüchte gab es schon lange nicht mehr, und Kaffee, Mehl, Zucker und auch Schuhe sowie vieles mehr bezog man bereits rationiert über Lebensmittelmarken. Es ging ruhig zu in unserem tief verschneiten Dorf. Das Leben im Ort schien still zu stehen. Arbeiten im Freien konnten wegen der extrem kalten Witterung und des starken Schneefalls nicht verrichtet werden. Private Autos gab es nicht mehr, und so fuhren auch keine über die Reichsstraße. Kleinere Kinder freuten sich auf das Schlittenfahren. Wir aber waren mit dem 17. Lebensjahr schlagartig keine Kinder mehr.
Wir hatten viel Zeit zum Nachdenken, und meine Gedanken schweiften oft in meine Kinder- und Jugendzeit ab.
Fünf Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde ich als dritter Sohn der Bäuerin Antoinette Sauer (geborene Quirbach, 1883) und des Landwirts und Kartoffelhändlers Josef Sauer, am 22. Dezember 1923 in Bassenheim bei Koblenz im Rheinland geboren und in der katholischen Pfarrkirche St. Martin auf den Namen Friedrich Gottfried getauft.
Der Name Gottfried stammte von meinem Patenonkel, einem Bruder meiner Mutter. Seitdem ich zurückdenken kann, wurde der Name Friedrich eigentlich nie ausgesprochen, sondern ich war ausschließlich der Fritz, oder »dat Fritzje«, wie man hier im moselfränkischen Dialekt sagt.
Mein ältester Bruder Hans, richtig mein Halbbruder, war Jahrgang 1908 und lebte mit meiner Mutter zehn Jahre mehr schlecht als recht allein, einquartiert bei Mutters Bruder Onkel Johann, nachdem ein junger Mann aus dem vier Kilometer entfernten Saffig meine Mutter geschwängert und trotz Eheversprechen hatte sitzen lassen, um in die USA zu gehen.
Als mein Vater Josef Sauer (geb. 1880) nach vier Jahren Krieg an der Westfront 1918 mit drei Orden dekoriert, deren Bedeutung mir später leider nicht mehr bewusst war, unversehrt nach Hause kam, heiratete er alsbald meine Mutter und adoptierte den kleinen Hans. Er gab ihm nicht nur seinen Namen, sondern behandelte ihn stets wie seinen eigenen Sohn. Dabei wurde bereits sehr früh festgelegt, dass Hans als Erstgeborener, wie es im Rheinland, aber auch in den meisten Gegenden Deutschlands üblich war, später einmal unseren landwirtschaftlichen Betrieb weiterführen sollte.
Mein zweiter Bruder Peter wurde im November 1920 geboren, und im Mai 1925 brachte Mutter mit immerhin schon 42 Jahren meinen dritten Bruder Karl zur Welt. In unserem Dorf gab es viele Familien, die den gleichen Familiennamen führten wie wir, und sie alle bekamen bis auf wenige Ausnahmen nur männliche Nachkommen, sodass meine Eltern, die gern auch ein kleines Mädchen gehabt hätten, auch mit Blick auf das fortgeschrittene Alter meiner Mutter, beschlossen, keine weiteren Kinder in die Welt zu setzen. Dabei spielten natürlich auch wirtschaftliche Aspekte eine nicht unerhebliche Rolle. Nach dem verlorenen Krieg war es in den Jahren der Weimarer Republik, die geprägt waren von Inflation und Arbeitslosigkeit, vielen Menschen nicht möglich, eine große Familie auch nur ausreichend zu ernähren, geschweige denn, diese mit den Dingen auszustatten, die für eine normale Lebenshaltung erforderlich sind.
Bestanden die Familien nach der zweiten Reichsgründung 1871 im aufstrebenden Kaiserreich noch aus durchschnittlich sechs bis zwölf Kindern, sank dieser Wert nach dem Ersten Weltkrieg etwa auf die Hälfte, wobei der Geburtenrückgang zum Teil durch die geringere Kindersterblichkeit kompensiert wurde. Denn nicht nur die Medizin, sondern auch das Sozialsystem machten nach der Jahrhundertwende zum Teil revolutionäre Fortschritte. Vor allem besserten sich die hygienischen Verhältnisse, und damit sank auch die Zahl der Sterbefälle durch Infektionen drastisch.
Meine Eltern hatten beide je sieben Geschwister, was mir eine Riesenanzahl von Cousins und Cousinen bescherte, mit denen man natürlich schön spielen konnte. Eine besondere Ausnahme war hier wiederum Onkel Peter Paul, ein Bruder meines Vaters. Die Familie wohnte einige Häuser weiter ebenfalls in unserer Straße. Ihr zur gleichen Zeit und in identischer Größe gebautes Haus Nr. 12 beherbergte allerdings ein paar Seelen mehr. Hier gab es noch eine richtige Großfamilie mit elf Kindern, sechs Jungen und fünf Mädchen. So gab es in unserem Dorf neben Weihnachten, Fastnacht, Ostern und Kirmes auch zahlreiche kleinere Familienfeiern, die sich aber hinsichtlich des finanziellen und kulinarischen Aufwands in sehr bescheidenen Grenzen bewegten.
Überhaupt war in unserem Dorf dank der vielen Kinder auf den zumeist noch unbefestigten Straßen, in Gärten, Wiesen, Feldern oder in unserem schönen Wald immer etwas los. Und so zogen und stromerten wir, wenn Vater uns nicht gerade aufs Feld mitnahm, bereits vor unserer Einschulung in die Volksschule durch Dorf und Gemarkung, immer auf der Suche nach Entdeckungen, einer interessanten Abwechslung, nach Abenteuern oder auch nur nach irgendetwas Essbarem. Von Mai bis Oktober wussten wir stets, wo es die ersten Erdbeeren, Himbeeren und Kirschen bis hin zu den letzten Brombeeren, Pflaumen, Birnen, Nüssen und Äpfeln gab.
Unweit von unserem Haus in der Von-Oppenheim-Straße Nr. 1 befand sich die gut ausgebaute asphaltierte Reichsstraße. Diese führte von Koblenz kommend über Metternich, Rübenach, Bassenheim, Ochtendung, Mayen, vorbei am Nürburgring, der 1927 fertig gestellt wurde, weiter über Blankenheim, Schleiden, Monschau bis nach Aachen. Hier konnten wir natürlich ab und an durchfahrende Autos bestaunen, welche in späteren Jahren bei den großen Eifelrennen, insbesondere beim Großen Preis von Deutschland, vermehrt durch unseren Ort fuhren. Aber Automobile waren damals noch eher selten.
Die Reichsbahn war das gängige Transportmittel, und so wurde die Reichsstraße in der Regel mehr von Pferde und Ochsengespannen, einigen Lkws und fahrenden Händlern, Kesselflickern und Korbflechtern, fahrendem Volk und sonstigen Gesellen benutzt. In dieser Zeit bewältigte man noch viele Reisen zu Fuß, und so wanderten unsere motorsportbegeisterten Dorfbewohner per pedes die 41 Kilometer zum Großen Preis auf dem Nürburgring, wo sich damals so namhafte Hersteller wie Autounion, Mercedes Benz, Alfa Romeo, Bugatti und Ferrari harte Kämpfe lieferten.
Ich kann mich auch noch sehr gut an ein Ereignis von ganz anderer Art erinnern. Mit gerade mal sechs Jahren, noch vor meiner Einschulung, entdeckte ich Zigeuner, die von Ochtendung her kommend durch unser Dorf zogen. Das war natürlich spannend. Diese Leute sahen anders aus, waren anders gekleidet, sprachen anders, hatten viele Kinder dabei und ein kleines zotteliges Pferd, wie wir es hier im Dorf in dieser Art noch nie gesehen hatten. Wahrscheinlich war es eine Art Pony, das ein kleines, rauchendes Häuschen auf zwei Rädern hinter sich her zog. Meine Neugierde war spontan geweckt, und Sekunden später saß ich schon in diesem Gefährt. Die Leute waren nett und lustig. Eine ältere Frau rauchte eine lange Pfeife und während des Spielens mit deren Kindern vergaß ich über einen längeren Zeitraum das Aussteigen. Zu Beginn unseres Dorfes eingestiegen, sah ich plötzlich, wie unser weit außerhalb vom Ortsrand auf der gegenüberliegenden, östlichen Seite gelegener Bahnhof an mir vorbeizog. Nun verließ mich schlagartig der Mut. Ich sprang schleunigst von dem gemächlich in Richtung Koblenz fahrenden, faszinierenden Gefährt ab. Noch im Weglaufen sah ich, dass die lustige Gesellschaft um ein paar Hühner und eine Gans gewachsen war. Die zwei Kilometer Fußmarsch zurück ins Dorf bis zu unserem Haus bewältigte ich locker und in kürzester Zeit. Zu Fuß gehen oder laufen war für uns kein Problem.
Mittlerweile hatte sich im Dorf herumgesprochen, dass das kleine »Fritzje« von den Zigeunern mitgenommen und verschleppt worden sei. Man suchte mich überall und machte sich große Sorgen. Dass ich aus Neugier selbst in den Wagen geklettert war, verschwieg ich angesichts der Schelte, die über mich hereinbrach, als ich nach Hause kam. Sogleich suchten die Eltern meine kurz geschorenen Haare nach Läusen ab, wurden aber zum Glück nicht fündig. Ich jedenfalls kam durch dieses Abenteuer bereits in sehr jungen Jahren zu meinem ersten größeren und noch dazu kostenlosen Ausflug.
Aufgrund der Tatsache, dass ich spät im Dezember 1923 geboren worden war, erfolgte meine Einschulung in die Volksschule Bassenheim erst Ostern 1930 zum Jahrgang 1923/24. Eingeschult wurde damals immer an Ostern, nicht wie heute nach den großen Sommerferien. Nach den Osterferien begann an gleicher Stelle das neue Schuljahr, sofern man nicht auf eine höhere Schule wechselte oder eine Berufsausbildung begann. Die Volksschule bestand damals aus acht Klassen, reichte also vom ersten bis zum achten Schuljahr. Wer zu leistungsschwach war und den Lernstoff nicht bewältigte, blieb sitzen und musste die Klasse einfach wiederholen.
Unsere Volksschule lag an der Saffiger Straße, unmittelbar oberhalb unseres schönen Schlossparkes. Natürlich gingen alle Schülerinnen und Schüler zu Fuß zur Schule, auch die von den umliegenden Höfen unserer Gemarkung oder den Häusern rund um unseren recht weit außerhalb des Ortes liegenden Bahnhof. Mein Elternhaus stand aber zum Glück nur 500 Meter von unserer Schule entfernt.
Kurzum, wir wohnten in einem wunderschönen, in Natur und Landschaft eingebetteten Dorf, eigentlich wie im Paradies, wäre da nicht das harte, entbehrungs- und arbeitsreiche Leben in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit gewesen. Allerdings hatte sich die Infrastruktur dank der 1904 neu erbauten Eisenbahnlinie Koblenz–Mayen–Daun–Gerolstein, an die unser Ort mit einem neuen, großen Bahnhof angebunden war, wesentlich verbessert, was auch einen bescheidenen wirtschaftlichen Aufschwung zur Folge hatte.
Allerdings war unsere landwirtschaftlich geprägte Gemeinde im Vergleich zu ihren Nachbargemeinden Ochtendung, Mülheim, Kärlich, Saffig und Kettig deutlich ärmer, obwohl die Gemarkung erheblich größer war. Neben den klassischen Handwerksberufen Bäcker, Metzger, Friseur, Hufschmied, Schreiner, Schuster, Dachdecker, Klempner oder Zimmermann, gab es im Dorf überdurchschnittlich viele Familien, die überwiegend von der Landwirtschaft lebten, und der Grundbesitz der Bauern war durchweg recht bescheiden. Das hatte einen einfachen Grund: Bassenheim stand seit dem frühen Mittelalter unter der Herrschaft der Ritter Walpot von Bassenheim, einem berühmten, einflussreichen und wohlhabenden Rittergeschlecht, das im 18. Jahrhundert in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. Dies hatte eine aufwendige Hofhaltung zur Folge, deren Kosten von den Pächtern der verschiedenen Grundherrschaften, die sich im Besitz des Hauses befanden, getragen werden mussten. Auf diese Weise häuften die adeligen Herrschaften ein im wahrsten Sinn des Wortes fürstliches Vermögen an, während ihren Untertanen kaum das Nötigste zum Leben blieb. Dieser Reichtum ist in Bassenheim auch heute noch sehr gut an dem schönen Schloss zu erkennen, zu dem nicht nur ein großer Park und mehrere Seen, sondern auch 1000 Hektar Wald und 1000 Hektar fruchtbares Ackerland einschließlich dreier Gehöfte mit Försterei gehören.
Der Alltag für die Kinder und Jugendlichen in meinem Alter war durchweg bescheiden und arbeitsreich. Doch nutzten wir ab und an selbst erfundene Abwechslungen, die wir wiederum spannend zu gestalten wussten.
In der Regel gingen wir ganz normal tagein, tagaus in unsere Volksschule. Standen Arbeiten zu Hause oder im Feld an, mussten wir mithelfen. Ob wir dazu Lust hatten oder auch nicht, interessierte niemanden. Meistens hatten wir natürlich keine Lust und wären lieber im Dorf, im Wald, in der Flur oder auf unserem Sportplatz spielen gegangen. Mühselig war besonders die Kartoffelernte. Damals musste man diese Feldfrüchte noch mit den Händen in gebückter Haltung aufheben und die einen Zentner schweren Säcke heben, und das war für uns Kinder schon recht schwer.
Ich höre noch heute meinen Vater sagen, »Fritzje, wenn du fleißig Kartoffel ›raffst‹ (aufhebst), dann bekommst du an Weihnachten eine neue Hose«. Im nächsten Jahr waren es neue Schuhe. Ich hätte sowieso neue Hosen und Schuhe gebraucht, und ich glaube, ich hätte sie von meinen Eltern auch ohne Kartoffeln aufzuraffen bekommen.
Weihnachten war sehr feierlich, die Geschenke hingegen eher bescheiden. Unglücklicherweise hatte ich auch noch am 22. Dezember Geburtstag. So wurden die Geschenke der Einfachheit halber mit den Weihnachtsgaben zusammengelegt, wodurch sich diese leider aber auch nicht vermehrten.
In späteren Jahren wussten wir natürlich, dass nicht das Christkind, sondern die Eltern für die Geschenke sorgten. Trotzdem spielte unser Hans weiter den Knecht Ruprecht und warf draußen vom Hof aus durch das offene Küchenfenster ein paar Hände voll Nüsse, Äpfel und auch Apfelsinen ins Haus. Dazu gab es dann die versprochene Hose oder ein paar neue Schuhe, außerdem von Mutter selbst gestrickte Socken und eine Tafel Schokolade.
Um nochmal auf die Kartoffeln zurückzukommen, möchte ich erwähnen, dass deren Anbau der Haupterwerb unseres Betriebes und somit entscheidend für unseren Lebensunterhalt war. Wie bereits erwähnt, besaßen die Bassenheimer Landwirte, bedingt durch die großen herrschaftlichen Ländereien, wenig eigenen Grund. Von dessen Ertrag mussten oft große Familien mehr schlecht als recht leben. Auch wir hatten acht Morgen eigenes Land. Das waren nur zwei Hektar und eigentlich sehr wenig. Die restlichen Morgen pachteten wir deshalb noch von der katholischen Kirche dazu.
Und weil mein Vater bereits Mitte der Zwanzigerjahre neben dem Kartoffelanbau eine Kuh, Hühner und Schweine hielt und dazu einen Kartoffelgroßhandel aufbaute, konnten wir einigermaßen auskömmlich leben und uns sogar zwei stolze Pferde leisten. Da zu der Zeit noch viele andere Bauern mit nur einem Pferd oder gar mit Ochsen und Kühen ins Feld fuhren, schätzten wir uns glücklich. Die Pferde wurden nicht nur für die übliche Feldarbeit eingesetzt, sondern auch für die Vermarktung und den Transport unserer Kartoffeln an die Kunden. Diese befanden sich überwiegend in Koblenz und Umgebung.
Das lief relativ reibungslos und wie folgt ab: Tagsüber wurden Kartoffeln geerntet und abends auf unserem Leiterwagen im Hof bereitgestellt. Florierte das Geschäft, kauften wir von anderen Bauern Kartoffeln dazu. Nachts zwischen 2 und 3 Uhr stand Vater oder mein Bruder Hans auf, spannte ein Pferd an, und ab ging die Fahrt nach Koblenz, wo man in aller Frühe eintraf. Mitten auf dem Platz »Am Plan« wurde dann an der Pferdetränke Halt gemacht. Das Pferd bekam seinen Hafersack und konnte dort seinen Durst stillen. Anschließend wurden die Kartoffeln bei den Kunden ausgeliefert, die überwiegend in der Altstadt wohnten. Verkauft wurde sowohl an die Gastronomie als auch an Privatleute.
Unser Leiterwagen ließ sich in der Länge variieren. »Kurz gestellt«, konnte man bis zu 25 Zentner transportieren. Wir erlösten für die angelieferten Kartoffeln pro Zentner zwei Reichsmark mehr als die normale Vermarktung einbrachte. Das war für uns ein enormer Verdienst von zusätzlich fünfzig Reichsmark. Nachdem sich Qualität und Zuverlässigkeit herumgesprochen hatten, wurden die Aufträge umfangreicher, und wir konnten größere Mengen liefern. Dazu wurde unser Leiterwagen »lang gestellt«, also wie bei einem Ausziehtisch auseinander gezogen. Das bedeutete, dass wir auf dem Wagen nunmehr vierzig Zentner transportieren konnten, und die zusätzlichen Einnahmen erhöhten sich somit pro Fuhre auf achtzig Reichsmark.
Für die größere und schwerere Ladung mussten jedoch beide Pferde vorgespannt werden, da ein Pferd allein den schweren Wagen nicht über den Anstieg der Koblenzer Straße bis auf die Höhe unseres Bahnhofes ziehen konnte. Von dort aus ging es zwölf Kilometer eben oder sogar leicht abschüssig bis ins Stadtzentrum. Da am nächsten Tag jedoch wieder ein Pferd für die Feldarbeit gebraucht wurde und Vater den Schlaf für die schwere Arbeit benötigte, wurde ich nachts von Hans geweckt. Ich musste ja morgens nur in die Schule!
Also stand ich mit acht Jahren um 2 Uhr in der Früh mit auf, spannte gemeinsam mit meinem Bruder die Pferde an, und ab ging die Fahrt. Nach zwei Kilometern auf der Höhe angekommen, wurde ein Pferd ausgespannt, und ich ritt auf diesem Pferd wieder zurück nach Hause. Es war für mich total spannend, so jung bei tiefster Dunkelheit allein durch die Nacht zu reiten. Außer dem Klappern der Pferdehufe hörte man in dieser einsamen Stille keine weiteren Geräusche. Allein die leuchtenden Sterne und der Mond waren in diesen Nächten unsere Begleiter. Dennoch hatte ich keine Angst. Es überkam mich eher ein erhabenes und stolzes Gefühl, weil man mir ein so kostbares Tier anvertraute. Erst in späteren Jahren wurde mir bewusst, wie konsequent uns unsere Eltern im Geist von Verantwortung und Leistungsbereitschaft erzogen hatten.
Zu Hause angekommen versorgte ich zuerst das Tier und legte mich schnell bis zum Wecken ins Bett. Natürlich musste ich nicht jede Nacht antreten. Mal war mein zwei Jahre älterer Bruder Peter an der Reihe, mal gab es keine Aufträge. Aber wenn ich Schulferien hatte, durfte ich fast immer mit den Kartoffeltransporten in die Stadt fahren. Das war für mich natürlich Spannung pur. Ich kam aus unserem Dorf hinaus in die für mich damals große weite Welt.
Schon in Rübenach und mehr noch in Metternich wurden die Häuser größer und prächtiger. Auf den schönsten und größten Villen in Metternich waren Jahreszahlen von 1908 bis 1913 zu lesen. In dieser letzten Phase vor dem Ersten Weltkrieg hatte die Wirtschaft geblüht, und viele Bürger waren reich geworden. Weiter fuhren wir dann durch den Koblenzer Stadtteil Lützel mit seinen prächtigen Jugendstilhäusern, dann über die aus dem 14. Jahrhundert stammende Balduinbrücke über die Mosel in die Altstadt. Stadteinwärts erblickte man links die alte Burg und gegenüber auf der rechten Seite den Bassenheimer Hof mit der anschließenden Dominikanerkirche.
»Lützel« heißt übrigens im Rheinischen Dialekt wie im Norddeutschen Lütje »klein«, womit die Proportionen zur großen gegenüberliegenden Stadt geklärt waren. Anschließend bogen wir in den alten Graben ein und fuhren bis zum bereits erwähnten Platz, den sogenannten »Plan«, mitten im Herzen der Altstadt. Hier begann die Auslieferung unserer Ware, und ich konnte feststellen, wie schwer die Arbeit für Hans war, der die zentnerschweren Kartoffelsäcke in so viele Keller, aber auch in den vierten oder fünften Stock der großen Häuser zu tragen hatte.
Zwischendurch stärkten wir uns beim nächsten Metzger mit einem Stück Fleischwurst und einigen Scheiben von zu Hause mitgebrachtem Schwarzbrot.
Obwohl meine Aufgabe darin bestand, die Pferde zu versorgen und zusätzliche Handgriffe beim Abladen zu tätigen, schmeckte es mir doppelt und dreifach gut. Mutter aß sehr gerne Trauben und Südfrüchte, die es bei uns im Dorf nur selten gab, und so kauften wir ihr, wenn sich die Gelegenheit bot, Trauben und ein paar Apfelsinen.
Doch kam es häufig vor, dass mein großer Bruder Hans gegen Ende unserer Lieferfahrt bereits am frühen Mittag äußerst vergnügt war. Er fing an zu singen und wurde immer komischer und lustiger. Es war leicht zu erraten, wo seine gute Stimmung herrührte, denn man konnte es schon von Weitem riechen. An den meisten Abladestellen bekam Hans Trinkgeld, das in der armen Zeit oft nicht aus barer Münze bestand, sondern eher aus Naturalien. Diese Naturalien beschränkten sich natürlich wiederum fast immer auf Alkohol in Form von Bier, Schnaps, Tresterschnaps, Cognac und ähnlichem Gebräu, das man ihm als Dank einschenkte, wenn Hans nass geschwitzt und durstig die schwere Last die zahlreichen Treppen hinauf zu den Speichern oder hinab in die tiefen Keller getragen hatte. Höflich und charmant, wie Hans allen Kunden gegenüber war, konnte er den zahlreichen Huldigungen natürlich nicht widerstehen. So gab es ab und an Tage, an denen sich Hans über einen kurzen Zeitraum hinweg schon mal einen beachtlichen Alkoholrausch einhandelte.
Die Heimfahrt gestaltete sich dann sehr beschaulich. Weil die Pferde den Weg nach Hause kannten, legten sie die Strecke wie gewohnt allein zurück. Wenn in Metternich von hinten eine Straßenbahn, »die Elektrische«, wie sie im Volksmund allgemein genannt wurde, kam und bimmelte, trabten die Pferde automatisch und selbstverständlich von den Schienen. Dergleichen blieb von uns oft unbemerkt, denn ich pflegte auf der Fahrt zeitweise zu schlafen und der gute Hans schlief seinen Rausch aus. War die »Elektrisch« vorbei, gingen die Pferde wieder automatisch in die Fahrspur, und die Fahrt führte problemlos wie gehabt Richtung Heimat weiter. Auf der Höhe des Bassenheimer Bahnhofs angekommen, war die Welt wieder in Ordnung. Alle Lasten und Mühen waren vergessen, und wir hatten einen erlebnisreichen Tag gemeinsam gut gemeistert.
An einem anderen Tag konnte es passieren, dass Mutter uns den Auftrag gab, mit dem Leiterwagen in den Wald zu fahren, um Reisig und Holz zu sammeln. Das diente als Anzündholz zum täglichen Kochen oder Heizen der Küche. Der Ofen in unserem kleinen Wohnzimmer wurde im Winter normalerweise nur an Weihnachten oder zu besonderen Feierlichkeiten geheizt. Ein andermal lautete der Auftrag, zu irgendeiner Feldparzelle zu fahren, wo gerade ein Apfel- oder Birnbaum reife Früchte trug. Es war zum Haare raufen, denn wir Kinder wollten doch spielen und eigentlich ganz andere Sachen anstellen.
Aber ganz so schlimm war es für uns Kinder nicht mit der Arbeit. Wir hatten noch genügend Freizeit, da uns ja die Schule mit Hausaufgaben nicht allzu sehr beanspruchte. In der warmen Jahreszeit ging es zum Sportplatz, in der Winterzeit fuhren wir Schlitten oder trugen Schneeballschlachten aus.
Besonders in den Wintern der dreißiger und vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts, die äußerst schneereich, lausig kalt und überdies sehr lang waren, fuhren wir tagelang von der Ochtendunger oder Saffiger Höhe mit unseren Schlitten. Es verkehrten auf den Straßen ja so gut wie keine Autos, und gestreut wurde auch nicht. So waren die Rodelbahnen enorm glatt und sehr lang. Alle Kinder des Dorfes, Jungen und Mädchen, waren auf den Beinen, und durch die großen kinderreichen Familien war mächtig was los auf den Rodelbahnen.
Meist wurden mehrere Schlitten zusammengebunden. Vorne saß dann immer ein Steuermann mit angeschnallten Schlittschuhen. Die Fahrten waren trotzdem abenteuerlich. Lifte gab es natürlich nicht. Zum Startpunkt schleppte man die schweren Holzschlitten per Hand, und an manchen Tagen wurden so weit mehr als zwanzig Kilometer im Schnee zurückgelegt.
Schneebälle zu werfen bereitete mir besonders viel Freude, und so trug sich in meinem Übermut ab und an folgende Begebenheit zu: Gegenüber von unserem Haus, an der Ecke der Von-Oppenheim-Straße, Einmündung Karmelenberger Weg, stand das Haus der »Nachtheims«. Hier wohnten zwei kinderlose Jungfern zusammen mit ihrem Bruder, die immer ein wenig komisch und sonderbar waren und uns Kinder im Allgemeinen nicht mochten. Darin lag natürlich ein besonderer Reiz, diese Damen ab und an zu ärgern, insbesondere weil sie so zickig und pedantisch waren. Ich konnte ziemlich zielsicher und kräftig werfen, und um die gewünschte Wirkung zu erzielen, machte ich mir ein paar wasserharte Schneebälle mit jeweils einem dicken Stein als Kern im Inneren. Wenn ich mich auf unsere Außentreppe stellte, konnte ich über unser hohes Holztor hinweg mit »Schmackes« ein paar dieser knüppelharten, vorpräparierten »Vollmantelgeschosse« auf die knapp zehn Meter entfernten geschlossenen Holzfensterläden abfeuern.
Das krachte fürchterlich, und meine Trefferquote lag bei hundert Prozent. Ich konnte mich gerade noch hinter unser großes Holztor ducken, da flogen schon die Fensterläden auf, und die Frauen kreischten und schrien mit schriller Stimme unsere Straße hinunter: »Unten läuft der Kerl, unten läuft der Kerl, Polizei, haltet ihn!«
Ich konnte mich kaum halten vor Lachen, sodass ich diese Prozedur zu meinem größten Vergnügen in den folgenden Tagen ein paarmal wiederholte. Gut, dass Vater nichts davon mitbekam. Das hätte wirklich zu einer schweren Tracht Prügel führen können. Zum Glück kam nie heraus, dass ich es war.
Wenigstens konnte ich mich an diesen Erinnerungen aufheitern, denn seit Ausbruch des Krieges war die Stimmung im Dorf äußerst getrübt. Zahlreiche Männer waren an der Front, und es hatte auch bereits einige Gefallene gegeben. So war die Christmette in unserer Pfarrkirche St. Martin an Heiligabend zum Bersten gefüllt. Es war sehr feierlich, aber auch traurig, denn unser Land befand sich mitten in einem Krieg mit ungewissem Ausgang. Niemand von uns und der Dorfbevölkerung hatte ihn gewollt, und viele fragten sich, wie unser Volk, unser Land nur in diesen unabsehbaren Konflikt hineingeraten sein mochte. Wenige Menschen nur erkannten die Ursache in der verbrecherischen Politik Hitlers, und diese hielten den Mund, hätten sie doch Freiheit und Leben riskiert. Beim Lied »Stille Nacht, Heilige Nacht« flossen zahlreiche Tränen. Der Friede auf Erden war dahin, und der Sinn dieses Gemetzels offenbarte sich wohl nur den fanatischen Anhängern der NSDAP. Und davon gab es in unserem fast 1700 Seelen großen Dorf nicht viele. Hätte ich in jener Heiligen Nacht in unserer überfüllten Kirche nach Leuten suchen sollen, die Kriegsgelüste oder irgendeinen Hass gegenüber Engländern, Franzosen, Russen oder anderen Völkern hegten – ich hätte wohl niemanden gefunden. Dass dieses Weihnachten 1941 für die nächsten Jahre mein letztes Weihnachtsfest zu Hause bis Kriegsende werden sollte, konnte ich damals noch nicht ahnen.
Die gemütlichen Tage zu Hause vergingen wie im Flug, und direkt zu Jahresbeginn 1942 saß ich schon wieder im Zug Richtung luxemburgische Grenze zum RAD-Lager nach Irrel. Auch hier machten sich die Folgen des Krieges allmählich bemerkbar, und es kam zu diversen Einsparungen und Versorgungsengpässen. Die Verpflegung hatte sich nicht gebessert. Sie war im Allgemeinen nicht schlecht, hätte für uns junge Burschen aber immer ein wenig üppiger sein können.
Aufgrund der Witterung wurden die Bautätigkeiten eingestellt. Neben dem üblichen Unterricht trieben wir Sport in der kleinen Halle, schaufelten Kubikmeter Schnee, exerzierten auf dem Appellplatz, lernten weitere Lieder und nebenbei in Flick- und Nähstunden Knöpfe annähen. Nach dem Frühsport liefen wir nach wie vor mit blankem Oberkörper durchs freie Gelände bis zu den Waschräumen und das bei zwanzig Grad Kälte. Es machte uns nichts aus, waren doch unsere Körper durch das Laufen im ersten Moment noch stark erhitzt. Irgendwie hatte diese Prozedur für uns sogar einen gewissen Reiz, denn sie härtete ab und hielt uns fit. Jedenfalls kamen Erkältungen oder Grippe nicht vor. Bei der klaren Luft und dem strengen Frost war es vermutlich selbst den Viren zu kalt.
Verschiedentlich wurden wir im Ort und in der Umgebung eingesetzt, wenn es darum ging, in Großfamilien, Bauernhöfen und Handwerksbetrieben mitzuhelfen, um Großprojekte tatkräftig zu unterstützen, die mit Eigenmitteln nicht bewältigt werden konnten. Das machten wir mit wachsender Begeisterung zur Abwechslung gerne; denn es gab dadurch doch meistens neben der allgemeinen Anerkennung zusätzlich etwas zu essen und zu trinken.
Ende Februar, als die Tage wieder länger wurden, begannen wir mit dem Bau neuer Unterkünfte, und es folgte zusätzlich der übliche Dienstbetrieb.
Anfang März, einige Wochen vor Beendigung der RAD-Zeit, erschienen eines Morgens zwei stattliche große blonde Männer der Waffen-SS in schneidiger schwarzer Uniform. Da uns allen in naher Zukunft die Musterung für den allgemeinen Wehrdienst, in der Regel bei der Wehrmacht, bevorstand, warben sie im Unterrichtsraum mit verlockenden Angeboten für den Eintritt in ihre Organisation. Der SS gehöre die Zukunft, und wer in ihr diene, gehöre zur Elite des Großdeutschen Reiches und der arischen Rasse. Am Ende der Vorträge fragten sie, wer sich denn nun freiwillig zum Eintritt in die SS melden wolle. Niemand von uns stand auf, niemand hob die Hand und meldete sich. Nach dem allgemeinen Gemurmel und Getuschel herrschte plötzlich eine unangenehme, gespannte Stille.
Der Wortführer schaute in die Runde und zeigte auf drei von uns, die groß gewachsen, blond und sportlich waren und sagte: »Sie melden sich nach dem Unterricht in der Lagerkommandantur zum Eintritt in die Waffen-SS. Wir sehen uns später wieder, dann bis nachher!«
Mir fuhr ein Stich ins Herz. Ausgerechnet ich war gemeint und sollte mich mit den beiden anderen Auserwählten melden. Mir war nicht wohl bei dieser Ehre. Es war nicht das Gefühl von Furcht vor etwas Neuem, sondern eher eine intuitive Ablehnung und das ungute Gefühl, sich einer parteinahen Organisation anzuschließen, was zusätzlich bedeutet hätte, dass ich noch weiter von zu Hause weggekommen wäre.
So entschloss ich mich, die Aufforderung zu ignorieren und nicht zu den Herren in Schwarz zu gehen. Ich hoffte, dass sich die beiden Männer mit der Ausbeute von nur zwei »Freiwilligenmeldungen« zufriedengeben würden. Tatsächlich fuhren sie ab. Ich wurde unmittelbar danach zum Lagerkommandanten befohlen. Befehlsgemäß legte ich den Weg zur Kommandantur im Laufschritt zurück, und noch ganz außer Atem meldete ich mich zackig in der Baracke der Lagerleitung.
»Arbeitsdienstmann Sauer, warum sind Sie der Aufforderung der beiden Herren von der Waffen-SS nicht nachgekommen?«, fragte der Lagerkommandant mit ruhiger Stimme und in höflichem Ton.
»Weil es mein größter Wunsch ist, mich nach Beendigung meiner RAD-Zeit zur Luftwaffe zu melden, um Jagdflieger zu werden. Ich möchte eine Messerschmitt Bf 109 fliegen«, erwiderte ich unverzüglich.
Ich war über mich selbst überrascht, wie flüssig mir diese Ausrede über die Lippen kam. Schließlich wusste ich doch genau, dass die Waffen-SS keine eigene Luftwaffe hatte. Meine ernsthaft und sicher vorgetragene Argumentation zeigte Wirkung. Es gab abschließend noch ein paar allgemeine Fragen, und die Sache schien vorerst aus der Welt. Dem war allerdings nicht so, aber das erfuhr ich erst einige Monate später. Die anderen beiden Kameraden hatten sich verpflichtet. Ob sie den Krieg überlebten, habe ich nie erfahren.
Wenige Tage später ging im Lager das Gerücht um, wir würden vorzeitig aus dem RAD entlassen. Ausnahmsweise stellte es sich als wahr heraus, denn Gerüchte und Parolen gab es viele, und in der Regel steckte dahinter reines Wunschdenken.
Das gesamte Lager war in Hochstimmung, denn Ende März wurden wir zu unserer großen Freude tatsächlich drei Monate früher als vorgesehen nach Hause entlassen. Das geschah natürlich nicht ohne Grund oder aus christlicher Nächstenliebe. Nein, nach dem verheerenden Kriegswinter an der Ostfront und den katastrophalen Verlusten der Wehrmacht liefen die Musterungsstellen auf Hochtouren.
Die Front brauchte Nachschub an Menschen und Material. Die Ausfälle der Deutschen Wehrmacht allein an der Ostfront betrugen nach nur wenigen Monaten Einsatz rund eine Million an Gefallenen, Verwundeten und Vermissten. Viele Ausfälle waren dem unvorstellbar harten russischen Winter geschuldet, auf den die deutsche Führung die Soldaten nicht oder völlig ungenügend vorbereitet hatte. Denn im »Führerhauptquartier« war man davon ausgegangen, die Rote Armee in einem Feldzug von nur wenigen Wochen zur Kapitulation zwingen zu können.
Beim letzten Appell hielt der Lagerkommandant eine knappe Rede, in der auch von der Liebe zum Deutschen Volk und dem Dienst am Vaterland die Rede war. Im Anschluss daran packten wir unsere wenigen Habseligkeiten und verabschiedeten uns von den vielen netten Kameraden, mit denen wir die RAD-Zeit wohlbehalten überstanden hatten. Wie bereits vor Weihnachten fuhren wir die gleiche Strecke zurück nach Hause in eine noch ungewissere Zukunft. Unsere Wege trennten sich, und die meisten Freunde und Kameraden sahen wir nie wieder.
Die Zeit im RAD-Lager hat uns nicht umgebracht und auch nicht geschadet. Wir lernten so nützliche Dinge wie Putzen, Waschen, Flicken und Nähen, wurden erzogen zu Disziplin und Pünktlichkeit, Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt, lernten Respekt, Achtung, Rücksichtnahme und Selbstbewusstsein. Da wir in der Regel aus Familien mit einem festgefügten christlichen Weltbild stammten, konnte uns die damals unvermeidliche ideologische Indoktrinierung wenig anhaben. Zum Reichsarbeitsdienst wurden Jungen wie Mädchen gleichermaßen zwischen dem 17. und 18. Lebensjahr herangezogen.
Wir waren vorgestern Kinder und gestern Jugendliche gewesen. Nun galten wir schlagartig als gestandene, erwachsene Männer, denen die Härten des Krieges uneingeschränkt zugemutet wurden.