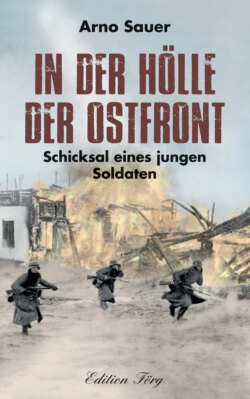Читать книгу In der Hölle der Ostfront - Arno Sauer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеStellungsbefehl zur Wehrmacht
Nur wenige Tage nach meiner Entlassung vom Arbeitsdienst und wieder gut zu Hause angekommen, erhielt ich einen Brief, in dem ich zur Musterung befohlen wurde.
Ich erhielt diesen Brief in einer Zeit, in der unsere Armeen im Osten in erbitterte Kämpfe verwickelt waren. Die deutsche Führung hatte aus dem Schicksal Napoleons und aus den Erfahrungen des Zweifrontenkrieges von 1914–1918 nichts gelernt. Russland anzugreifen, noch dazu mit einer unzulänglich ausgerüsteten Armee, war ein verantwortungsloses, verbrecherisches Abenteuer, ein russisches Roulette, aber mit fünf Patronen anstelle von einer in der sechsschüssigen Revolvertrommel.
Im Januar 1942 standen auf einer Front von 600 Kilometern den 37 deutschen Divisionen der Heeresgruppe Süd 95 russische Divisionen gegenüber. Bis zum März des Jahres 1942 betrugen die Verluste des gesamten deutschen Ostheeres bereits 1 107 000 Mann. Die Heeresgruppe Mitte konnte in einem 1000 Kilometer breiten Verteidigungsabschnitt den gegenüberstehenden 190 sowjetischen Divisionen nur 67 abgekämpfte deutsche Divisionen entgegenstellen.
Im Bereich der Heeresgruppe Nord kämpften 31 geschwächte deutsche Divisionen auf einer Frontbreite von 600 Kilometern gegen 86 russische. An allen Fronten waren die Russen der Wehrmacht also um das Dreifache überlegen. Aber davon wussten wir nichts. Wir hatten uns an die Erfolgsmeldungen aus dem Rundfunk gewöhnt, die sich im Sommer 1941 förmlich überschlagen hatten, und wunderten uns allenfalls darüber, dass sie nur noch spärlich ausgestrahlt wurden. So fuhr ich termingerecht und guten Mutes zum angegebenen Datum der Musterung nach Koblenz.
Die enorme Anzahl von jungen Rekruten an diesem frühen Morgen war überwältigend. Auf den Gängen drängten sich die Massen, und ich sah in neugierige, erwartungsvolle und euphorische, mitunter aber auch ängstliche und skeptische Gesichter. Auf den Fluren vollzog sich ein hektisches und reges Treiben, gesteuert mit Befehlen in einer lauten, deutlichen und unmissverständlichen militärischen Kommandosprache.
Die ärztlichen Untersuchung erfolgte folgendermaßen: In einer langen Reihe wurden die persönlichen Daten aufgenommen. In einem gegenüberliegenden Raum musste man sich komplett ausziehen. Sobald der eigene Name verlesen wurde, hatte man laut und deutlich »Jawohl« zu rufen, um anschließend in ein großes Untersuchungszimmer zu treten. Das ging ruckzuck, da die Probanden nicht einzeln, wie damals in Irrel, sondern jeweils zu acht von drei Ärzten ebenso gründlich wie schnell untersucht wurden. Das medizinische Personal bestand aus einem Oberstabsarzt im Range eines Majors, einem Assistenzarzt im Rang eines Oberleutnants und einem Unterarzt in Leutnantsuniform als Schreiber. Im Zuge der Untersuchung wurden unter anderem Größe (1,82 Meter) und Gewicht (78 Kilogramm) ermittelt und zwecks Bestimmung der Blutgruppe (ich hatte die Blutgruppe 0) eine Blutprobe genommen. Diese war auch in die Erkennungsmarke aus Aluminium eingeprägt, die jeder Soldat Tag und Nacht um den Hals trug. So konnte man bei einer Verwundung sofort die Blutgruppe erkennen. War ein Soldat gefallen, wurde die eine Hälfte abgebrochen und mitgenommen.Anschließend mit acht Mann in einer Reihe stehend kam das berühmte sogenannte »Husten Sie mal«. Für mich war die Prozedur nicht neu, doch waren auch viele Neulinge dabei: Abiturienten, die ein vorgezogenes Notabitur abgelegt hatten, oder Angehörige des späten Jahrganges 1924, die teilweise vor dem Militärdienst nicht mehr zum Arbeitsdienst mussten. Die Gründe lagen auf der Hand. Alle Frontverbände meldeten immer größere Verluste und hatten einen unstillbaren Bedarf an »Kanonenfutter«.
Bei dieser Untersuchung griff der Assistenzarzt mit der ganzen Hand jedem von vorne unsanft an die Hoden, um eventuelle Hodenbrüche zu ertasten. Bei positivem Befund wurde die Angelegenheit durch eine kurzfristig durchgeführte Operation behoben, um den Kameraden fronttauglich zu machen. Bei dieser Untersuchung war es egal, ob der betreffende Arzt warme oder gar kalte Hände hatte. Es war einfach ein unangenehmes Gefühl, und die neuen unbedarften Kameraden gaben vor Schreck so manche unangemessene komische Töne von sich, was von den anderen mit schallendem Gelächter quittiert und von den Ärzten mit zotigen Sprüchen im Landserjargon kommentiert wurde.
Anschließend erfolgte das Kommando »ganze Abteilung kehrt und bücken« – die Krönung der peinlichen Prozedur. Der Assistenzarzt schaute dann jedem von uns von hinten zwischen die Beine, um Hämorrhoiden zu entdecken, die er bei so jungen Menschen natürlich fast nie fand. Aber was er bei einem neben mir in der Reihe stehenden Knaben fand, ließ ihn lauthals auflachen:
»Hier haben wir einen, den stecken wir gleich zur Kavallerie. Hier ist ja alles grün. Bringt der Kerl doch schon zur Musterung das eigene Pferdefutter mit.«
Es erschallte erneut ein wieherndes Gelächter. Der aus dem Westerwald stammende Junge wurde puterrot, und mir tat er irgendwie leid. Er musste wohl ein menschliches Bedürfnis verspürt und nach erfolgreicher Verrichtung den Hintern mit Grasbüscheln abgewischt haben.
Die Musterungsprozedur war für mich bereits zur Mittagszeit abgeschlossen. Kurz entschlossen nutzte ich die Gelegenheit, um durch die Stadt zu schlendern, und nahm mir dabei die Zeit, in meinem alten Friseurgeschäft bei der Familie Stillings in der Rheinstraße vorbeizuschauen. Die Freude über meinen Besuch war groß, besonders als sie erfuhren, dass ich in Koblenz stationiert war und in diesen bewegten Zeiten wohlauf war. Frau Stillings wünschte mir Glück und bestellte noch schöne Grüße an meine Mutter.
Obwohl es in Koblenz schon mehrmals Fliegeralarm gegeben hatte, war die Stadt doch bis dato vor Bombenschäden verschont geblieben. Ich erlebte sie also in ihrem originalen, wunderschönen Flair mit dem Schloss, der Festhalle, dem Theater und all den prächtigen Plätzen, Straßen und Häusern im Barock- und Jugendstil. Einzig die Auslagen der Geschäfte waren nicht mehr so üppig dekoriert wie noch vor ein oder zwei Jahren. Es gab auch nicht mehr die große Anzahl an Besuchern, und man bemerkte die kriegsbedingten Einschränkungen an allen Ecken.
Nur sechs Tage nach der Musterung brachte unser Briefträger meinen Gestellungsbefehl zur Infanterieausbildung. Anschließend war ich zur Verwendung beim Infanterieregiment Nr. 437 vorgesehen. Dieses Regiment war Teil der 132. Infanteriedivision und befand sich zu jener Zeit mit der Heeresgruppe Süd an der Ostfront auf dem Vormarsch zur Krim und der Stadt Sewastopol. Dazu hatte ich mich zum angegebenen Zeitpunkt, dem 14. April 1942, in der Gneisenau-Kaserne in Koblenz-Horchheim zu melden.
Es ging also wieder zu Fuß und mit dem üblichen Gepäck zu unserem Bahnhof und mit dem Frühzug zum Hauptbahnhof nach Koblenz. Von dort brachte mich die Straßenbahn entlang der oberen Löhrstraße bis zum Kaiser-Wilhelm-Ring, (heute der Friedrich-Ebert-Ring) vorbei an prächtigen Bauten, unter anderem der Festhalle (heute Rheinmosel-Halle), weiter zur Pfaffendorfer Brücke über den Rhein zur rechten Rheinseite und durch Pfaffendorf bis Horchheim. An der Endstation »Alte Heerstraße« angekommen, stieg man aus und musste den langen Berg hinaufgehen bis zu den 1937/38 neu gebauten, großen, modernen Augusta- und Gneisenau-Kasernen und der nicht weit entfernten Deines-Bruchmüller-Kaserne in Niederlahnstein. Meine Kaserne trug den Namen des Generalfeldmarschalls Neidhardt von Gneisenau, der 1805 die Stadt Kolberg in Westpommern an der Ostsee gegen Napoleon und seine Verbündeten verteidigt und später als Reformer der preußischen Armee entscheidend zum Erfolg der Befreiungskriege beigetragen hatte. An der Kasernenwache angekommen, wurde ich mit zahlreichen anderen Rekruten vom UvD (Unteroffizier vom Dienst) in Empfang genommen. Jeder erhielt einen Marschzettel für die Einschleusung.
Es erfolgte ein schnelles, unkompliziertes Ritual ähnlich dem Prozedere, das ich im vergangenen Jahr schon im RAD-Lager kennengelernt hatte, allerdings in verschärfter Form: Kompaniegebäude und Stubenzuweisung, Empfang aller Uniformteile und Ausrüstungsgegenstände bis hin zur Bettwäsche und so weiter. Alles erfolgte unter lauten und klaren Kommandos der Ausbilder im Laufschritt ohne Pausen. Im Gegensatz zum RAD-Barackenlager war der gesamte Gebäudekomplex der Gneisenau-Kaserne neu, groß, weitläufig und äußerst modern.
Küche, Speisesaal, Stuben und Sanitäranlagen, bestehend aus WC und Duschen, waren neuwertig und großzügig bemessen. Die Verpflegungsportionen aus der Mannschaftsküche waren ausreichend und schmackhaft. Trotz des Drills und der rauen Tonart empfand ich den Aufenthalt in der Kaserne angenehmer als im RAD-Lager. Irgendwie fühlten wir uns schon wie Altgediente im Gegensatz zu den Neuen, die unmittelbar von Schule und Lehre zum Militär eingezogen worden waren und außer in der Hitlerjugend keinerlei ideologische Indoktrinierung und paramilitärische Ausbildung erfahren hatten. Darunter gehörten insbesondere auch aktive Landwirte, die nicht zum RAD eingezogen wurden, und Abiturienten, die teilweise schon ein wenig älter waren.
Die ersten Tage und Wochen waren für diese Kameraden besonders hart und ungewohnt. Die Grundausbildung war kein »Zuckerschlecken«, doch nach einer gewissen Zeit gewöhnte man sich an die vielen Neuerungen, Strapazen und Unannehmlichkeiten. Bis auf ganz wenige Ausnahmen waren alle nach kurzer Zeit dem straffen Drill gewachsen.
In den ersten beiden Tagen wurden 250 Mann eingezogen. Als ich in meiner Zwölf-Mann-Stube im ersten Stock eintraf, traute ich meinen Augen kaum. Da stand doch mit dem Rücken zu mir und schon fleißig beim Bettenmachen mein Freund, der Metzgergeselle Paul Seidenfuß aus Koblenz, vor mir.
»Mensch Paul, du alter Pferdemetzger! Das gibt es doch nicht. Sag mir, dass mich keine Halluzinationen reiten. Wie kommst du denn ausgerechnet zur gleichen Zeit in die gleiche Kaserne und auf dieselbe Stube wie ich?«
»Das kann kein Zufall sein und ist gewiss ein gutes Omen«, entgegnete mir Paul und lachte dabei vor Freude, während wir uns herzlich umarmten.
»Jetzt, wo wir nach so kurzer Zeit schon wieder zusammen sind, kann uns in diesem Krieg absolut nichts mehr passieren.«
Nur wenige Augenblicke später trat ein weiterer Kamerad in unsere Stube und hatte dabei wohl unsere Begrüßungszeremonie von vorhin mitbekommen.
»Ich heiße auch Paul, Paul Severin, und komme aus Andernach.« Der nun dritte Kamerad im Bunde war fast noch einen Kopf größer als ich, Abiturient und fand als kompletter Neuling die ersten Tage bei der Wehrmacht weitaus belastender als wir beide. Auch mit diesem netten Gesellen wurden wir schnell Freund. Wir hatten alles in allem Glück mit unserer Einberufung, denn wir konnten den allgemeinen Militärdienst in unserer Heimatstadt Koblenz ableisten.
Dabei verfolgten wir aufmerksam die tagtäglichen Propagandanachrichten und Frontberichte. Danach war die deutsche Wehrmacht seit der Frühjahrsoffensive im Osten in unaufhaltsamem Vormarsch gegen Stalins Rote Armee. Eine russische Armee nach der anderen kapitulierte. Riesige Gebiete in der Ukraine wurden erobert. So verrichteten wir unseren Dienst in der Hoffnung, dass der Krieg bald gewonnen wäre und wir nicht mehr an die Front müssten.
Früh morgens um 5 Uhr weckte uns der UvD mit fürchterlichem Brüllen, das durch die langen Gänge unseres Kompaniegebäudes hallte. Dann kam das übliche Morgenritual, das wir bereits kannten: Frühsport, waschen, Stuben und Revier reinigen, frühstücken und um 7 Uhr antreten. Danach erfolgten Unterricht über alle Aspekte des Militärwesens, Exerzieren auf dem Kasernenhof, Sanitätsausbildung, Instruktionen zur Gasmaske, Schießausbildung mit dem Karabiner 98k, der Pistole 08 und dem neuen MG 42. Wir waren schließlich bei der deutschen Infanterie, der »Königin der Waffen«, wie es im Landserjargon hieß. Ich allerdings vermochte den Vergleich mit einer Königin nicht nachzuvollziehen, sondern hatte eher den Eindruck, dass wir die ärmsten Schweine der Wehrmacht seien – und ehrlich gesagt, wir waren es bereits jetzt und wurden es an der Front erst richtig.
Die Tage waren oft sehr lang, und wir fielen abends todmüde ins Bett. Wir versuchten, in den wenigen zur Verfügung stehenden Stunden so viel Schlaf wie nur möglich zu erhalten.
Durch die kurzen Nachtzeiten und das ständige Schlafdefizit schienen manche auch psychisch Schaden zu nehmen: Wir hatten einen furchtbar langsamen, ängstlichen und stotternden Jungen auf der Stube, der vor lauter Angst bereits morgens um 4 Uhr, eine Stunde vor dem Wecken, damit begann, seine Uniform anzuziehen, sein Bett zu bauen und alles zurecht zu legen, nur damit er rechtzeitig fertig war und um beim UvD nicht negativ aufzufallen. Zum Unmut von uns anderen elf Stubenkameraden raubte er uns damit eine Stunde kostbaren Schlafs. Wir halfen ihm in den nächsten Tagen um des lieben Friedens willen, wo wir konnten. Bereits in der zweiten Woche war der Kamerad schnell und selbstsicher geworden, und alle zwölf Soldaten auf unserer Stube fanden wieder zum gewohnten Schlafrhythmus.
Nur das Stottern konnte sich Jakob lange nicht abgewöhnen. Besonders schlimm war es für ihn an den Tagen, an denen er abends an der Reihe war, beim Eintreten des diensthabenden Unteroffiziers die Stube abzumelden. Vor Aufregung verhaspelte er sich dann beim Sprechen noch mehr und brachte kaum einen richtigen Satz hervor. Wir konnten oft das Lachen nicht mehr unterdrücken und pressten unsere Gesichter in die Wäsche unserer Feldbetten. Auch der jeweilige UvD machte keinen Hehl aus seinem Spott. Das war natürlich noch gemeiner und schlimm für Jakob, und so beschlossen wir alle, dem armen Kerl beizubringen, langsam und ruhig zu sprechen. Wir übten mit Jakob wie auf einer Theaterbühne, die Stube abzumelden, und gaben ihm auf diese Weise immer mehr Sicherheit und Selbstvertrauen. Es funktionierte, und nach kurzer Zeit hatte er seinen Sprachfehler abgelegt. Er war mächtig stolz auf seine treuen Freunde und wir auf ihn. Denn deutliche Aussprache und klare, kurze Kommandos waren nicht nur im Gelände bei unseren Schießübungen wichtig, sondern auch im Feuergefecht, wo sie je nach Situation und Feindbeschuss lebensrettend sein konnten.
Neben Paul Seidenfuß, Paul Severin und Jakob Schmitz soll hier auch der Rest unserer Stubenbelegung vorgestellt werden. Zwei Jungs kamen aus Bayern und hießen Markus Heinrich und Toni Grad. Klaus Baulig stammte aus meinem Nachbardorf Mülheim, Georg Bauder aus Mannheim, Ulrich Schmidt aus Siegen, Herbert Niederländer aus Saarbrücken, Robert Kleinz aus Rüsselsheim und Heinz Luft aus Düsseldorf. Letzterer wurde bereits nach kurzer Zeit für uns alle zum Problem.
Heinz war einer jener Sonderlinge, wie ich sie bereits beim Arbeitsdienst kennengelernt hatte, war jedoch irgendwie wiederum ganz anders. Er gebärdete sich noch extremer, litt scheinbar unter einer krankhaften Profilneurose und passte nicht in unsere Stube, auf unseren Flur, in unseren Kameradenkreis. Sein Mundwerk oder seine »Schnüss«, wie man hier im Rheinland zu sagen pflegt, war ätzend, laut und stand niemals still. Obwohl er auch in der Lage war, in normaler Zimmerlautstärke zu sprechen, wie man gelegentlich vernehmen konnte, musste er sich permanent aufspielen, krakeelte herum und erzählte neben irgendwelchen Halbwahrheiten allerlei haltlosen Unsinn. Er war ein »Schwätzer vor dem Herrn«, setzte sich ständig in Szene, wollte mit Gewalt auffallen, war jedoch wegen seiner mäßigen Intelligenz für nichts zu gebrauchen. Nie konnte er sich zurücknehmen, suchte ständig ein Opfer, das er belabern wollte, und ging durch seine penetrante Art jedem, der sich in seiner Nähe aufhielt, massiv auf den Geist.
Sein durchdringendes Organ hallte durch alle Gänge und Treppenhäuser. Unentwegt sang er obszöne Lieder, erzählte primitive, vulgäre Witze und gab ansonsten nur Quatsch von sich. Er mischte sich in alle Gespräche ein, ohne deren Sinn zu erfassen, nichts konnte er für sich behalten, alles musste er sofort ausposaunen, wobei er sich zwischen Halbwissen und purer Märchenerzählerei bewegte. Morgens grüßte er mit »guten Abend«, abends mit »guten Morgen«. Am Osterfeiertag begegnete er uns mit »frohe Weihnachten« oder »frohes neues Jahr«, wie es ihm gerade passte.
Seiner Aufschneiderei und seines Sprachschatzes wegen vermuteten wir, dass er aus dem Rotlichtmilieu kam. Jedenfalls war dieser Mann stressig und unzuverlässig und sorgte dafür, dass unsere Stube immer wieder negativ auffiel. Dazu war er dem Alkohol sehr zugetan, und es schien, als konzentriere sich sein ganzes Interesse auf Fressen und Saufen.
Bei der militärischen Ausbildung in der Kaserne wie im Gelände stellte er ein unwägbares Risiko dar, insbesondere bei Übungen an der Waffe. Hieß es beim morgendlichen Antreten »linksum« und alle 52 Mann unseres Zuges folgten dem Kommando, so machte Heinz »rechtsum«. Er brachte mit seinen Faxen unseren netten Zugführer Feldwebel Engelbert Haymann, der ebenfalls wie unser Stubenkamerad Klaus Baulig aus meinem Nachbarort Mülheim stammte – beide waren übrigens Cousins – damit an den Rand des Wahnsinns.
Haymann brüllte in solchen Fällen: »Sie selten dämliches Rindvieh, Sie Riesenidiot, links ist da, wo der Daumen rechts ist«, womit die Verwirrung noch größer wurde. Beim Marschieren trällerte Heinz für sich immer wieder seine frivolen Lieder und brachte damit die marschierende Truppe aus dem Tritt. Natürlich wurde ihm dann Strafexerzieren verordnet, aber auch das nutzte nichts. Die härtesten Ausbilder bissen sich an diesem Trottel die Zähne aus.
Normalerweise wäre einem solchen Querulanten eine zünftige Abreibung in Gestalt des »Heiligen Geistes« sicher gewesen, aber wegen der zu erwartenden Aussichtslosigkeit verzichteten wir auf diese Art pädagogischer Maßnahmen.
Eines Morgens beim Antreten vor den Stuben in unserem langen Gang, alle standen bereits in Uniform im »Stillgestanden«, kam Heinz im Schlafanzug vor den Unteroffizieren und uns Mannschaften vorbeispaziert, guckte blöd aus der Wäsche und zog dabei eine lange Schnur hinter sich her. Am Ende der Schnur hatte er seine Zahnbürste festgebunden, sprach mit ihr wie mit einem Hund und rief ständig: »Fiffi, komm, Fiffi, komm bei Fuß«. Wir brüllten vor Lachen. Heinz machte sichtlich auf »bekloppt« und hatte allerdings mit diesem Auftritt den Bogen endgültig überspannt.
Als wir abends nach Dienstende auf unsere Stube einrückten, waren Bett und Spind von Heinz Luft geräumt. Ob er nach Andernach in das damalige Irrenhaus, später Landesnervenklinik genannt, eingeliefert wurde oder in einem Gefängnis oder gar einem Strafbataillon landete, haben wir nie erfahren. Wir waren nur froh, dass dieser dämliche Kerl endlich weg war. Ich persönlich glaubte nicht, dass er geisteskrank war. Vielmehr hielt ich ihn für einen Drückeberger und Simulanten. Doch diese Masche hatte in der damaligen Zeit wenig Aussicht auf Erfolg.
Die Aufteilung der Stuben erfolgte nach Größe. Ich befand mich mit meinen Kameraden unter den Größten in der ersten Stube. Bereits in der zweiten Stube waren die Kameraden kleiner, wobei mit wachsender Nummerierung der Stuben die Größe der Soldaten umgekehrt proportional abnahm. Bereits am zweiten Tag freundete ich mich mit dem nur 1,67 Meter großen und kräftigen Landwirt Josef Reif aus Dieblich-Berg an der Mosel an, der in der letzten Stube untergebracht war, sowie mit dem Landwirt Paul Wagner aus Nörtershausen. Da ich selbst aus einem landwirtschaftlichen Betrieb kam, hatten wir ausreichend Gesprächsstoff für unsere knapp bemessene Freizeit. Auch hatte ich als bereits erfahrener Arbeitsdienstler die Möglichkeit, Josef, Paul und weiteren Kameraden in der schwierigen Anfangsphase der Grundausbildung mit Rat und Tat beizustehen. Das führte einmal zu folgender Aktion, die mir gründlich misslang, aber für uns alle zum Glück glimpflich ausging:
Bereits in den ersten Tagen ertönten in jeder Nacht die Luftschutzsirenen über Koblenz und unserer Kaserne. Wir hatten Anweisung, in diesem Fall die Kellerräume aufzusuchen und nach der Entwarnung in die Stuben zurückzukehren. Josef allerdings hatte als erfahrener Landwirt nach dem Entwarnungssignal der Sirenen die Pferdeställe aufzusuchen, um die Tiere zu beruhigen, gegebenenfalls aus den Hallen zu führen und anschließend erst seine Stube aufzusuchen.
Spätestens nach der vierten Alarmnacht mit permanentem Schlafentzug überredete ich Josef, einfach mit mir im Keller liegen zu bleiben und bis zum Dienstbeginn auszuschlafen. Ich hatte nämlich am Vortag einen Raum mit Betten entdeckt, in dem sich tagsüber einige Feldwebel und Unteroffiziere ein kleines »Nickerchen« erlaubten. Was diesen tagsüber vergönnt war, probierten wir in der kommenden Alarmnacht selbst aus. Dabei legten wir uns jedoch nicht auf, sondern unter die Feldbetten und schliefen nach dem beendeten Alarm so tief ein, dass wir erst am späten Morgen, als die Sonnenstrahlen bereits durch ein kleines Kellerfenster in den Raum schienen, gegen 10 Uhr unsanft geweckt wurden. Unser korpulenter Spieß, Hauptfeldwebel Groß, hatte uns wie Nadeln im Heuhaufen gesucht und schließlich im Keller unter den Betten gefunden. Wutentbrannt brüllte er uns an:
»Ihr verdammten Drückeberger, seid ihr des Wahnsinns? Wir suchen euch schon seit Stunden im ganzen Kasernenbereich und ihr verpisst euch hier unten im tiefsten Keller. Ich lasse euch strafexerzieren! Arrest und Ausgangssperre für unabsehbare Zeit sind auch angesagt. Wir sind doch hier nicht im Zirkus, wo jeder Affe machen kann, was ihm gerade einfällt!«
Zum großen Glück hatte ich mir wegen der niedrigen Temperaturen im Keller noch in der Nacht einen Schal um den Hals gebunden und erklärte mit simulierter, heiserer und kaum wahrnehmbarer Stimme: »Bin krank, habe Rachenentzündung Herr Hauptfeldwebel. Kann nicht mehr sprechen.«
Mein Kamerad Josef Reif hatte spontan keine Ausrede parat. Beide befürchteten wir eine drakonische Strafe. Nur weil wir in den ersten Ausbildungstagen noch nicht vereidigt waren, kamen wir mit einem blauen Auge und einer scharfen Ermahnung davon. Der Hauptgrund für diese unerwartete Milde lag jedoch in dem Umstand, dass alle geschlossen bei der nur sechs Tage nach unserer Einberufung anstehenden Vereidigung auf Adolf Hitler am 20. April – »Führers« Geburtstag –, in der nebenan liegenden Augusta-Kaserne antreten sollten. Nur Josef, der die ihm anvertrauten Pferde gröblich vernachlässigt hatte, erhielt von Hauptfeldwebel Groß eine eher spektakuläre als strenge Strafe. Er musste sich einen dicken, langen Holzknüppel zwischen die Beine stecken und auf diesem wie auf einem Holzpferd sitzend mehrfach wiehernd an uns vorbeireiten, wobei ihm Groß mit einer Reitpeitsche leicht auf den Hintern klopfte. Das Gelächter war unbeschreiblich, und am meisten lachte Josef selbst. Nur mir blieb das Lachen im Hals stecken, denn diese Angelegenheit hätte weiß Gott auch deutlich schlimmere Konsequenzen nach sich ziehen können.
Zur Gelände- oder Schießausbildung mussten wir morgens um 7 Uhr antreten. Mit voller Ausrüstung marschierten wir anschließend den steilen Berg zur »Schmittenhöhe«hinauf, dem örtlichen Truppenübungsplatz. Unteroffizier Kleinschmitt und Unteroffizier Josef Bauer aus Miesenheim hatten die Angewohnheit, im steilsten Wegeabschnitt das Anlegen der Gasmasken zu befehlen, wobei auch noch drei Lieder gesungen werden mussten. Was uns das stupide Marschieren oft kurzweiliger machte, wurde unter der Gasmaske beim Berganstieg zur Qual. Wir hatten kaum Luft zum Atmen und das zusätzliche Singen fiel uns schwer. Vielleicht sollte die Prozedur die Lungen stärken oder uns auf Schlimmeres vorbereiten. Da aber Unteroffizier Kleinschmitt im Gegensatz zu Unteroffizier Bauer diese Prozedur jedes Mal zu befehlen pflegte, wandte ich einen Trick an, indem ich meinen Unterkiefer leicht bewegte, tief Luft holte, aber nicht mitsang. Nachdem das auch andere Kameraden nachmachten und die Lautstärke der marschierenden Kolonne abnahm, trat Kleinschmitt zum Lauschen dicht an uns heran. Immer dann, wenn wir im Augenwinkel sahen, dass er sich näherte, grölten wir unter der Gasmaske heraus mit dumpfer Stimme das entsprechende Lied, bis er wieder aus dem Hörbereich verschwand. Unser Lachen unter der Maske konnte er nicht sehen, aber es kostete uns noch mehr Luft. Trotzdem lachten wir gerne, denn der Schalk saß uns im Nacken, und wir hatten das Lachen noch nicht verlernt.
In der vierten Woche erfolgte ein Bataillonsappell. Gestriegelt und geschniegelt standen wir um 14 Uhr in herausgeputzter Uniform auf dem Appellplatz. Angekündigt war eine Inspektion durch unseren Regimentskommandeur Oberstleutnant Kindsmüller. Auf ein Kommando unseres Spießes »erstes Glied fünf Schritt, zweites Glied drei Schritt nach vorne treten«, setzte sich das ganze Bataillon in Bewegung und bildete zwei Gassen. Kindsmüller schritt die Front von allen drei Reihen ab und schaute jedem Einzelnen von uns ins Gesicht. Er begann in der hintersten Reihe, und da ich wegen meiner Größe zu Beginn der ersten Reihe neben Klaus Baulig und Paul Severin stand, kam er erst zum Schluss an uns vorbei. Genau vor mir blieb er stehen und schaute mir intensiv ins Gesicht:
»Sie heißen?«
»Schütze Sauer, Herr Oberstleutnant.«
Daraufhin kam eine weitere Frage: »Möchten Sie mein Bursche werden?«
Ich antwortete mit einem lauten »Jawohl, Herr Oberstleutnant!«
»Schütze Sauer, Sie melden sich nach dem Appell bei mir im Kommandeursbüro!«
Ich machte ordnungsgemäß im Stillgestanden meine Meldung und begab mich unmittelbar im Anschluss wie befohlen zu Oberstleutnant Kindsmüller. Dieser Mann strahlte eine souveräne Ruhe aus und wirkte auf mich wie eine Art fürsorgliche Vaterfigur. Er bot mir sofort eine Zigarette an und erklärte in wenigen Sätzen höflich meine zusätzlichen Aufgaben. Diese bestanden überwiegend darin, Schuhe und Stiefel zu putzen, die Uniform ordentlich herzurichten, gegebenenfalls Essen zu holen sowie Botendienste, Postdienste und sonstige Kleinigkeiten zu leisten. Diese Tätigkeiten entbanden mich allerdings in keiner Weise vom täglichen Dienstalltag, sondern gingen zusätzlich auf das Konto meines sowieso schon knapp bemessenen Freiraumes.
Er fragte mich nach meinem Alter, Herkunft, Elternhaus und Beruf. Als ich ihm vom allzu frühen Tod meines Vaters erzählte, wurde der Mann, der vom Alter her genauso hätte mein Vater sein können, plötzlich sehr ruhig und nachdenklich.
»Auch meiner Frau und mir ist vor Kurzem ein sehr grausames Schicksal widerfahren.« Während er sprach, schaute er regungslos und starr aus dem Fenster. »Unser geliebter Sohn ist bei der Frühjahrsoffensive unserer Wehrmacht an der Ostfront im Alter von 19 Jahren gefallen. Unser Fritz war ein wundervoller Mensch und wurde nur ein Jahr älter als du.«
Als ich daraufhin erwähnte, dass ich den gleichen Vornamen trug, herrschte im Raum eine bedrückende Stille, und ich spürte die Betroffenheit des älteren Mannes. In diesem Augenblick konnte ich deutlich spüren, wie nahe ihm der Tod seines Sohnes ging. Erst später an der Front wurde mir klar, dass Oberstleutnant Kindsmüller mich als eine Art Sohnersatz betrachtete und ich in ihm einen Ersatz als Vater gefunden hatte.
In der darauffolgenden Woche wurden in unserem Bataillon einige Wettkämpfe abgehalten, um die besten Sportler zu ermittelt. Diese fanden nicht nur in unserer Gneisenau-Kaserne statt, sondern in allen anderen Kasernen und militärischen Einrichtungen im weiteren Umkreis. In der Stadt und im Großraum Koblenz lagen damals fast 20 000 Soldaten. Der Grund für die Sportlerauswahl lag darin, dass die Gauhauptstadt Koblenz 14 Tage später im Stadion Oberwerth ein großes Leichtathletik-Sportfest plante und akribisch durchorganisierte. Wegen meiner bereits erkannten sportlichen Leistungen erhielt ich neben dem allgemeinen Kasernendienst und Burschendienst für unseren Kommandeur täglich zwei Stunden dienstfrei, um für dieses Ereignis entsprechende Trainingseinheiten zu absolvieren. Ich hatte allerdings nur nach dem Abendessen nach 18 Uhr Gelegenheit, gemeinsam mit einigen anderen ausgewählten Kameraden zu trainieren.
Hier war ich natürlich wieder in meinem Metier und freute mich auf die Abende, egal, wie mühsam und schwer sich der Dienst tagsüber auch gestaltet hatte. Ich war schließlich ein leidenschaftlicher Sportler. Bereits in früheren Jahren war ich immer vorne mit dabei gewesen. Einige interessante Begebenheiten kamen mir in diesem Zusammenhang wieder in den Sinn:
Unsere Jugendzeit bestand natürlich nicht nur aus Arbeit oder daraus, dass wir andere Leute durch Jungenstreiche ärgerten. Unsympathische Leute, die wir nicht leiden konnten, welche uns auch schon mal negativ aufgefallen waren oder uns zu Recht oder auch zu Unrecht geärgert oder verdroschen hatten, wurden trotzdem ab und an Opfer unserer Streiche. Jedoch waren diese eher harmlos, und es kam nie vor, dass wir etwas kaputt machten oder zerstörten. Wurde aber zum Beispiel ein Tür- oder Hoftorgriff mit Wagenfett eingeschmiert, erschien so mancher Kandidat verspätet mit schwarzer Hand in der Sonntagsmesse. Wir schauten dann genau hin, ob es bei dem auserwählten Opfer funktioniert hatte.
Erfuhr jedoch Vater von so einem Schabernack, gab es für den Streich eine deftige Schelte oder ein paar auf den Hosenboden. Meistens aber kam er mir nicht nach, da ich schneller laufen konnte als er. An zwei derartige Situationen kann ich mich gut erinnern:
Zum einen, als herauskam, dass meine besten Freunde Edgar Weiber und Arnold Lohner mit mir zusammen einem hässlichen, streunenden und ewig kläffenden, doofen Dorfköter eine Blechdose an den Schwanz gebunden hatten, worauf der arme Kerl jaulend den Altengärtenweg Richtung Bur entlangraste, während die Dose hinter ihm auf dem Pflaster schepperte.
»Ja, es tut mir aufrichtig leid und es wird nie wieder vorkommen«, rief ich Vater zu, als ich nach Hause kam.
Der örtliche Dorftratsch hatte uns bereits verraten, und Vater lief mir mit dem Stock bis in die Scheune nach. Atemlos blieb er unten an der Leiter stehen, während ich so hoch wie es nur irgend ging, fast bis unters Scheunendach, ins Stroh kletterte. Der Hunger trieb mich nach einer Stunde zurück in die Küche. Vater war zum Glück um die Ecke im Lindenhof auf einen Schoppen Wein eingekehrt, und so geriet die prekäre Angelegenheit unter Mutters Vermittlung schnell in Vergessenheit.
Ein anderes Mal wurden wir zusammen mit einigen Jungs beim heimlichen Rauchen erwischt und bereits in der Schule mit Nachsitzen und Strafarbeiten bedacht. Irgendwie erfuhr es Vater, bevor ich aus der Schule nach Hause kam. Als ich bei der Rückkehr hinter unserem Hoftor seine Schuhe erkannte, wusste ich sofort, was die Stunde geschlagen hatte.
Es blieb mir nur die Flucht nach vorne. Ich stieß das Tor auf und rannte an meinem verdutzten Vater vorbei in die Küche. Er lief mir sofort nach, und als er mich in der Küche im Kopfstand, den Hintern an der Wand vorfand, war die Situation entschärft, da Vater herzhaft lachen musste. Sein »Fritzje« kam wieder einmal durch einen neuen Trick mit einem blauen Auge davon. Irgendwie spürte ich, dass Vater auf meinen Einfallsreichtum, meine Schnelligkeit und sportlichen Fähigkeiten insgeheim mächtig stolz war.
Mein knabenhafter Mut reichte zwar zum heimlichen Rauchen mit Klassenkameraden, aber er verließ mich schnell, wenn einmal im Jahr der mobile Zahnarzt mit seinem Auto voller schrecklicher Instrumente an unserer Schule vorfuhr, wie dies ab 1933 alljährlich geschah. Sämtliche Schulkinder einschließlich der Lehrkräfte mussten sich einer vorsorglichen Zahnuntersuchung unterziehen. Aus Angst vor dieser Zeremonie verschwand ich regelmäßig und lief zu Mutter nach Hause. Sie brachte mich jedoch zurück zur Schule, und ich konnte dem netten Zahnarzt mit seinem mechanischen Zahnbohrer nicht mehr entkommen. Dass es zur Belohnung anschließend etwas Süßes gab, brachte nicht den gewünschten Erfolg, und im folgenden Jahr unternahm ich den nächsten Fluchtversuch. Leider gehörte ich zu den Schülern, bei denen es nie ohne Bohren abging.
In meiner Kindheit wurde ich nicht nur durch die Erziehung meiner Eltern geprägt, sondern auch durch die damals noch recht strenge katholische Kirche. Nicht nur an jedem Sonn- und Feiertag, sondern auch bei zahlreichen anderen Anlässen mussten wir die Messe besuchen. Das beanspruchte natürlich auch wieder einen Teil unserer kostbaren Zeit. Als guter Christ erzogen, glaubte ich natürlich an Gott, und das Beten habe ich insbesondere später im Krieg in Russland und bis ins Alter nie verlernt. Trotzdem hatte ich keine Lust, das Angebot unseres Pfarrers, mich zum Messdiener zu ernennen, anzunehmen.
Für unseren fürsorglichen Vater war es natürlich selbstverständlich, dass seine Kinder regelmäßig und ordentlich gekleidet jeden Sonntag zum Hochamt erschienen. So stand er jeden Sonntagmorgen in unserer Waschküche neben der Scheune, putzte für uns vier Jungs die hohen genagelten Schuhe und klopfte den einen oder anderen fehlenden Nagel in die Ledersohlen.
Ich hingegen verbrachte meine freie Zeit lieber auf unserem Sportplatz unten am Bach. Dorthin zog es mich in jeder freien Minute, und früh erkannte ich, dass der Sport meine größte Leidenschaft war. Hier konnte ich meinem Bewegungsdrang freien Lauf lassen. Wir spielten jeden Tag Handball und ab und an auch Fußball, soweit es das Wetter zuließ. Hier fanden die spannenden Spiele unserer 1. Mannschaft im Feldhandball statt. Der TV Bassenheim 1911 e. V. spielte in der Oberliga Rheinland, der damals höchsten Spielklasse im Deutschen Reich. Anpfiff war immer sonntags um 14 Uhr. Wenn die starken Mannschaften von Grün-Weiß Mendig, Welling, Weibern, Mülheim, Kärlich oder Urmitz antraten, war unser Dorf wie ausgestorben, und alle standen rund ums Spielfeld. Manchmal, bei hochkarätigen Spielpaarungen, waren es mit den angereisten Gästen, die überwiegend zu Fuß kamen oder auf offenen Lkw mitfuhren, annähernd 2000 Zuschauer.
Zu meiner ersten Heiligen Kommunion am Weißen Sonntag 1932 schenkten mir meine Eltern einen echten Lederhandball. Das war damals mein kostbarster Besitz. Nun waren dem täglichen Training keinerlei Grenzen mehr gesetzt, und ich war überglücklich.
Neben dem Handball war die Leichtathletik mit den Disziplinen Werfen, Laufen und Springen mein Favorit. So sprang ich gerne und oft in die alte Weitsprunggrube neben unserem Sportplatz, deren Inhalt nur aus einer dünnen Sandschicht bestand, die noch dazu oft mit Steinen und manchmal auch mit Hundekot angereichert war. Das Werfen übte ich mit allem, was mir in die Finger kam, vom Schotterstein bis zum selbst geschnitzten Speer aus Haselnussholz.
Den alljährlichen Sportfesten fieberte ich schon Wochen vorher entgegen, und das Training wurde noch intensiviert. Kam dann der große Tag, war die Spannung riesengroß. In den Schuljahren sechs bis acht erhielt ich die höchste Punktzahl, und es gab als Siegespreis immerhin einen Lorbeerkranz. Ich kann mich gut erinnern, dass ich die achtzig Gramm schweren Lederbällchen fast von einem Tor bis zum anderen warf. Allerdings war der Sportplatz nicht wie üblich 100 Meter, sondern nur knapp neunzig Meter lang. Trotzdem war es enorm weit.
Beim Weitsprung hörte ich oft einige rufen: »Der Fritz springt! Der Fritz springt!« Und so standen um die Sprunggrube oft mehr als zwei Dutzend Zuschauer, die mich anfeuerten. Durch das viele Sprungwurftraining als Rechtshänder im Handball war meine Sprungkraft im linken Bein stark ausgeprägt. Die drei Sprungversuche, die jedem Teilnehmer zur Verfügung standen, erreichten ab der siebten Klasse immer Weiten von deutlich über sechs Meter. Ohne spezielles Training und angesichts der schweren und minderwertigen Sportschuhe sowie der mangelhaften Anlaufbahn war das eine beachtliche Leistung.
Im Feldhandball hatte ich in der ersten Mannschaft einige Vorbilder, denen ich vieles an Technik und Tricks abschauen konnte. Ich selbst spielte seit den Jugendmannschaften aufgrund meiner Schnelligkeit auf der Position des Mittelläufers. Dazu muss man wissen, dass eine Mannschaft im damals beliebten Großfeld-Handball wie beim Fußball aus elf Spielern bestand. Neben dem Torwart befanden sich vier Spieler in der Abwehr, die sich nur in der eigenen Spielfeldhälfte bis zur Mittellinie aufhalten durften. Vier Spieler waren im Sturm und blieben nur in der gegnerischen Hälfte. Die beiden Mittelläufer dagegen konnten sowohl im Sturm als auch in der eigenen Abwehr spielen. Diese beiden Spieler hatten daher über die volle Distanz ein enormes Laufpensum zu bewältigen. Neben der Verstärkung von Abwehr und Sturm bestand die Hauptaufgabe darin, Bälle abzufangen und diese so schnell wie möglich dem eigenen Sturm zuzuspielen, noch ehe die beiden gegnerischen Mittelläufer sich in der Abwehr positionieren konnten. Einige ältere Zuschauer nannten mich »das Reh«, wahrscheinlich wegen meiner Spurtstärke und Sprungkraft. Wenn ich ehrlich sein soll, war ich ziemlich stolz darauf.
Zwei meiner sportlichen Vorbilder möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das war zum einen der hervorragende Torwart Paul Theisen, der später im Krieg gefallen ist, und zum anderen Josef Ringel, Jahrgang 1914. Er überlebte den Krieg und betrieb später ein Textil- und Lebensmittelgeschäft in der Mayener Straße. Josef war 1936 im Kader der Deutschen Feldhandball-Olympia-Mannschaft in Berlin, und das war für uns schon etwas ganz Besonderes. Josef erhielt den Spitznahmen »I«. Einfach »I« wie Ida. Das rührte daher, dass er beim Abwurf des Handballes während eines Sprungwurfes ganz laut die Luft ausstieß, um dem Ball eine hohe Abwurfgeschwindigkeit mitzugeben. Dabei erzeugte er ein Geräusch, das wie ein gepresstes »Ihhhhhhjehhhh« klang, und damit war der Spitzname geboren.
Besonders fasziniert war ich damals von dem von Leni Riefenstahl mit modernsten Mitteln gedrehten Film über die Olympiade 1936 in Berlin. Seit ich ihn zum ersten Mal in der Kinowochenschau gesehen hatte, träumte ich davon, einmal als Zehnkämpfer an einer Olympiade teilnehmen zu dürfen. Vielleicht 1944, dachte ich, 1948 oder 1952. Dass es 16 Jahre dauern würde, ehe eine deutsche Mannschaft wieder an einer Olympiade teilnehmen durfte – 1952 in Helsinki – hätte ich damals nicht für möglich gehalten. In meinen Gedanken drehte sich damals alles um den Sport. Wann und wo ich nur irgendwie Gelegenheit fand, trainierte ich in allen möglichen Disziplinen, vor allem Werfen, Laufen und Springen. Sogar am Training der erfolgreichen Bassenheimer Ringermannschaft, das mangels Turnhalle in den beiden Sälen der Dorfgaststätten Koch und Poll stattfand, nahm ich öfter teil und lernte dabei so manchen Trick.
Am Tag des Sportfestes marschierten wir mit unserer Abordnung zu Fuß die Alte Heerstraße hinab, gingen über die Horchheimer Eisenbahnbrücke zur anderen Rheinseite und gelangten auf diesem Wege unmittelbar zu den Sportstätten. Das Stadion Oberwerth füllte sich mit einer großen Anzahl von Sportlern und Zuschauern. Ich schätzte die Anzahl der Aktiven auf weit über 300. Obwohl von allen umliegenden Sportvereinen kleine Abordnungen zugegen waren, bestand doch der überwiegende Teil der Akteure aus Soldaten, Arbeitsdienstleistenden und Hitlerjugend. Wie sollten die Sportvereine auch große Mannschaften aufstellen, da doch die infrage kommenden Jahrgänge seit nun schon fast drei Jahren an allen Fronten kämpften?
Man meldete mich für den Mehrkampf, und so genoss ich den freien Tag in vollen Zügen. Körperlich und mental absolut fit, konnte ich meine Leistungen im Laufen, Springen und Werfen punktgenau abrufen. Am späten Nachmittag erfolgte die Siegerehrung, und ich war unendlich stolz darauf, dass ich im Mehrkampf die höchste Punktzahl erreicht hatte. Zur Siegerehrung musste ich aufs Podest klettern, und man drückte mir einen Lorbeerkranz aufs Haar. Dazu erhielt ich ein Sammelalbum mit Einklebe-Bildern von allen damaligen Handwerksberufen und obendrein zusätzlich einen Tag Sonderurlaub.
Meine Träume von der Teilnahme an einer Olympiade erhielten durch diesen Erfolg neue Nahrung, doch die politischen und militärischen Ereignisse der folgenden Jahre sorgten dafür, dass es Träume blieben. Schon am nächsten Tag war nach einer lobenden Erwähnung durch den Kommandeur der tägliche Militärdrill wieder allgegenwärtig. Die Zeit der Ausbildung näherte sich dem Ende, denn an der Ostfront wurden neue Soldaten gebraucht. Die Kaserne wurde bereits für die nächste Generation von Rekruten benötigt.
In der letzten Woche fand am Zusammenfluss von Rhein und Mosel, am heutigen Deutschen Eck, eine Parade unserer Truppen statt. Es war eine riesige abendliche Inszenierung mit Marschmusik, gespielt von einem großen Musikkorps der Wehrmacht. Unter den Klängen von »Des Großen Kurfürsten Reitermarsch« zogen wir in Sechserreihen am Denkmal von Kaiser Wilhelm I. vorbei, und weiter ging es im Stechschritt zum »Badenweiler« und »Yorckschen Marsch«. Während dieser Zeremonie fühlten wir uns als Teil einer großen Volksgemeinschaft und kamen uns stark, mächtig und unbezwingbar vor – ein Eindruck, der sich bald ändern sollte.
Abgesehen von dieser beeindruckenden Zeremonie hielt sich meine Begeisterung für das Militärwesen jedoch in Grenzen. Ich konnte dem Kriegshandwerk und besonders der zweijährigen allgemeinen Wehrpflicht, die durch den nicht enden wollenden Krieg später unbegrenzt verlängert wurde, keine allzu große Begeisterung abgewinnen. Die Ausbildung hatte uns zu schneidigen und hervorragend durchtrainierten Soldaten gemacht, aber in den Krieg zu ziehen, stand nicht auf unserer persönlichen Agenda, und das galt für alle meine engsten Kameraden. Aber uns blieb nichts anderes übrig – nicht in diesem Krieg und nicht in diesem politischen System.
An einem der letzten Unterrichtsvormittage im Hörsaal unserer Kaserne erfuhren wir, dass bereits am 31. Mai 1942 durch den ersten 1000-Bomber-Angriff der britischen Royal Air Force Köln in Schutt und Asche gelegt worden war. Von der schönen Altstadt und Tausenden Wohnhäusern standen nur noch Ruinen umher, überragt von dem durch die Feuersbrunst geschwärzten gotischen Dom. Dieser erste Großangriff hatte vor allem der Zivilbevölkerung gegolten. Industrieanlagen wurden kaum getroffen. Es gab Tausende tote Frauen, Kinder und alte Menschen. Wir waren sehr betroffen und sprachen unserem Kölner Kameraden Jakob Schmitz unser Mitgefühl aus. Seine sorgenvolle Miene hellte sich erst nach Tagen wieder auf, als er erfuhr, dass zwar das Haus durch Bomben zerstört worden war, seine Familienangehörigen aber den Angriff unversehrt in einem Bunker überlebt hatten.
Am übernächsten Tag, kurz vor unserer Verlegung zum Truppenübungsplatz Baumholder, wurden wir im Sanitätsbereich unserer Kaserne gegen alle möglichen Krankheiten geimpft, die uns an der Front bedrohen konnten, wie zum Beispiel Typhus, Wundstarrkrampf und so weiter. Es war ein schnelles und kurzes Antreten. Die Rekruten standen mit freiem Oberkörper in einer Schlange, die bis nach draußen vor den Haupteingang des Gebäudes reichte, und die Impfungen erfolgten wie am Fließband.
Nur zwei Meter vor mir stand der hünenhafte Paul Severin in der Schlange. Über die Schultern der Vorderleute sahen wir unseren Stabsarzt mit einer riesengroßen Spritze hantieren. Damit stach er zügig und professionell einem nach dem anderen in die Brust – immer mit derselben Nadel wohlgemerkt. Je näher wir zum Impfen aufrückten, desto weißer wurde Pauls Gesicht. Als der Doktor die Nadel der großen Spritze dem letzten Vordermann in die Brust drückte, rollte Paul plötzlich ganz komisch die Augen, schnappte nach Luft und wedelte mit den Armen. Ich rief nur noch: »Paul, wo willst du denn hin?«, und schon lag der lange Kerl bewusstlos vor den Füßen des verdutzt dreinschauenden Militärarztes. Paul erhielt wohl auch noch alle Impfungen, aber als Letzter unseres Bataillons, nachdem er sich auf einer Pritsche von seiner Spritzenangst erholt hatte.