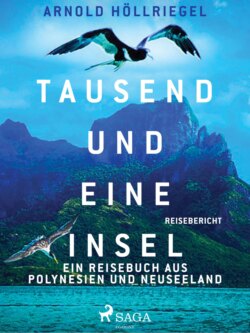Читать книгу Tausend und eine Insel. Ein Reisebuch aus Polynesien und Neuseeland - Arnold Höllriegel - Страница 5
ОглавлениеIch hatte die Endstation der elektrischen Strassenbahn hinter mir gelassen und die Gartenstrasse zwischen den lieben luftigen Bungalows. Ich ging, durch eine angenehme und duftende Sonnenhitze, langsam bergauf, dem Bergpass Pali zu; über meinem leinenen Anzug hing mir eine lange, dicke Girlande aus dem weissen Jasmin der Insel, den sie Nau nennen; ich hatte mir diese Girlande um den Hals gehängt, nicht aus besonderer Verschmocktheit, sondern weil ich der lachenden Bitte eines kanakischen Knaben nicht hatte widerstehen können; einen anderen Kranz, aus stark riechenden scharlachroten Blüten, hatte er mir um meinen Panama gelegt; so ging ich, geschmückt wie ein König oder wie ein Pfingstochse, die Bergstrasse empor, bis sie einsamer wurde und an der Seite eines tiefen Abgrundes höher stieg. Ab und zu rollte ein Auto an mir vorbei, mit Touristen von unserem Schiff, die die berühmte Aussicht sehen wollten oder die Ananasplantagen; oder es sass ein alter Amerikaner im Auto oder eine Dame mit japanischen Gesichtszügen, zwischen reizend drolligen Kindern; einmal war es eine ganz alte, fette Chinesin, in Hosen und einem Hemd aus schwarzem Satin. Ich kam auf den Serpentinen höher und höher, bis ich tief unter mir Honolulu liegen sah, den Hafen, die beiden roten Riesenschornsteine des Schiffes, das mich hergebracht hatte, und die ganze grausame Geometrie einer westamerikanischen Stadtarchitektur, in die lieblichste aller Landschaften hineinliniiert.
An dieser Stelle setzte ich mich auf einen Stein, im Schatten eines Baumes, voll von purpurnen Blütenbällen, den ich den Ohiabaum zu nennen bereits gelernt hatte. Ich hatte ein Buch bei mir, die schönen und krausen Legenden des braunen Volkes von Hawaii enthaltend; ich sass ganz glückselig da, mit einer von den leichten Manilas im Mund, die ich mir zu dem Spaziergang gekauft hatte. Manchmal las ich, und manchmal sah ich hinab, mit verliebten Blicken, die den holden Küstenumriss liebkosten, das Blau des Meeres und die weisse Linie des umbrandeten Korallenriffs. Nach einiger Zeit kam ein Mann des Weges, mit einem sonderbaren Ding in der Hand. Er achtete nicht auf mich, sondern setzte sich, langsam und unbeholfen, mir gerade gegenüber, jenseits des Strassenbandes, auf der Seite der Schlucht von Nuuanu, deren Wände hier steil abfielen, ganz bedeckt von einem unsagbaren Gewirr schwarzgrüner Laubbäume, ganz heller Farne und schreiend bunter Blüten ohne Zahl. Nun sass der Mann. Er trug schmutzige Leinenschuhe, eine Hose aus Segelleinwand, ein Hemd und den groben Strohhut des Landes. Jetzt wandte er mir sein Gesicht zu. Er war ein nussbrauner Kanake, zwischen Vierzig und Fünfzig, pockennarbig und offenbar blind. Er packte das Ding aus, das er mitgebracht hatte, es war eine von diesen dreisaitigen Gitarren, die, glaube ich, Ukulele heissen. Als der Mann das Geräusch eines nahenden Autos hörte, begann er mit einer schönen vollen Stimme zu singen, während er auf seinem Instrument mehr trommelte als Musik machte. Er sang in jener wunderbaren Sprache Polynesiens, deren vokalreiche Dialekte einander auf all den vielen, weit zerstreuten Inseln so sehr gleichen; die Melodie schien mir nur ein rhapsodischer Rhythmus; ich bildete mir von Anfang an ein, dass der Mann nicht lyrisch, sondern episch sang, dass er eine lange Geschichte zur Ukulele rezitierte.
Ich sass ganz still, und ich wusste nicht, ob der Blinde von meiner Anwesenheit wusste. Aber er wandte sein ernstes und hässliches Gesicht fortwährend mir zu, und er sang auch dann weiter, wenn kein Auto vorbeifuhr. Ich nahm mir vor, ihm nachher ein Almosen in den Schoss zu legen, und empfand unterdessen das nicht unangenehme, wenn auch einförmige Rezitativ als Bestandteil der Landschaft, wie die wenigen hellen Vogelstimmen, die manchmal aus den Bäumen kamen. Es sass sich so angenehm da am Rand des wilden Busches; nichts von den höllischen Plagen, die den brasilischen Urwald verpesten. Hawaii und ganz Polynesien ist ein Land, in dessen Wäldern keine giftigen Schlangen sind und keinerlei bedenkliches Getier. Keine Mücke kam mich stören, keine Fliege noch Ameise; ich konnte mich von meinem Stein in weiche Farne zurücklehnen, so dass ich besser nach unten sah, wo sich die Umrisse der Insel ins Wasser tauchten, genau gefolgt von der Linie des Riffs, ein Stückchen weiter draussen. Mir fiel auf, dass all das aussah, als hätte ich ein Prisma vor den Augen gehabt: mit unglaublichen farbigen Rändern rings um das ganze Bild und um seine einzelnen Linien. In meinem Buch stand, dass die alten Polynesier Hawaii genannt hatten: die Regenbogeninseln. Wirklich, es war ein Land im Regenbogen! Nur über mir, auf der Höhe des Pali, brach das prismatische Spiel fast unirdischer Spektralfarben auf einmal ab und dämpfte sich ab bis zum tiefsten Grau. Eine grosse Wolke lag bäuchlings auf dem Berge. So hatte Maui ...
Ich fuhr zusammen. Ich hatte, mit meinem Legendenbuch in der Hand, gedacht: Maui — und dieser blinde Rhapsode hatte den gleichen Namen gesungen: Maui. War es möglich? Sang dieser kanakische Homer da von Helden und Göttern? War das wirklich und wahrhaftig eine echte alte Mele des sterbenden braunen Volkes von Hawaii?
— — Lasst mich dabei! Also gut, die alten Barden Hawaiis sind längst ausgestorben oder gehen mit einem Zylinder auf dem Kopf in die Sonntagsschule. Aber ich habe, im Tal von Nuuanu, auf der Strasse zum hohen Bergpass Pali, einen Haku Mele von Hawaii eine uralte „Mele“ singen gehört, ein wahres Lied von Helden und Göttern!
Von Maui sang der blinde Mann, von Maui, der Himmel und Erde schied. Wisset, dass der Himmel einst schwer auf Hawaii lag, das Land fast erstickend. Da wachten die Pflanzen auf, alle die Bäume, die Blumen, die Gräser, und strebten empor. Da schoben sie den Himmel ein wenig aufwärts, und bis zum heutigen Tag sind alle Blätter ganz platt von der furchtbaren Last. Die guten, schönen, duftenden Pflanzen drängten den Himmel empor; schon konnten die Menschen auf ihren Bäuchen kriechen, zwischen Himmel und Erde. Da sprach Maui zu einem Weibe: „Gib mir einen Schluck aus deiner Kürbisflasche, so will ich den Himmel von der Erde trennen!“ Da gab das Weib ihm zu trinken, und Maui ging zu seinem Vater Ru, der den Himmel auf seiner Schulter trug. „Wir wollen dem Himmel einen Stoss geben!“ sagte Maui. Da schoben sie die Flächen ihrer Hände unter den schweren Himmel, dann die Spitzen ihrer Finger und stiessen den Himmel, dass er aufwärts schnellte. Nur manchmal wagt er seither, auf die hohen Berge zu fallen; die Menschen der Ebene atmen frei zwischen Erde und Himmel. Sprach Hinavon-dem-Feuer, die Mutter Mauis, sie, die unter dem Wasserfall in der Höhle haust: der Himmel drückt mich nicht mehr, doch zu schnell eilt die Sonne. Wie soll ich all mein Kapatuch trocknen, wenn der Tag so kurz ist?
Denn Hina-von-dem-Feuer war kunstreich im Färben von Basttuch. Da machte Maui eine Schnur von Kokosfasern und machte eine Schlinge daraus und fing die Sonne, dass sie nicht so rasch laufen konnte — —
Das ist die Mele von Maui, die ich singen gehört habe. Sicherlich sang dieser Sänger auch von des Helden herrlichen Fahrten über das ganze Meer, zwischen den tausend und tausend Inseln, von denen alle die braunen Völker des Ozeans wissen, von Hawaii bis nach Neuseeland. Sicherlich sang er vom Tod des Helden, der wie Prometheus den Menschen das Licht und das Feuer gebracht hat und der doch kein unsterblicher Gott war: er ist auf einer fernen, fernen Insel gestorben, im Innern der grossen Hina, die die Hüterin des Lebens ist. Er sprang in ihren ungeheuren Mund, um in dem dunklen Riesenleib die verborgene Quelle des Lebens zu suchen, die dort sein musste, irgendwo bei dem Herzen der grossen Göttin — —
Sicherlich sang dann der blinde Sänger auch, warum Maui den Menschen die Unsterblichkeit nicht erobert hat und warum er selbst gestorben ist, im grauenhaften Dunkel des Götterleibes. Seht, das Vögelchen Patatai begann schrill zu lachen, als es Mauis schön tätowierten Körper zwischen den Lippen der Göttin verschwinden sah. So verriet der kleine Vogel den Helden; und Hina schnappte ihre grossen Zähne zu, die aus hartem Obsidian gemeisselt waren.
Dies ist das Lied von Maui, und ich habe es singen gehört.
Als er das Lied von Maui zu Ende gesungen hatte, hörte der blinde Sänger auf, vielleicht, weil er um den herrlichen Helden trauerte, oder vielleicht, weil die Mittagszeit da war und gar keine Autos mehr vorbeikamen, aus denen Centmünzen hätten fallen können. Aber der blinde Homer von Hawaii ging nicht weg, vielleicht, weil ich noch da war und ihm noch nichts gegeben hatte; er sass da, mit seiner Ukulele auf den Knien, und seine blinden Augen blickten hinunter auf das Land mit den Regenbogenrändern, und vielleicht dachte er darüber nach, ob jemand da war und ihm vielleicht einen ganzen Quarter geben würde, auch vielleicht hatten seine blinden Augen eine Vision: sie sahen die Sonne des 18. Januars 1778 und ein grosses Ding, das auf einmal im Meere sichtbar war, sonderbar, herrlich anzusehen und bedrohlich.
Fragten die Leute von Oahu die Leute von Kauai: „Welch ein Ding ist das, dieses Schiff?“ — Sagten die Leute von Kauai, die Seiner Majestät Schiff „Resolution“, Captain James Cook, zuerst gesichtet hatten: „Dieses Schiff ist wie ein Heiau, wie ein Tempel des Gottes Lono, mit Stufen, die zu den Altären hinaufführen, mit hohen Bäumen, die ihre Äste nach allen Seiten strecken, und vorn ein grosser Stock, wie die scharfe Nase eines Schwertfisches. Die Männer, die auf dem Schiff sind, haben weisse Köpfe mit Ecken, Kleider wie faltige Haut, Löcher in ihren Seiten, aus denen sie die Schätze holen, die in ihrem Leib versteckt sind, spitzige Dinge an ihren Füssen und Feuer in ihrem Mund, so dass Rauch aus ihm kommt wie aus dem Vater der Vulkane, Kilauea.“
Ich sehe meinen blinden Barden noch einmal an, und nun hoffe ich, gegen die Vernunft, dass er, blind geboren, vielleicht um das Hawaii von heute nicht weiss. Er ist ein Sänger, der die Götter preist und die Helden, kein Zweifel, dass er Kamehameha kennt, „den Grossen“, wenn er auch seine Statue nicht gesehen hat, unten, vor dem „Kapitol“, das einst sein Palast war. Dort steht er, mit einem hellenischen Helm auf dem Kopf, denn die Häuptlinge Hawaiis trugen einen Helm wie die griechischen Hopliten — und ist ein sehr grosser König, zweifelt nicht: weil er den neuen weissen Göttern rasch, rasch ein paar alte Schiffskanonen abzukaufen verstanden hat und mit ihnen die anderen Häuptlinge zu unterwerfen, in der Seeschlacht, die heisst: Kapuwahu-ulaula, das ist: Kanone mit dem roten Maul.
Sicherlich weiss mein Barde das und wie die Kanaken einander nun viel rascher totschlagen konnten, nachdem die Weissen zu ihnen gekommen waren. Auch weiss er um die anderen Segnungen: wie mit den hübschen anständigen Kleidern die Schwindsucht kam, mit der neuen Geschlechtsmoral die Syphilis, mit der herrlichen neuen Medizin jede Art von Krankheit und Tod — —
Ich weiss, dass der Blinde das alles kennen muss, die grosse Tragödie der liebreizenden braunen Kindervölker von Polynesien; und ich möchte nicht, dass er die Melancholie dieses Bewusstseins misste, da er doch ein Sänger ist — —
Aber die volle Wahrheit, nein, die volle Wahrheit soll er mir nicht wissen! Möge dieser Blinde, hier hoch oben über der neuen Stadt Honolulu, sich einbilden, dass sein Volk diesen überlegenen weissen Wesen nicht gewachsen war, dass es zu ihren Füssen stirbt und dass sie siegreich sind, ohne Erbarmen, doch gross — —
Nicht die Wahrheit, nicht die volle Wahrheit, ihr Götter von Hawaii, ihr viertausend Götter, ihr vierzigtausend Götter, ihr vierhunderttausend Götter, ihr Reihe von Göttern, Versammlung von Göttern, o Götter des Waldes und der Gebirge, o Götter des Wassers, alle — —
Nicht die volle Wahrheit lasst diesen Blinden wissen, ich schäme mich so.
Nicht, dass diese Stadt, die ich da zu meinen Füssen sehe, gar keine Stadt des weissen Mannes geworden ist, sondern dass sie, mitsamt ihren Warenhäusern und Autos und Strassenbahnen, mit ihren Quick Lunch Counters und dem Kamehameha-Kino, mit ihren Hotels und Telephonen und Ansichtskarten, mit Verkehrspolizei und Prohibition und Radio, mit ihrem Reisegeschäft und Ananasgeschäft und Fremdengeschäft, dass sie schon heute mehr den Gelben gehört als den Weissen. Dass in dem amerikanischen Territorium von Hawaii zwar heute drei Weisse auf einen Kanaken kommen, aber ebenso drei Asiaten auf einen Weissen, dass diese Inseln zwar nicht mehr das Land des braunen Blumenvolkes sind, aber auch nicht das Land der weissen Eindringlinge!
Ihr viertausend Götter, ihr vierhunderttausend Götter Hawaiis, lasst diesem blinden alten Manne den Triumph der Japaner verborgen sein und das Gewimmel der Chinesen, der Koreaner und Filipinos. Sagt ihm nicht, dass die Vorstädte Honolulus aussehen wie jene von Nagasaki!
Lasst ihn nicht ahnen, dass diese schönen alten Sagen, die er liebt, ganz umsonst gestorben sind und dass nicht, wie er glaubt, der weisse Christ das Erbe des kanakischen Heilands Maui erlangt hat: dass heute, so gross ist der Erfolg der Missionare aller christlichen Konfessionen, dass heute die Mehrheit der Inselbewohner den grossen Buddha verehrt, Laotse oder die Ahnen des Kaisers von Japan.
Ihr viertausend Götter, ihr vierhunderttausend Götter, lasst den letzten kanakischen Barden, lasst diesen blinden Haku Mele, den ich von Mauis Taten singen hörte, im Hochtal von Nuuanu, auf dem Wege zum Passe Pali, lasset ihn sterben, bevor er diese Wahrheit errät, dass dieses ganze Jahrhundert des weissen Mannes auf Hawaii, all die Brutalität und all die Heuchelei, all die Philanthropie, und seine Religiosität, und seine Hygiene, und seine Elektromotoren und Ford-Autos, dass all das zwar ein liebenswertes und schönes Volk ausgemordet hat, nicht aber das Reich des weissen Mannes begründet hat oder seinen Kindern eine Zukunft gegeben in diesem Paradies des Stillen Ozeans, wo freilich einer der nächsten grossen Akte des menschlichen Dramas spielen wird, doch nicht vor einem Parkett von siegreichen weissen Göttern.