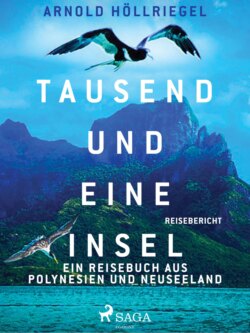Читать книгу Tausend und eine Insel. Ein Reisebuch aus Polynesien und Neuseeland - Arnold Höllriegel - Страница 6
Das Potsdam der Südsee
ОглавлениеIch habe dem Apotheker Brown auf der Victoria-Parade sein altes grüngestrichenes Segelboot mit dem Hilfsmotor abgemietet — es ist, stellt sich heraus, der schäbigste alte Kahn auf Fidschi, dafür aber steuert ihn der Apotheker Brown selbst, und der ist immer besoffen. Da wir unsere Fracht geladen haben und von Suva fortwollen, kommt der ärgste tropische Wasserguss, den ich bisher erlebt habe; es ist nötig, das Ende des Unwetters abzuwarten, und das kostet mich den ganzen Tag: denn da wir endlich ausfahren können, am Inselstrand und den Palmen und den roten Wellblechdächern der Kolonialstadt vorbei, hinaus zur schaumumspritzten Linie des Korallenriffs und dann, immer innerhalb der Lagune, bis zur Mündung des Rewaflusses, der, erstaunlich breit und geruhig, von den umnebelten Zackenbergen kommt, aus dem Innern der Insel Viti Levu — da wir, sage ich, aus der Lagune in den Fluss gefahren sind, durch eine Mündung des grossen Deltas, gewillt, eine andere als Kanal zu gebrauchen und über sie hinweg wieder das freie Meer zu gewinnen — da wir recht hübsch inmitten der Mangrovesümpfe stekken, ist, kurz und gut, die Ebbe gekommen, und wir sitzen auf einer Schlammbank fest, zwischen phantastischen Ufern, die nicht aus Erde sind, sondern ganz aus wirrem Stammgestrüpp, Luftwurzelwerk, tiefgrünem Laub und Moskitos. Man kann nichts tun, als dasitzen, einen herrlichen grauen Kranich bewundern und die Flut erhoffen.
Der Apotheker Brown, ein alter, ganz rot gebeizter Neuseeländer, tröstet sich mit der Whiskyflasche. Ich denke, er ist überhaupt nur mitgefahren, weil ihn seine Frau zu Hause nicht allen Whisky trinken lässt, den er trinken möchte. Der Maschinist liegt auf der Bank beim Motor und schläft; er ist ein nussbrauner Wilder von Ellis Island und vielleicht ein geborener Kannibale. Der Matrose, ein zwölfjähriger Fidschijunge, schwarz und ölig, mit einer enormen weichen Haartolle und einem ganz kleinen Lendenschurz auf all dem üppig muskulösen, dunkelhäutigen Fleisch, hockt auf seinen beiden Schinken und kaut glückselig an einem grossen Stück Zuckerrohr. Ich selbst bin auf allen vieren in die niedrige Kabine gekrochen und krame dort, in einer nach Benzin und Alkohol stinkenden, schweisstreibenden Schwüle, zwischen Schachteln und Kisten herum: ich inspiziere die Fracht meines Schiffes:
64 Yards Kalikostoff, meistens rosa und rot, mit breiten Streifen, aus dem Geschäft von Naurijee Singh, All Nations Street, Suva.
Eingeborenentabak, in einer riesigen gerollten Wurst, etwa zehn Meter davon.
Zuckerzeug, indisch und klebrig.
Alle Mundharmonikas, die in Suva vorhanden gewesen sind. Deutsche Mundharmonikas, Marke: „Fröhliches Terzett“. Auf der Schachtel die Schutzmarke: drei heulende Kater.
Dies ist die Fracht meines Schiffes. Und Whisky. Ich schäme mich, es zu gestehen, aber ich habe auch einen Korb Whisky an Bord für die Häuptlinge. Die sachkundigen Freunde in Suva, die mich beraten hatten, waren der Meinung gewesen, es ginge nicht ohne Whisky.
Nachdem ich die ganze Fracht inspiziert habe, hole ich behutsam einen unschätzbaren Wertgegenstand aus einer Pappschachtel, ein Geschenk für eine Königin: einen kleinen mechanischen Fächer aus Wien, Kärntnerstrasse. Man drückt auf einen Knopf, und die Propellerflügel des Fächers beginnen zu rotieren — —
Ich steige wieder auf Deck, mit dem kleinen Fächer in der Hand, und lege mich auf die Bank und lasse den Fächer schnurren, und ich sauge gierig die Luft ein, die er mir zuweht. So liege ich geduldig und sehe dem Flug phantastischer Vögel zu, die über dem Wasser treiben.
Wir müssen warten, bis die Flut uns flottmacht. Was hat unterdessen der Apotheker mit dem Motor angefangen? Der Motor versagt in dem Augenblick, da die Flut wiederkommt, und es gibt keinen Wind zum Segeln. Erst spät am Nachmittag gelingt es uns, das Flussdelta zu verlassen und seewärts ins Freie zu kommen, in eine traumhaft schöne Bai mit silbergrauen Inselsilhouetten rund um den Horizont. Ein kleines, rundes Eiland, ganz nahe an der Küste der grossen Hauptinsel Viti Levu, wird deutlicher: niedere, vulkanische Klippen und Hügel, wunderbar umgrünt. Wie ich auf diese Berge und Wälder blicke, auf dieses unwirkliche Bild aus Grau und Blau und Giftgrün, empfinde ich, wie an allen diesen Tagen, dass ich jetzt also da bin: in jenen blauen Bergen, die ich einst in meiner Jugend am Horizont gesehen habe und die dann, wenn man hinkam, wirkliche gewöhnliche Berge waren — — Diese bleiben blau umhaucht, auch wenn man sie betritt. Dieser Wald bleibt, auch wenn man ihn betritt, der Wald des Paradieses; das ist nicht der angsterregende Urwald Brasiliens, der von mörderischem Leben wimmelnde asiatische Dschungel, sondern nur ein frohes und freundliches Durcheinander von lieblichen Blumen, von heiter schönen Pflanzen, von köstlichen wilden Früchten. Dieser Wald, der kein einziges schädliches Tier verbirgt, nicht einmal eine Fiebermücke, sieht wie ein ungeheuerer Blumenkorb aus mit Girlanden, Buketten, über den Rand hängenden Farnen. Es gibt Zehntausende dieser Farne, glaube ich, winzig, winzig kleine und andere, die wie Palmbäume in die freie Luft wachsen über das Gestrüpp hinaus. Und das alles, Kluft und Berg, Wildbach, Farne, Blütenbusch, all dieses Grüne, Rote, Silberne hat über sich diesen bläulichen Schatten der Blauen Berge, die echte Farbe der Sehnsucht, des Unerreichbaren — —
Dieser Wald wächst und hängt und taumelt bis in die silberne Bai, durch die unser Boot nun segelt, und die kleine Insel, auf die wir zuhalten, ist auch ganz überfüllt von dieser bläulich bereiften Vegetation. Ein Kanu der Eingeborenen kommt uns entgegen, ein grosses Fischerkanu mit einem Ausleger und dreieckigen Segeln aus Bastmatten. Prachtvolle Menschen, nackt bis zum Lendenschurz, winken lachend.
Jetzt sehen wir unter den hohen Bäumen ein Dorf. Das also ist Mbau, die heilige, die königliche Insel, dies ist das Dorf, in dem die grossen Häuptlinge wohnen, die letzten Enkel der Könige und der Götter — —
Wir legen an einer kleinen wackeligen Landungsbrücke an. Auf ihr erwartet uns ein würdevoller alter Herr, der um seine dunkelbraunen Beine ein eng gebundenes Sulu-Tuch trägt und ein Ruderleibchen um den Oberkörper. Das ist der Tui Savura, ein sehr grosser Fürst unter den vielen Häuptlingen dieser kleinen Insel Mbau.
Wir geben einander die Hand. „Komm an Bord, Tui, have a drink!“
Wir trinken Whisky und Soda in der kleinen Kabine. Der alte Häuptling mit dem eisengrauen Haar über der Runzelstirne sitzt ernst und wohlerzogen da, wie nur irgendein weisser Gentleman. Da wir getrunken haben, nimmt er meine Hand und sagt in einem stockenden Englisch:
„Komm. Deine Sachen, meine Leute bringen sie Ufer, nach und nach. Komm, sieh Dorf.“
Ich erfahre, dass Tui Savura in diesem Augenblick der ranghöchste von den Häuptlingen ist, die auf Mbau weilen; Ratu Pope, der Enkel des letzten Königs von Fidschi, ist auf eine andere Insel gesegelt, wo er bei der Einsetzung eines neuen Häuptlings anwesend sein muss.
Ich habe viel von diesem Häuptling gehört, und es tut mir leid, dass ich ihn nicht sehen werde. Er ist, wie ich weiss, fünfunddreissig Jahre alt, ein schöner tiefdunkler Riese, und er hat mit vierzig Frauen genau hundert Kinder gezeugt. Er ist gebildet wie ein weisser Gentleman, da man ihn auf dem College zu Wanganui in Neuseeland erzogen hat. Er ist ein berühmter Kricketer und Fussballspieler. Er besitzt die unsäglichen Schätze der weissen Menschen, Maschinen, die sprechen, und Maschinen, die fahren, aber auch die Besitztümer, die den Leuten von Fidschi teuer sind, jene unvergleichlich wertvollen Walfischzähne, um deren geringsten in früheren Zeiten ein Mann hätte getötet werden können und nachher gefressen — —
Obwohl Ratu Pope nicht in Mbau ist, muss ich gleich in das Haus des Ratu kommen, das Haus muss jeder Fremde sehen, der auf die Insel kommt. Es ist auch wirklich ein königliches Haus, wenn es auch nur aus porösem Geflecht erbaut ist, mit einem steilen, strohgedeckten Dach, aus dem die beiden leicht gekrümmten Enden des Firstes ins Freie ragen, eines grossen Kokosstammes, der die Form eines abgenagten Knochens hat. Aussen sieht das Haus ein bisschen wild und ruppig aus, aber innen ist es so sauber wie das Haus einer Holländerin, so luftig und kühl wie das Grand Pacific Hotel in Suva, so vornehm wie irgendeine Villa im Faubourg Saint Germain. Der Fussboden, der ein wenig erhöht über Pfählen liegt und daher auch von unten kühlende Luft durchlassen kann, ist mit prachtvollen elastischen Matten belegt, die, schwarz und weiss, aus feinem Stroh geflochten sind, mit bunten Wollfransen an den Rändern. Die ebenfalls geflochtenen und luftdurchlässigen Wände sind an riesigen Pfeilern aus hartem Holz befestigt, die man mit schwarzen, weissen und roten Kokosschnüren umwickelt hat; mit den gleichen vornehm diskreten Mustern sind die ungeheueren Querbalken unter dem Dach geschmückt. Die Wände sind mit Tapa verhangen, dem seidig glänzenden und herrlich gefärbten Bastzeug, das die Frauen Polynesiens aus der Rinde des Papiermaulbeerbaums machen. Dieses Haus, weil es das Haus des Königsenkels Pope ist, hat, oh, Triumph, oh, raffinierter Luxus, in der Mitte eine niedere Zwischenwand, hinter der ein Schlafzimmer abgeteilt ist, mit einem wirklichen Bett; auch in dem Hauptraum gibt es ein paar europäische Möbel: Korbsessel, einen blank polierten Tisch, eine Bücherstellage, auf der ich ein Buch von Wells liegen sehe. Eine Petroleumlampe hängt vom Deckbalken; eine Photographie hängt an der Wand: Ratu Pope und die Kricketmannschaft von Mbau, vor einem Wettspiel aufgenommen.
Wie mich der alte Tui in dieses schöne Haus führt, empfinde ich sogleich jene besondere Atmosphäre königlicher Paläste und wundere mich nicht, dass ich sofort einer Prinzessin vorgestellt werde. Es ist die Kusine Ratu Popes, wie er ein Abkömmling des letzten unabhängigen Königs von Fidschi, Thakombau. Der alte Kannibale hat im Jahre 1884 ungemein freiwillig seinem Thron entsagt, zugunsten der Königin von England und gegen Zusicherung einer Pension von 2000 Pfund und auch einer Dampfjacht. Der Titel des alten Thakombau, „Tui Viti“, König von Fidschi, hat sich auf seine Nachkommen nicht vererbt; eine Königstochter hat in der Sprache von Fidschi nie irgendeinen Titel gehabt, dennoch nennt jedermann diese Frau, die mich jetzt im Haus ihres Vetters empfängt, eine Prinzessin. Die Prinzessin Andi Thakombau trägt einen roten Kittel, der lose von mageren Schultern hängt. Sie hat sich von der kleinen Nähmaschine erhoben, neben der sie hockte. Jetzt streckt sie mir eine schöne, beringte Hand entgegen und lächelt. Ihr alterndes Gesicht zeigt nicht die melanesischen Negerzüge der Leute von Fidschi; ihre Mutter war eine Fürstentochter aus Tonga, eine von jenen polynesischen Frauen, die den schönsten Europäerinnen aus dem Süden gleichen.
Ich habe nie ein weibliches Wesen gesehen, das mehr einer königlichen Prinzessin geglichen hätte. Unwillkürlich verbeuge ich mich sehr tief. Auch der alte Tui begegnet ihr mit Respekt, obwohl sie doch nur ein Weib ist und Weiber auf Fidschi nicht zählen. Aber um das Haupt der Prinzessin Andi schwebt die „Mana“, das ungeheuere Prestige des alten und heiligen Häuptlingshauses, aus dem sie stammt, dieser Familie der Inselkönige von Mbau, die seit dem Urbeginn der Zeiten da war. Auch ist die Prinzessin Andi reich. Sie hat das beste Kokosnussland, mehr als 350 Acres Pflanzungen. Der Mann, den sie geheiratet hätte, wäre auf weichen Matten dick und fett geworden. Aber sie hat niemals geheiratet.
„Seien Sie willkommen,“ sagt sie zu mir. „Wohnen Sie in unserem Gästehaus? Wir wollen Ihnen ein Fest geben. Es ist spät. Wären Sie früher gekommen, dann hätten wir viele Blumenkränze gewunden — —“
Ich gebe ihr den kleinen automatischen Fächer, und eine Minute lang spielt sie damit, wie ein erfreutes Kind. Dann gibt sie das Ding einer Dienerin zu halten, die vor ihr niederhockt, um es zu empfangen — —
Das Gästehaus, in dem ich schlafen soll, ist ein ganz gewaltiges Gebäude, gross und hoch und leer wie eine Ballonhalle. Es liegt auf einem künstlich erhöhten Hügel über dem grossen und sauberen Dorfplatz, der mit grünem Rasen bedeckt ist, wie der Kirchenplatz eines englischen Dorfes, und der ebenso zum Krikketspielen verwendet wird. Dem Gästehaus gegenüber steht die Kirche, scheusslich anzusehen, ganz Holz, Ecken und Wellblech. Irgendwo auf einem Hügel ist das Haus des wesleyanischen Missionars. Er ist der einzige Weisse, der auf Mbau wohnen darf, denn wenn auch die Europäer und die asiatischen Plantagenkulis auf allen anderen Inseln von Fidschi noch so zahlreich werden, die kleine königliche Insel Mbau hat man den alten Häuptlingsfamilien vorbehalten und zur Pflege der heimischen Tradition bestimmt. Mbau ist das Versailles, nein, das Potsdam von Fidschi. In diesen schönen luftigen Häusern in den kleinen Gärten dürfen nur Häuptlinge wohnen und ihre Frauen und Diener. Keine Kokosnuss darf auf dieser Insel wachsen, keine Brotfrucht. Was die grossen Herren brauchen, bringt man von den anderen Inseln: hier wird nicht gesät noch geerntet.
Es ist die Stunde des Sonnenunterganges, und das Meer um Mbau wird ganz rot und golden. „Rührei mit Paprika“, sagt der Apotheker Brown missbilligend und geht ins Innere des Gästehauses einen Whisky trinken, weil diese Stunde ohne Whisky sehr ungesund ist.
Ich sitze auf den monumentalen Stufen von schwarzem Basalt, die zu dem Gästehaus emporführen, und verbringe diese Stunde des Sonnenunterganges damit, dass ich den nackten schwarzen und kraushaarigen Kindern der Insel beibringe, wie man auf einer Mundharmonika den Radetzkymarsch bläst. Ich blase ihnen gerade den Radetzkymarsch vor, weil ich ihn mit grosser Bestimmtheit von den vielen anderen Melodien unterscheiden kann, die mein so unmusikalisches Gedächtnis nicht so gut kennt, aber auch, weil in diese feudale Cidevant-Atmosphäre der Insel Mbau kein anderes Lied gut passt, das ich blasen könnte.
Diese vielen Mundharmonikas, die ich mitgebracht habe, machen mich zum geliebtesten Onkel aller kleinen Negerlein auf der Häuptlingsinsel Mbau. Zwanzig, dreissig Stück kauern auf den Stufen, die zu dem Gästehaus führen, oder kriechen auf allen vieren über die Böschung des kleinen Hügels, der das hohe Haus über den schönen sauberen Grasplatz erhebt. Sie halten die Maultrommeln an die Zähne, als wollten sie sie abnagen; ich kann nicht umhin, an die Grossväter dieser munteren Knaben zu denken, die Menschenknochen benagten.
Ich habe leider, das stellt sich heraus, nicht genug Mundharmonikas für alle nackten kleinen Fidschibuben von Mbau mitgebracht. Einige von den Zurückgesetzten kann ich mit Schokolade trösten, aber ein achtjähriger Häuptlingssohn bleibt unversöhnlich und schneidet wilde Gesichter und ruft mir auf Fidschi ein Wort des Grolls zu, das ich nicht verstehe. Mehrere von den älteren Knaben haben in der Missionsschule Englisch gelernt, und ich frage einen von ihnen, was ihr Kamerad mir da zuschreit, mir, der ich ihm keine Mundharmonika mitgebracht habe.
Der Gefragte grinst:
„Er sagt, Sir: Ich fresse deine Augen, Sir!“
Wir verständigen uns zur Not sehr gut auf Englisch, aber es ist viel lustiger, wenn ich mein Notizbuch ziehe und in der Fidschisprache zu reden versuche. In dem Notizbuch steht: „jo“ heisst „ja“; „nein“ heisst „sengai“; „danke schön“ heisst „vinaka.“ Und „tou veitotaki“ heisst „wir wollen gute Freunde sein“.
Ich sage immerzu: „tou veitotaki“ und blase dann den Radetzkymarsch, annähernd. Eine Fidschimama, noch schlank wie ein Mädchen, mit einer Hybiscusblüte in dem halblangen gewellten Haar, das wie eine Bürste vom Kopf wegsteht, kommt mit einem guten Lächeln und setzt das nackte Baby, das sie auf ihrem Rükken getragen hat, auf meinen Schoss. Da mich die warme und samtene Haut des Kindes streift, geht durch mich ein merkwürdiges elektrisches Rieseln, ganz anders als jenes Gefühl, das die Berührung eines weissen Säuglings gibt.
Jetzt ist es völlig Nacht, auf einmal. Die Moskitos werden im Freien zu lästig. Ich gehe in das Innere des Hauses und esse etwas, aus meinen eigenen Vorräten, denn ich bin unangemeldet gekommen und zu spät, als dass man noch ein Schwein hätte schlachten und mit Brotfrucht und Taroknollen in der Kochgrube backen können.
Die Nacht ist schwül, aber die prachtvolle hohe Halle des Gästehauses hat poröse Wände, und vier grosse Türen, in jeder Himmelsrichtung offen, lassen die köstliche Brise durch das Gebäude streichen. Das steile Dach ruht auf tausendfach umwundenen und geschmückten Pfeilern; die Wände sind mit Matten bekleidet, von einem Geflecht wie Panamahüte, mit feinen schwarzen Mäandern und geometrischen Ornamenten. In diesem grossen, grossen Saal steht nur ein langer Tisch, auf den ich meine Geschenke gehäuft habe, die grellbunten Stoffe, Tabak und Flaschen billigen Parfüms. Ich sitze alla turca auf den Matten, an meine Reisetasche angelehnt. Draussen in der Dunkelheit taucht manchmal ein Licht auf; ein Eingeborener bringt eine Windlampe und stellt sie vor mich hin auf die Matte. Dann kommen sie, truppweise, die Knaben und die jungen Mädchen von Mbau. Der alte Häuptling, der Tui, befehligt sie wie ein Schulmeister. Jetzt hocken sie alle nieder, auf einer Seite die Knaben, in ordentlichen Reihen, vier Bub tief, auf der anderen die Mädchen, die ihre losen, bunten Kattunkittel tragen und Blumenkränze. Einige von ihnen, aber nur wenige, haben diese absonderlichen semmelblonden oder fuchsroten Haare, die sie hervorbringen, indem sie ihren Kopf mit Lehm einschmieren oder mit Kalklauge bearbeiten.
Im Hintergrund sitzen die Männer von Mbau, nicht viele, denn Ratu Pope hat ein stattliches Gefolge mit sich genommen. Es sind nur einige Jünglinge zurückgeblieben, herrlich gebaute Athleten, von deren schwarzen geölten Schenkeln das Lampenlicht reflektiert wird wie von lackierten Schaftstiefeln. Ihre Haare, die ganz weich sind und wunderbar gepflegt, stehen gewaltig über den schönen breiten Stirnen zu Berge. Alle anwesenden Kanaken tragen den Sulu genannten Lendenschurz, obgleich Ratu Bola mir gleich versichert hat, dass er auch Hosen besitzt, „ganz genau ebenso wie weisser Mann, wett’ dein Leben“. Ratu Bola, ein rüstiger Herr von Sechzig, ist ausser dem alten Tui Savura der einzige Häuptling, der augenblicklich auf Mbau ist, die anderen haben alle die Heerfahrt ihres geborenen Lehensherren mitgemacht, Ratu Popes.
Ratu Bola spricht ein geläufiges, aber persönliches Englisch, das er am Strand von Suva aufgelesen hat, mit drolligen amerikanischen Slang-Ausdrücken. Er ist ein stattlicher Mann und ein Aristokrat, aber ich kann nicht verhehlen, dass er zu oft ein Glas Whisky von mir fordert. Ich habe die Absicht, den Rest des Whiskys als Geschenk zu hinterlassen, nicht aber, diese Kannibalenenkel sehr betrunken zu machen, solange ich da bin. Nur der äusserste Takt hilft aus dieser Klemme. Aber der Ratu ist nicht unverschämt, nur gierig wie ein Kind.
Immerhin muss ich das Gesprächsthema wechseln. Ach, reden wir doch nicht fortwährend von Whisky und solchen Sachen. „Werden diese jungen Leute singen?“ frage ich.
„Bet y’r life,“ sagt der Ratu, „wett’ dein Leben, sie werden singen wie ein Schuss! Grosse ‚Meke‘, für dich. Trinkt man viel Whisky in deinem Land?“
Die „Meke“, mit der man heute abend den Gast der Insel Mbau unterhält, ist nicht sehr gross und nicht sehr zeremoniell, vielleicht wegen der allgemeinen Unwürdigkeit des Gastes, der kaum ein sehr grosser Häuptling ist, vielleicht, weil er so spät kam und grosse Vorbereitungen nicht möglich waren, vielleicht auch, weil man nicht vorher gewusst hat, wie viele Geschenke er mitbrachte. Vor einer wirklich grossen Meke legen Männer und Frauen die festlichen Gewänder aus Tapastoff an oder die Tanzröcke aus breiten und langen Blättern, die vom Gürtel bis zum Knie herabhängen, giftgrün oder kirschrot gefärbt. Heute haben sie auch nicht die kostbaren Halsbänder aus Walfischzähnen angelegt, ja, sie haben ihre Gesichter kaum ordentlich mit Russ gepudert, so wenig grossartig geht es heute zu. Nur gesungen wird und ein wenig dramatischer Tanz geübt. Zwei Chöre, einer von Männern und Knaben, einer von Frauen, singen, im Halbdunkel des ungeheueren Saales hockend, diese Lieder, die ich nicht verstehe, die mir aber ganz wunderbar scheinen: nichts Negerisches oder Wildes ist in diesem süssesten, holdesten Zusammenklingen der vielstimmigen Vokalmusik. Von den beiden Häuptlingen scheint der alte Tui als eine Art Kapellmeister zu wirken, er dirigiert mit energischen Winken oder kurzen und scharfen Befehlen. Ratu Bola sitzt neben mir auf der Matte und dolmetscht mir, rücksichtslos laut, was zu dolmetschen er gut findet. Das erste Lied, sagt er, ist ein patriotisches Lied: es ist herrlich, singen sie, in Fidschi zu leben, die Leute von Fidschi sind sehr gross und stark — —
Ratu Bola hält in seiner Übersetzung auf einmal inne, mit einem schelmischen Ausdruck in seinem alten Lebemannsgesicht. Sagt dieses Lied etwa, wie stark die Leute von Fidschi sind? So stark vielleicht, dass sie die Augen aller ihrer Feinde essen können? Ich weiss, sie tun es nicht mehr; aber ich weiss auch, in was für einem Haus ich hier sitze. Der greise Tui Savura muss noch dabei gewesen sein, als hier, auf dieser gleichen Stelle, der Tempel des dreiköpfigen Gottes von Mbau stand, ein Tempel, in dem man das „Lange Schwein“ geschlachtet hat, das zweibeinige, dem Gotte zu Ehren — —
Aber jetzt singen die Leute von Mbau ein anderes Lied, eines, das ein lokaler Barde heute abend eigens gedichtet hat, um mich zu begrüssen, eine epische Ballade, deren Held ich bin, der Fremde mit der Brille, der in dem Boot des Apothekers Brown aus Suva gekommen ist. Er ist in seinem Land ein Häuptling oder vielleicht ein Missionar, und er hat Geschenke mitgebracht, viele, viele — —
Dann kommt ein ganz anderes Lied, ein Lied aus dem grossen Krieg, der auf die Männer von Fidschi so einen Eindruck gemacht hat. Die Engländer sind sehr tapfer, tapfer, und den Kaiser eines Stammes, der: „die Deutschen“ heisst, haben sie gefangengenommen — —
Dann kommt wieder ein sanftes und liebliches Lied der Frauen, nicht ein Lied von Fidschi, sondern das schöne samoanische Lied, das man auf allen Inseln der Südsee kennt: „Tofa mai feleni.“ „Lebe wohl, mein Freund.“ Es ist ein sentimentales Lied vom Abschiednehmen, und es hat einen englischen Refrain:
„Oh, I never will forget you — —“
Sie singen das immer wieder, immer wieder, und dann andere Lieder. Lieder von Fidschi und sanftere von Samoa, von Tonga.
Dazwischen zeigen einmal die kleinen dunkeläugigen Buben, was sie in der Missionsschule gelernt haben. „Tipperary!“ jubeln sie, den scharfen Takt mit klatschenden Händen markierend. „Es ist ein langer, langer Weg nach Tipperary — —“
Dann wieder ziehen sich alle die Chöre in den Hintergrund zurück; ich sehe sie nur rhythmisch sich biegen, während sie, auf ihren Schenkeln sitzend, die Melodie des Tanzes patschen. Vorn aber, im Lichtkegel der Windlampe, haben drei wunderschöne junonische Mädchen sich niedergelassen, ganz bekränzt mit schwer duftenden Blüten. Sie tanzen, sitzend, einen Tanz, der das Lied des Chorus illustriert. Sie bewegen nur, in massvoll strenger Disziplin, ein wenig den Oberleib und die nackten Zehen; die eigentliche mimische Sprache des Tanzes reden ihre schönen bronzenen Arme und ihre adeligen Hände, deren Bewegung die Essenz des Liedes verkörpert und die einfache Handlung der Ballade dem fremden, fremden Gast fast völlig verständlich macht.
Die ganze Nacht, die ganze Nacht dauern die Lieder. Die Sänger sitzen im Hintergrund der Halle; in der Mitte hockt ein würdevoller Funktionär vor der grossen kuriosen Holzschale, in der man unter vielen Zeremonien Kawa gebraut hat, den Rauschtrank Polynesiens, der keinen Rausch gibt, nur eine unbestimmte lässige Müdigkeit der Beine. Die Yangona-Wurzel, aus der man diese trübe laue Jauche macht, wird auf Mbau nicht mehr von den Frauen vorgekaut, wenigstens nicht vor den Gästen. Sie machen das Mehl der zerriebenen Wurzel mit lauem Wasser an und seihen es durch ein Tuch. Dann taucht ein Mann in das hölzerne Becken eine halbe Kokosschale, in deren Innerem längst eine besondere Patina entstanden ist, und bringt sie dem Ratu.
Ratu Bola hat eben versucht, mir nicht ohne Anzüglichkeit zu erklären, dass Kawa sehr gut ist, aber Whisky auch. Ich verstehe nicht und höre hingerissen dem leisen Gesang zu. Der Ratu winkt resigniert dem Mann mit der Kawa, der bringt die Kokosnussschale und hockt demütig vor ihm nieder, denn niemand steht vor einem Häuptling. Nun muss auch ich kosten. Ich tue es, das gebührende Zeremoniell sorgsam beachtend. Erst ein Schluck von dem lauwarmen Gesöff, das zunächst wie Chloroform mit Spucke schmeckt, dann aber doch den Durst auf eine ganz geheimnisvolle Weise auszulöschen scheint und im Mund eine eigentümliche herbe Frische hinterlässt. Man muss, bevor man die Schale nimmt und trinkt, dreimal in die Hände klatschen und rufen: „Bola!“ Bola heisst „Prosit“, und den Ratu Bola könnte man so übersetzen: Prinz Prosit.
Nachdem man getrunken hat, fängt man ein wenig zu grunzen an, und man massiert sich mit beiden Händen die Speiseröhre, durch die der Nektar herabrieselt. Oh, heuchelt man mimisch, das hat aber geschmeckt!
„Whisky ist auch sehr gut!“ bemerkt der Prinz Prosit, ganz beiläufig, nachdem wir die Kawa getrunken haben.
Er kriegt ja endlich doch einen Whisky, einen kleinen nur, und wird auf einmal gesprächig. Ich liege auf dem Bauch, das Kissen unter mir, und schreibe manchmal in mein Notizbuch. Der Mann ist ein Konversationslexikon.
„Wett’ dein Leben,“ sagt er, „Fidschi ist gutes Land. Wir hier in Mbau nur Häuptlinge, Häuptlinge und Frauen und Kinder und Diener. Kinder? Ich ob Kinder habe? Wett’ dein Leben! Vierzig Kinder! Missionär sagt: ‚Viele Frauen, nicht gut.‘ Ich heirate eine Frau, andere Frau in andere Haus, viele. Das Fidschisitte.“
Er runzelt sorgenvoll die Stirn. „Missionär nicht gut,“ sagt er. „Nimm an etwas Fidschisitte, er sagt: ‚Nicht gut, gehst Hölle.‘ Ich rechne, ich bald gehe anderen Missionär. Romkatholisch gutes Stück viel mehr besser, wett’ dein Leben!“
Er spricht so, in dem Strandenglisch der aussterbenden alten Generation, und man kann ihn leicht ein wenig komisch finden, wenn man zu stumpf ist, um zu verstehen, wie vornehm der Mann im Grunde ist, wie sehr ein wirklicher Aristokrat, einer der letzten vielleicht, die diese Erde trägt. Vielleicht ist diese Insel Mbau, das Schutzgebiet der grossen Häuptlingsfamilien von Fidschi, heute die letzte sichere Zufluchtsstätte adeligen Wesens.
Halb aufgerichtet auf seinem Trinklager aus köstlichen Matten, zeigt der alte Häuptling auf diese festliche Halle, auf die sklavisch hockenden Chöre der schönen Mädchen, der starken Jünglinge, auf dieses Halbdunkel, aus dem die leisen Gesänge kommen, und er erklärt mir hochmütig, dass diese schöne Halle keineswegs nur ein Schlafraum für vazierende Schriftsteller ist.
„Dieses Haus unser Haus der Lords,“ sagt Ratu Bola. Er meint, dass die Halle an der Stätte des uralten Tempels eigentlich der Ratssaal der Edlen von Fidschi ist. Einmal im Jahr kommt der britische Gouverneur von Fidschi nach Mbau; man begrüsst ihn mit einer grossen festlichen Meke, mit Liedern und Kriegstänzen auf dem grünen Platz vor dem Hause; dann aber sitzt der Gouverneur hier in der grossen Bure mitten unter den Häuptlingen, und sie sprechen zu ihm, sagen ihm, was sie wünschen.
„Und was uns nicht gefällt,“ sagt Ratu Bola und wirft seinen grauen Kopf trotzig zurück.
O Meisterschaft, denke ich, der englischen Politik! Sie haben den Eingeborenen in Mbau eine Art Scheinkönigreich gelassen, eine Republik von grossen Häuptlingen, in die kein Polizist den Fuss setzt; da sitzen die vierzehn stolzen Enkel der Inselfürsten, hübsch beisammen — —
Unterdessen erschliessen auf den grossen Hauptinseln elende indische Kulis die weiten Plantagen.
In Mbau aber ist alles, wie es war, und bleibt alles, wie es war, höchstens, dass keine Menschen mehr gefressen werden. Es ist wahr, der Missionar lebt auf der Insel, und er legt Wert darauf, jeden Häuptling mit einer seiner Frauen feierlich zu verheiraten, in der kleinen Kirche, vor der ein gehöhlter Baumstamm liegt, die Trommel, die einst zu Kannibalenfesten rief und jetzt zum christlichen Gebet ruft. Man heiratet eine Frau und hat ein paar Dutzend andere in netten kleinen Hütten. Nur diese Familien der Häuptlinge wohnen auf der Insel Mbau; ein Gemeiner von geringem Blut betritt diesen heiligen Boden nur, wenn ihn der Häuptling gerufen hat. Was der Häuptling zum Leben braucht, lässt er sich einfach kommen. „Geh auf Festland,“ befiehlt er dem ehrfürchtig hockenden Diener, „bring’ Fisch! Bring’ Taro! Bring’ Feuerholz!“ Der gemeine Mann geht und bringt.
„Sieh,“ sagt der Ratu und streckt mir seine schlanken braunen Hände mit den hellen Nägeln entgegen. „Sieh, diese Hände — — wett’ dein Leben, ganzes Leben nicht einmal verdammt gearbeitet!“
„Auch nicht schreiben wie weisser Mann,“ sagt er mit einem verächtlichen Blick auf meine eigenen Hände. Er hat mich offenbar im Verdacht, dass ich gar kein so grosser Kazike bin.
Er spricht und spricht, laut und rücksichtslos, in den lieben Gesang der Knaben und Mädchen hinein, der nicht aufhört. Er entrollt mir das Bild einer feudalen Gesellschaft, in der der Fürst, der edel Geborene, sich von seiner Matte niemals erhebt, es sei denn zu Spiel und Sport und Krieg. Die Schlachtkeule zu schwingen, und wenn sie nicht mehr geschwungen werden darf, dann den Kricketschläger, ist eines Ratu würdig, oder allenfalls das Segel des Auslegerboots zu entfalten. Die Niederen, die Koigu, mögen auf die Bäume klettern, um Kokosnüsse zum Trinken! Ihnen geziemt es, vor dem Häuptling zu hocken und ihm den geflochtenen Korb mit der besten Speise zu reichen.
„Fidschisitte,“ sagt der Ratu mit grossem Nachdruck. Er ist ein Konservativer, das ist mal gewiss.
Ich frage, ob an diesem Glanz, dieser Herrlichkeit auch hochgeborene Frauen den gleichen Anteil haben. Aber der Ratu lacht nur zynisch.
„Nix Ladies,“ sagt er. „Ladies bei uns niemand schert sich. Wenn mein Grossvater sterben, zehn, zwanzig Frauen hängen sich auf. Nix wert, Frau!“
Dieser Grossvater, von dem Ratu Bola immer wieder mit grosser Pietät zu reden anhebt, muss überhaupt eine interessante und liebenswerte Persönlichkeit gewesen sein. Er ass ganz weiche zarte Säuglinge viel lieber als ältere und vom Leben vergiftete Menschen. Der Vater Ratu Bolas hat als ein Kind manchmal einen Knochen zum Abnagen bekommen, aber später hat er die Diät gewechselt, und Bola selbst hat natürlich niemals Menschenfleisch zu kosten bekommen.
Die Ansichten dieses gediegenen alten Torys über die soziale Frage sind einfach, ehrlich und gar nicht so exotisch.
„Wett’ dein Leben,“ sagt er, „Fidschisitte gut für Häuptling. Nimm an, Fidschiboy, nicht Häuptling, auch gut. Er macht Arbeit, ich gebe viel Taro. Er nicht macht Arbeit, er Hunger...“
Wo, beim dreiköpfigen Gott von Mbau, habe ich gutgenährte Häuptlinge schon so reden gehört?
Spät in der Nacht, sehr spät. Der ältere von den Häuptlingen hat meine Geschenke verteilt, mit der ruhigen Würde eines grossen Patriarchen. Er hat von den Sängern, den Tänzerinnen diejenigen zu dem grossen Tisch gerufen, denen er seine eigene Gunst beweisen wollte, und demütig hockend, mit niedergeschlagenen Augen, haben sie in Empfang genommen, was er von meinen Gaben ihnen zuwenden wollte, Stoff auf ein Kleid oder einen halben Meter Tabakwurst oder eine Flasche von dem Eau de Cologne des Apothekers Brown, der schon seit so vielen Stunden in einer Ecke des Raums seinen Rausch ausschnarcht. Ich habe beobachtet, dass eine von den drei schönen Tänzerinnen lieber ein Stück von dem roten Stoff haben wollte als von dem blauen, und ich habe ihr das Stück selbst abgeschnitten; zu spät bemerkte ich, dass ich die Etikette gröblich verletzt habe, die Verfassung der Insel Mbau, die will, dass alle Gunst und Gnade und jegliches Gut des Lebens aus der Hand des Edelings komme, des Herren und Häuptlings. Nun sind die Sänger fort. Die beiden Häuptlinge haben, fern von mir in einer Ecke, noch lange halblaut miteinander gesprochen; jetzt sind sie fort. Ich habe den Verdacht, dass Ratu Bola eine Whiskyflasche mitgenommen hat. Ich bin zu müde, um zu zählen.
Ich liege auf den Matten, mit meinem Regenmantel zugedeckt. Ein Bett mit einer Sprungfedermatratze ist immerhin noch besser, besonders, wenn ein Moskitonetz dabei wäre.
Ich sehe durch die grosse Türöffnung den Sternenhimmel. Es ist herrlich kühl, es duftet nach Regen, Gras und den weissen Blüten des Frangipanibaums. Ich höre lange nichts als das Zirpen der Zikaden, das Singen des Moskitos neben meinem Ohr und einmal einen seltsamen Vogelschrei.
Ich kann noch lange nicht schlafen, der Moskitos wegen, und weil Mister Brown so schnarcht und weil ich auf einmal so deutlich dieses Fremdsein empfinde, die beunruhigende Seltsamkeit dieses Nachtlagers im Hause der Lords von Fidschi, auf dem Boden, der mir noch nach dem Blut menschlicher Opfer zu riechen scheint und nach unbekannten Emanationen eines grauenhaften und dreiköpfigen Gottes.
Dann, ganz in der Ferne, wer weiss, unter welchem steilen Dach, in welcher luftigen Häuptlingshütte, beginnt Musik zu tönen. Es versucht jemand, ob er den Radetzkymarsch auf der Mundharmonika blasen kann.