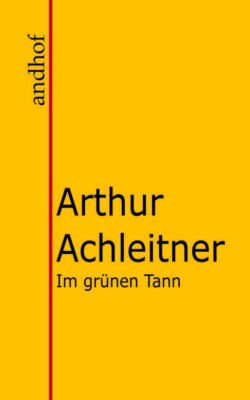Читать книгу Im grünen Tann - Arthur Achleitner - Страница 3
Die Herzogskerze
ОглавлениеÜber den „toten Bühl“, einen Teil der Hochebene im südlichen Schwarzwald Badens, braust der Herbstwind in langen Stößen; es seufzt der Tann in den niederen Lagen, oben aber auf der kahlen Höhe ächzen die wenigen alten knorrigen Buchen und am einsam ragenden Kruzifix bebt die Holzfigur des Heilandes, nachdem Regen und Wind die Holznägel gelockert und die Befestigung mürbe gemacht haben. Öd und rauh, unwirtlich ist dieser Strich badischen Schwarzwaldlandes, den der Volksmund selbst bezeichnend den „toten Bühl“ nennt, weil die Hügelreihe wahrhaftig an den Tod der Natur gemahnt, heimgesucht von scharfem Westwind und häufigem starken Schneefall, der schon auf die alten Strohdächer der Walddörfer fällt, wenn drüben am glitzernden Rhein, im sonnigen Garten des badischen Unterlandes Wiesen und Matten noch im spätsommerlichen Glanze prangen. Einzelne Gemarkungsnamen verraten nur zu deutlich die Selbstkritik der Wäldler über ihre engste, selten verlassene Heimat; hier heißt ein Wiesengrund das „elende Löchle“, dort eine felsendurchsetzte, von Bergföhren umwucherte Fläche das „öde Land“. Und verschlossen, rauh wie seine Heimat ist auch der Hauensteiner in dieser alten Gemarkung mit seiner zähen Anhänglichkeit an die alten Zeiten, an die sagenhaften alten „Handfesten und Privilegy“ des Grafen Hans, an sie Einung und mittelalterliche Reichsunmittelbarkeit mit ihren schweren Kämpfen gegen Obrigkeit und neues Recht. „Hotzen“ heißen die Bewohner des Hauensteiner Waldgrundes nach ihrer künstlich gefälteten Pluderhose, die oft zehn bis zwölf Ellen Tuch beansprucht, wenn die nach Geschmack und Brauch der stämmigen alemannischen Wäldler sein soll. Der über die unwirtlichen Höhen brausende Wind erzählt den Wäldlern manches von goldener Freiheit, die auf den herüberblinkenden Schweizer Bergen herrscht, er singt in kraftvoller Weise von Unabhängigkeit, wie sie in den Urkantonen des Nachbarlandes gedeiht; nichts aber dringt herein in den Tannichtschatten und in das Waldesweben von neuer, anderer Zeit, und unberührt bleibt der Hauensteiner vom Getriebe einer fremden Welt.
Immer schärfer bläst der Wind aus West; schwarzgrau verhangen ist das Firmament, schon wirbeln einzelne Flocken über den „toten Bühl“ als Vorboten des frühen Winters mit seiner unerbittlich strengen Herrschaft, so er sich einmal eingenistet hat im öden Waldstrich, der hochgelegenen Heide und in den wuchtigen Steinfeldern. Immer dringlicher rüttelt der Wind an den mächtigen moosumwucherten Strohdächern des einsam im „toten Bühl“ liegenden Dörfchens Hochschür, als will er der Bedachung Stücke entreißen und fort in die Lüfte führen, den armen Wäldlern zum Trutz. Besonders wütet die Windsbraut um das einsam seitwärts dem Dörflein stehende Wirtshaus, dessen vergilbtes Schild kaum noch erkennen läßt, daß einst die drei Könige aus dem Morgenland Schutzpatrone für zechende Hotzen gewesen sind. Die Hochschürer haben denn auch völlig auf die morgenländischen Wirtshauskönige vergessen und lieber dem daneben stehenden abgeworbenen Lindenbaum zu Ehren die weltverlassene Raststätte zum „dürren Ast“ benamset, wo ein Säuerling verabreicht wird, der selbst grimmig verrissene Schuhe wieder zusammen zu ziehen in der Lage ist. Das sturmumtoste Wirtshaus ist geflickt, wo man es nur betrachtet; geflickt durch eingefügte Strohbüscheln das uralte verwitterte Dach, geflickt die eingedrückten Fensterscheiben durch Papierverklebung; die Thüren zeigen gähnende Löcher, durch welche der Höhenwind wohl luftig pfeift und den Qualm des Herdfeuers vergnüglich durch den Flur jagt bis hinter zum Tenn und durch das wackelige Scheuerthor hinaus auf die „Einfahr“. Grimmig gröhlt und rüttelt der Sturmwind am Hausgerät im „Schild“, im freien Raum, der noch vom vorgehenden Dach überwölbt ist; doch mag es hier knattern und krachen, ächzen und poltern, das Getöse lockt weder den Wirt zum „dürren Ast“, noch sonst einen Inwohner aus dem Hause hervor, und das Streulaub kann im tollsten Getriebe um das Haus wirbeln, niemand wird den Hausen etwa mit Tannicht biegen oder mit Steinen beschweren, um einer Entführung vorzubeugen. Streitpeterle, der Wirt zum „dürren Ast“ hat wichtigere Dinge im Kopf, als sich um solche geringfügige Sachen zu kümmern; er hockt drinnen in seiner Stube und brütet nach über eine Angelegenheit, die sein Sohn ihm heute morgen brühwarm aus Waldshut hinterbrachte, so eine vertrakte Neuerung, wie sie in letzter Zeit mehrfach die Wäldler überraschten und zum sinnieren veranlagten. Mit Amt und um eine Sache „uszuprobyre“ auch mit dem Hofgericht zu Freiburg zu prozessieren, ist für den alten Peter eine Kleinigkeit und ob seiner Prozeßlust, die sein Hab und Gut allmählich aufgesaugt, hat der „dürre Ast“-Wirt auch den Vulgärnamen „Streitpeterle“ wegbekommen, was ihn diesmal stumm und nachdenklich macht ist die Botschaft, daß die Regierung eine Feuerschauordnung verfügt und angeordnet haben solle, daß durch bestellte Schornsteinfeger die Kamine selbst in den Walddörfern und Einödhöfen untersucht und gekehrt werden müssen. Peterle hatte anfangs seinen flachshaarigen Buben, den zwanzigjährigen Jaköble mit weit ausgerufenen Augen und offenem Mund angestarrt, ohne ein Wort aus dem Schlund zu bringen. Für ihn war die Neuigkeit so überwältigend, als wenn Jobbeli etwa gemeldet hätte, der „Salpeterhannes“ sei wieder lebendig geworden und habe die Einung zu den Waffen gegen die vorderösterreichische Regierung gerufen, wiewohl Haus Albiez schon an die achtig Jahre im Grabe ruht.
In einem Schwarzwaldhaus, in einem Einungsgehöft die Esse kehren! Und noch dazu bei Peter Gottstein, der sich aufs Protestieren und Prozessieren besser versteht als all' die gelahrten Herren von Freiburg bis Mannheim! Aber es wird nichts daraus! Hat der alte Gaugraf Hans von Hauenstein keinen Rauchfangkehrer gehabt, so kann der Streitpeterle solchen um vier Jahrhunderte später auch entbehren, zumal auch erst ausprobyret werden muß, ob die Appenzeller und Graubündener ihre Kamine fegen lassen oder ob sothane Verfügung ein uralte Rechte verletzender Eingriff der Regierung sei, welch' letztere den Hotzen nichts zu befehlen habe. Also sinniert Peterle vor sich hin und schiebt von Zeit zu Zeit die schwielige Rechte in sein buschiges Grauhaar, wie wenn er seinen Gedanken oben an der Schädeldecke Luft machen wollte. Und zeitweilig knurrt er und beißt die Zahnstumpen aufeinander. Dann springt er auf, schreitet auf ein Regal aus Tannenholz zu, in dem sich feinsäuberlich geordnet dicke Aktenstöße befinden und trägt nun Fascikel um Fascikel auf den rohgefügten Tisch, um nachzuschlagen, ob sich darinnen etwas vorfinde, worein man sich zu einem kräftigen Protest einhängen könne. Aber soviel Peter auch blättert in den Schriften, Nummer um Nummer durchnimmt, es findet sich nichts von Schlotfegerei. Gerichtsbeschlüsse, alte Hofentscheide von Großvaterszeiten her, unangenehme Sachen mit ihren Erinnerungen an die unglücklich verlaufenen Salpetererkriege und Prozeßakten, kostspielige Schriftstücke, die Peters schönste Kühe und Äcker verschlungen und ihn schier arm gemacht haben. Und nach Durchsicht seiner Registratur kommt Peterle folgerichtig in seinem Gedankengang zu dem Schluß: „Enthalten seine wohlgeordneten Akten nichts von einer Feuerbeschau und Schlotfegerei, so könne sothane Verordnung unmöglich Rechtens sein.“ Und daher nimmt Peter einen Bogen Kanzleipapier, taucht die verstaubte Feder in die halb eingetrocknete Tinte und kritzelt mit dem knisternden Gänsekiel nieder: „Beschluß! Von einer Verpflichtung, meinen Kamin durch ein fremdes Organ fegen zu lassen, findet sich in den Akten seit Großvaters Zeit her nichts vor, war auch niemals Brauch im Hauensteinschen Land. Daher wird sothaner Neuerung die Zustimmung verweigert und jeder fremde Schlotfeger hinausgeworfen, so er sich heraufwagt. Auch wird ihm Atzung und Trunk in der Gaststube nicht verabreicht. Gegeben am Evaristustage Anno 1805. Peter Gottstein.“
Mit vieler Mühe hat Peterle diesen „Beschluß“ zu Papier gebracht und sodann seinen Akten beigegeben. Förmlich erleichtert erhebt er sich, bringt die Fascikel wieder Nummer für Nummer in das Regal und spricht vor sich hin: „Und nun soll es Einer probyre, der Peterle wird zu handle wisse bi Gott!“
Im selben Augenblick wird die Thüre geöffnet und ein zierlicher Mädchenkopf luegt herein. Es ist des Wirtes Thrinele, die beim Anblick des Vaters und der Akten erschrocken stammelt: „Aber Ätti, schon wieder hascht mit den alten Papieren zu schaffen?“
„Das hat dich nichts zu kümmern, Thrinele! Auch verstehst du davon nichts! Das ist meine Sache, die ich ausprobyre werde bis zur letzten Instanz!“ Thrinele ist völlig in die Stube getreten und schreitet wie das Bachstelzlein auf den Vater zu, auf dessen Arm sie ihre Rechte legt und schmeichelnd bittet, es möge Ätti durch neues Prozessieren nicht sich und alle völlig ins Unglück bringen. Zugleich sucht das schmucke Mädel durch vorsichtiges Fragen herauszukriegen, was denn abermals die Prozeßlust des streitsüchtigen Vaters geweckt habe. Peter poltert denn auch rasch heraus, daß aus der behördlichen Schlotfegerei nichts werde, so lange er seine Arme rühren und auf den Beistand der gleichgesinnten Bühler rechnen könne.
Thrinele vermag nicht sogleich zu erfassen, worum es sich aufs neue handle und fragt: „Schlotfegerei, was soll das bei uns? Das isch in unserer Gegnig (Gegend) nit Brauch gsi!“
„Der alte Graf Hans wird sich im Grabe umdrehen, wenn er vernehmen könnte, was für Neuerungen es giebt auf dem Wald! Aber es wird solche bei Gott nicht nicht geben! Noch leben treue Anhänger der heiligen Salpeterersache,[1] für die wir leben und sterben!“
„Ach Ätti! Laß' doch ab von solcher Sache! Sie hat sich überlebt und nur
Unglück gebracht in unser Land!“
„Schweig' Maidli! Eine Sache, für die so viele Wäldler das Leben gelassen, Männer wie Wybervölker, überlebt sich nicht, sie stirbt nicht, so wenig wie unser alter Glauben! Wir wollen frei bleiben und treu der Kirche, alles andere ist eitel und für uns nicht von Rechtens! Und in meinen Rauchfang wird kein Franzose, kein Österreicher, wie kein anderer klettern! So wahr der alte Gott lebt und ich Peter Gottstein heiße!“
„Ist's denn aber auch wahr, daß wirkliche Schlotgücksler in den Wald kommen sollen?“
„Frili isch's wahr! Der Jaköble hat die Kunde mitgebracht von Waldshut und andere Botschaft dazu, daß die Wälderchnabe ohne Ausnahm' Soldate werden müsse und die Alten neue Steuern, Accise zahle! Gott verdamm' mi, daraus wird nichts, sag' ich!“
„Ätti, ich mein', das Schlotgückslen wär' aber doch noch zu ertragen!“
„Nein! Das wird nur der Anfang sein und alles andere kommt noch nach!“
„Wenn das Schlotfegen uns aber nichts kostet, mein ich —“
„Nichts kosten, haha! Ausziehen werden sie uns und schinden, bis die letzte Ziege aus 'm Haus ist! Das haben unsere Vordern erlebt mit dem Waldpropst wie mit 'm Vogt zu jeglichen Zeiten! Drum schwör' ich: Eher werd' ich zum Chilchhof getragen, bevor mir ein Fremder in den Schlot steigt! Und die Füsi (Flinten) sollen knattern wie zu Hannes Zeiten!“
Erschreckt wirst sich Thrinele an Vaters Brust und sucht ihn zu beruhigen mit dem Hinweis, daß ein Schlotgücksler doch wahrlich nicht ein Blutvergießen und sonstiges Unheil wert sei.
Noch poltert der Alte: „Der Gücksler frili nit!“ da schreit des Wirtes blonder Jaköble wie besessen zur Thüre herein: „Sie kommen!“ und prasselt wieder zurück und durch den Flur ins sturmdurchtoste Freie.
Augenblicklich stößt Peter sein Maidli von sich und zetert nach der Füsi, um den Gücksler gebührend mit einem Schrothagel begrüßen zu können. Wie umgewandelt ist Thrinele, verschwunden jegliche Sanftmut, ein entschlossener Zug tritt in ihrem zarten Gesichtchen hervor und scharf fordert sie den Ätti auf, Gewalt zu unterlassen. Doch schon greift der Wirt nach der Flinte, die in einer Ecke hängt, immer scharf geladen, da wirst sich Thrinele ihm entgegen, reißt das Gewehr samt dem Nagel herunter, mit zitternder Hand schlägt sie den Hahn zurück, dreht den Lauf dem Fenster zu und drückt blitzschnell ab. Dichter Pulverdampf erfüllt die Stube, klirrend fallen die Scheibenscherben auf das Pflaster vor dem Hause. Verdutzt blickt der Alte auf seine so urplötzlich resolut gewordene Tochter und auf das abgeschossene Gewehr. Thrinele stellt wortlos die Waffe in die Ecke und verläßt die Stube. Dann folgt ihr Peter, unschlüssig, wie er nun den Feind abwehren soll. Und da ist sie auch schon die Gücksler-Kommission: ein Beamter in Uniform mit langem Schleppsäbel und einer Aktentasche, einen gewaltigen Dreispitz mit Federbusch auf dem Kopf, und neben ihm der Rauchfangkehrer in schwarzer Adjustierung mit Kratzeisen und der Leiter auf der rechten Schulter. Des Alten Sohn Jaköble beguckt die seltsame Kommission ungefähr mit der Andacht, mit welcher eine Kuh das neue Scheunenthor beschaut, indes Thrinele vor dem gestrengen Kommissär einen Knicks macht und nach seinem Begehr fragt. Zögernd ist auch der Vater nähergetreten, der seine Fäuste in den Sack gesteckt, um seinen Ingrimm nicht äußerlich zu schnell erkennen zu lassen. Es funkeln seine Augen ohnehin verräterisch genug und die zusammengekniffenen Lippen künden keineswegs Liebe und Sanftmut.
Mit schnarrender Stimme verkündet der Beamte das neue Edikt betr. den Schlotkehrzwang und fordert Unterwerfung und Einlaß für seinen schwarzen Begleiter im Namen des Großherzogs von Baden. Sodann fragt der Federbuschträger, sich zum Alten wendend, was der Schuß zu bedeuten hatte. Peter zieht sein Gesicht in höhnische Grimasse, Thrinele jedoch giebt schnell die Antwort, daß das Gewehr sich zufällig entladen und der Schuß keineswegs der anrückenden Kommission gegolten habe.
„So so! Na, ist Euer Glück! Künftig spritzt aber keinem Beamten Schrot ins Gesicht, so Ihr nicht Bekanntschaft mit Eisenmeister und Galgen machen wollt. — Öffnet also und laßt den Kaminfeger ein zur Arbeit! Bei Euch, Peter Gottstein soll im oberen Wald begonnen werden!“
Nähertretend fragt Peter: „Warum bei mir zuerst?“
„Weil Ihr die wichtigste Person am „toten Bühl“ seid!“
Geschmeichelt steht Peter eine Weile und kratzt sich hinter'm Ohr. Was soll er thun? Daß man ihn mit seinem Einfluß auf die Wäldler respektiert, ihm gewissermaßen den Vorrang sogar beim Schlotfegen einräumt, schmeichelt ihm nicht wenig; aber er ist gewohnt, just das Gegenteil zu thun, was von ihm verlangt wird, und deshalb neigt er eher zu einer Verweigerung hin, es juckt ihn seine Protestleidenschaft. Auch ist sicher anzunehmen, daß die Salpeterer am toten Bühl überall den Schwarzen hinauswerfen und das Kaminfegen verweigern, wenn der Peter hierzu das leuchtende Beispiel gegeben haben wird. Und wenn der dicke Federbuschmann mit hinausgeworfen würde aus jeglichem Salpetererhofe, müßte das ein köstlicher Anblick sein, füglich aber ein Merks für die Freiburger Regierung, daß noch der alte Geist der Freiheit und Unabhängigkeit herrsche auf den Schwarzwaldhöhen. Auf gewöhnlichem Wege jedoch die Kommission unverrichteter Dinge vom „dürren Ast“ wegzuschieben, däucht Petern in seiner Führerwürde zu harmlos, vom Gehöft des Streitpeterle dürfen die Kommissionsleute nicht gewöhnlich gehen, sie müssen hüpfen, wie besessen rennen und ein Andenken an den „dürren Ast“ mitnehmen, das ihnen das Wiederkommen verleidet.
Der Beamte wiederholt die Aufforderung und schwingt dabei die Aktenmappe, um seiner Wichtigkeit größeren Nachdruck zu geben. Über Peters Gesicht huscht ein höhnisches Lächeln, grinsend sagt er: „Wenn ich nicht will, kommt Ihr mir nicht ins Haus! Ich will Euch aber einlassen, so Ihr da mit Eurem Federbusch auch mit hinauf in den Schlot steiget!“
Erschrocken prallt der Beamte zurück und stottert: „Wie? was? Seid Ihr verrückt? Ich — ich — habe oben nichts zu thun — das ist des Kaminfegers Sache!“
Auch Thrinele kann das Lachen über die drollige Erscheinung des Federbuschmanns und dessen Schrecken nicht verbeißen und kichert vor sich hin, indessen Jobbeli in Vorahnung eines Spaßes die Hausthüre angelweit aufreißt und durch eine linkische Armbewegung zum Eintritt einladet.
Peter besteht darauf, daß der Kommissär unter der Esse auf den Vollzug der Kehrordnung warten müsse, andernfalls lasse er den Schornsteiner nicht ein. Dem Beamten ist es zu thun, den Streitpeterle 'rum zu bekommen, auf daß er bei den übrigen Waldbauern nicht auf Widerstand stößt. Vielleicht ist es lediglich eine Marotte des eigensinnigen Hotzen, und Peter ist ja der größte Starrkopf der Wäldler. Auch tobt der Wind so grimmig um den Bühl, daß der Aufenthalt selbst in der rußigen Küche vorzuziehen sein wird. So entschließt sich denn der Kommissär zum Eintritt und hinter ihm und den Schornsteiner drängen die Andern nach ins Haus. Schon hinter der Thür beginnt der Federbuschmann zu husten, der Qualm des glimmenden Herdfeuers benimmt ihm schier den Atem. Der Schwarze meint, das Feuer müsse ausgelöscht werden, sonst könne er nicht in den Rauchfang aufsteigen.
Mit Entschiedenheit aber fordert Peter nun sofortigen Beginn der „Regierungsthätigkeit“ des Schornsteiners und droht im Weigerungsfalle mit gewaltsamer Entfernung der ganzen Kommission. Das Faceletto vor den Mund haltend, giebt der Kommissär Befehl, den Schlot zu kehren, und gehorsam steigt der Schwarze auf seiner Leiter in die Esse.
Kaum ist der Schornsteiner oben verschwunden, packt Peter blitzschnell einen Bund trockenen Reisigs und wirft es auf die glimmende Glut, und Jobbeli beeilt sich augenblicklich, des Vaters Beispiel kräftig und flink nachzuahmen. Gierig züngeln die Flammen auf, es prasselt das Reisig wie Zunder, im Nu ist die Küche raucherfüllt und in dicken Schwaden steigt der Qualm in den Schlot. Vergebens poltert der Kommissär gegen solch' boshaftes Beginnen und wischt sich die brennenden Augen aus; doch die Gottsteins kümmern sich nicht den Pfifferling um das Gezeter und werfen immer neues Reisig auf die prasselnde Glut. Nur Thrinele thut nicht mit und flüchtet vor Qualm und Rauch hinweg in ihre Stube. Ihr Beispiel ahmt hustend, schier erstickend der Bebuschte nach und stürmt ins Freie. Gleich darauf rasselt der Schornsteiner die Esse herab, betäubt vom Qualm und krachend fährt er mitten in die aufspritzende, funkensprühende Glut des Herdfeuers, worüber Peter und Jaköble ein wahres Freudengeheul anstimmen und sich die Seiten halten vor Lachen über das sie höchlich belustigende Schauspiel. Wie besessen springt der Schwarze aber vom Herd hinweg, heulend vor Schmerz und stürmt ins Freie, eine schwarze Fährte ziehend im frischgefallenen Neuschnee. Brüllend vor Vergnügen stürzen Peter und Jaköble ihm nach, um das Auge zu weiden an der rasenden Flucht der geprellten Kommission, bis der dicke Kommissär mit dem wackelnden Federbusch und hinterdrein der toll springende Schwarze hinter den Häusern von Hochschür verschwinden.
* * * * *
Gegen die neunte Abendstunde hat es zu schneien aufgehört. Die Wolken sind verzogen, klar ist der Himmel, besät von mildstrahlenden Sternen, und der Mond sendet sein Silberlicht herab auf den überzuckerten Tann und die weißschimmernden Bühlhöhen des Schwarzwaldes. Das Kreuz auf dem toten Bühl wirst vom magischen Licht übergossen, einen langen Schatten auf den schneeigen Grund und geisterhaft strecken die entlaubten Buchen ihre Äste gen Himmel. Es flimmert die öde Landschaft im glitzernden Schmuck winterlichen Geflockes, und gegen die Helle am Bühl sticht schaurig das Schwarz der Tannenwälder ab mit ihrer unheimlichen Finsternis und geheimnisvollen Starrheit. Der Wind hat sich gelegt; still ist's weit um, tot und leer. Nur zeitweise rutscht in kleinen Ballen der Neuschnee von den Tannengipfeln tiefer herab auf die Äste und von der weißen Last befreit schnellen die Zweige wieder hinauf zur normalen Lage. Das giebt ein knisterndes Geräusch im sonst kirchenstillen Tann, das sich zum dumpfen Getöse verstärkt, wenn die größer gewordene Schneelast durchbrechend auf den Waldboden aufschlägt. Schneestaub quillt dann für einen Augenblick auf, alles verhüllend; dann aber legt sich der weiße Staub, schwarz ragt die befreite Tanne auf in schauriger Hoheit und nächtlicher Majestät.
Vom Kirchturm zu Hochschür schlägt es zehn Uhr nachts in langgedehnten Tönen. Wohl blinken die Fenster der wenigen Häuser des kleinen Dorfes im Mondenschein, doch ist jegliches Licht erloschen. Die Dörfler sind wohl längst zur Ruhe gegangen und schlafen den Schlaf des Gerechten, mit Ausnahme vielleicht jener Hochschürer, die dem Dörflein den üblen Ruf eingebracht haben, von dem Scheffel schreibt: „So einem in der Umgebung nachts in dem Keller eingebrochen und Kartoffeln geholt, oder ihm das frischgeschlachtete Schweinlein aus dem Kamin ausgeführt wird, so heißt's: es wird den Weg alles Fleisches nach Hochschür gegangen sein.“ Von einigen Häuschen lösen sich richtig schwarze Gestalten ab, hochgewachsene Männer, die dunklen Überwurf, wallende Mäntel und auf dem Kopf gewaltige Pelzmützen tragen. Schweigend stapfen diese Gestalten alle einem Ziele zu: hinauf zum Kreuz am toten Bühl. Und auch von anderen Seiten her pilgern Männer dicht vermummt gegen Frost und Kälte; die einen durch den Tann von Gebisbach her, andere von Altenschwand und Hottingen, von Sägeten, jenem Dörflein, von dem es heißt: Hochschür und Sägeten giebt eine Trägeten (Traglast, d.h. sie wiegen [im Rufe] gleich schwer), und von Herrischried. Seltsam düster heben sich die Gestalten ab vom glitzernden Schnee, schier geisterhaft in ihren schwarzen Mänteln und hohen Mützen. Von allen Seiten klimmen und steigen sie den toten Bühl hinan, schweigend, ernst, feierlich, und stellen sich im Kreise um das Kreuz auf, vor dem sie die Mützen lüfteten und das Knie beugten, zugleich das Kreuz auf der Brust schlagend. Doppelt und dreifach wird der Menschenring auf der Bühlhöhe, die Männer stehen wie die Mauern im rasch zusammengetretenen Schnee und harren der kommenden Dinge im gespenstischen Mondenschein, die Augen auf den Christus am Kreuze gerichtet.
Und wie die Uhr von Hochschür die Geisterstunde schlägt, hebt einer aus der nächtlichen Versammlung an zu sprechen: „Im Namen der heiligen Jungfrau Maria. Gottwilche! (Willkommen).“
„Gottwilche!“ tönt es mit gedämpfter Stimme in dem dreifachen
Menschenring.
Streitpeter ist's, der den Willkomm ausgesprochen als der Vertrauensmann der Salpeterer am toten Bühl, der die Versammlung einberufen hat zur Besprechung wichtiger Dinge, und der nun den Ring verläßt, sich an den Kreuzstamm stellt und zu reden beginnt: „Gott wilche! 's isch e gheimi Sach, die mer han z' verhandle heroben am toten Bühl. Sin Ihr alle da, die ich g'lade han zur Geischterstund? Die Männer von Gebisbach, Altenschwand, Hottingen, Sägeten, Hochschür und Herrischried?“
Mit dumpfer Stimme melden sich die Verschworenen aus den ausgerufenen
Orten.
„Sind annere aus 'm Wald aach noch chomme?“
„Ja! Ich, Ägidius Riedmatter von Kuchelbach bin aach chomme!“ ruft ein alter Mann aus dem dritten Ring.
Tiefe Bewegung geht durch die Menschenreihen, summendes Geflüster der Überraschung, daß sich ein Salpeterer auch aus dem Albthal eingefunden, der drüben Führer ist und Hauptverfechter der heiligen Sache.
Peter fordert Riedmatter auf, ans Kreuz zu treten und der Versammlung zu sagen, was er als richtiger Salpeterer auf dem Herzen habe.
Die Männer treten etwas zur Seite, um den alten Riedmatter durchzulassen, und mit festem Schritt tritt derselbe auf das magisch beleuchtete Kreuz, entblößt das von weißem Haar umrahmte Haupt und spricht mit kräftiger Stimme: „Im Namen der heiligen Jungfrau Maria seid gegrüßt, Salpeterer! Was ich euch han ze sage, isch kurz und bündig das: Wer ich bin, wisset ihr alle! Und mir, Ägidius Riedmatter isch in stiller Nacht der Geischt des Salpeterhannes, Albiez' Geischt wirklich und wahrhaftig erschienen, und selbiger Geischt hat mich eingeweiht und bezeichnet als Hannesle's Nachfolger in der Führerschaft der Salpeterer. Ich soll den Kampf aufnehmen und führen wie einst der Hannes selber! Und dem Mahnruf des Geischtes han ich Folge geleistet und drüben im Albthal mein heilig und schweres Amt übernommen. Heute in verschwiegener Nacht am Kreuz des toten Bühl bin ich erschienen und frage euch, ihr Mannen des Murgthales: Wollt Ihr mitkämpfen für die heilige Sache?“
„Ja! Wir wollen, im Namen des dreieinigen Gottes für die Freiheit unseres Volkes und für unseren Glauben!“ tönt es rauh, aber feierlich aus dem dreifachen Menschenringe.
Nun frägt Peter den alten Riedmatter: „Ischt der Geischt des Hannes dir wirklich erschienen? Erhebe die rechte Hand zum Kreuz und schwör' es uns zur heiligen Dreifaltigkeit!“
„Ich schwör' es!“
„Dann glauben wir dir! Und du, Ägidi, sollst fürder auch unser Führer sein im heiligen Kampfe. Willst du?“
„Ja, ich will! An der Hand der alten Festen und Privilegy, der kaiserlichen Briefe will ich unsere Sache führen und nicht erlahmen in der Verteidigung unserer alten Rechte. Schwört mir Gehorsam und Gefolgschaft!“
„Wir schwören!“
„Und nun höret: Wie einst Hans Albiez müssen auch wir die uralten Rechte der Grafschaft Hauenstein verteidigen. Unsere Vereinigung, der im stillen auch tapfere Weiber, Söhne und Töchter angehören, ist bereit, dafür das Leben zu lassen. Ein offener Aufruhr mit den Waffen in der Faust kann uns jedoch nur das Schicksal unserer Großväter, die gewaltsame Verbannung, Verlust des Lebens und Eigentums eintragen. Wir müssen der Übermacht anjetzo noch weichen! Aber was wir können, was wir müssen, ist die Hochhaltung unserer alten Rechte, auf die wir niemals verzichten werden, auch dann nicht, wenn man uns die Bajonette auf die Brust setzt und zum Galgen schleift! Kein Verzicht, aber auch kein gewaltsam Auflehnen. Wir huldigen nicht, niemandem, wir wollen frei und unabhängig bleiben! Und große wichtige Dinge bereiten sich vor! Unser ärgster Feind, das Kloster zu St. Blasien, wird bald nicht mehr sein!“
Jähe Überraschung fährt durch die Menschenmenge, und laute Rufe tönen zum nächtlichen Himmel.
„Ruhe! Das Kloster wird aufgehoben werden! Ich, der Nachfolger Albiez', sage es euch! Und haben wir diesen Feind los, so winkt die alte Freiheit wieder, die uns dort drüben die freien schweizer Berge verheißungsvoll zuwinken! Niemals hat irgend eine Herrschaft über uns zu Recht bestanden, nicht der Fürst von St. Blasien, nicht die Franzosen, nicht der Großherzog von Baden! Letzterer ist nicht unser Landesherr, er ist nur Meier (Verwalter), gesetzt vom Kaiser! Und niemals bestand die österreichische Herrschaft zu Recht! Wir verweigern auch dieser Herrschaft die Huldigung! Nur der Kaiser ist Schutzherr über uns und die Schweiz! Wir müssen ihn bitten, uns behilflich zu sein zur Wiedererlangung unserer alten Rechte, so da sind: Kein Schutzgeld, Freiheit von Steuern und Schatzungen, von Zinsen und Zehnten! Nur freiwillig stellen wir Milizen! Das alles haben die Kaiser uns zugesagt, so Kaiser Josef im Jahre 1782, so Kaiser Franz anno 1802. Ich habe die kaiserlichen Briefschaften und sage, wie Hans Fridli Gersbach von Bergalingen sagte: „«Wer diese Briefe lesen will, kann zu mir kommen: wer's nicht glauben will, hat hier in meinem Knorrenstock seinen Schulmeister. Ich hab's gesagt, ich sterbe dafür. Bedenkt zu Hause, daß Handschuhe hinter'm Ofen liegen,[2] ihr versteht mich!“» Wir hoffen auf Gott und den Kaiser und warten, wie es komme! Und was die Blutsteuer, die Stellung von Rekruten betrifft, die man wohl bald von uns fordern wird, so schafft bei Zeiten die Jungen fort. Über der Grenze wohnen auch Leute! Unterschreibt, so ihr schreiben könnt, nichts, versprecht nichts, verzichtet auf nichts! Und huldiget nicht! Weiteres werdet Ihr von mir hören! Im Namen der heiligen Mutter Gottes geht jetzt auseinander und schweiget, was ihr gehört. Amen!“
Mann für Mann tritt nun zu Riedmatter und schüttelt ihm wortlos die Hand, damit ein stummes Gelöbnis zur Gefolgschaft leistend. Und nach abermaliger Begrüßung des Kreuzes verlassen die Mannen stumm den Bühl. Riedmatter und Peter bleiben zurück in geheimer Zwiesprache. Erst als die Turmuhr eins schlägt, schreiten auch sie den weißschimmernden Bühl hinunter. Nur der vertretene Schnee giebt noch Kunde von der nächtlichen Versammlung. Bald darauf aber verhüllt der Mond sein leuchtend Antlitz, schwarze Wolken ziehen auf, der Westwind bläst aufs neue, und Neuschnee deckt abermals alles zu und verwischt jegliche Spur….
Winterszit, schweri Zit!
Schnee uf alle Berge lit….
* * * * *
In einem der Häuser am Ausgang des Dörfleins Rütte gellt eine Frauenstimme durch die Räume, und die Zornesrufe sind schier heraußen am schneebedeckten Sträßlein zu verstehen. Es ist des Josef Binker's Eheweib, die scharfe Vroni, welches den gutherzigen Gatten abkanzelt und ihm wieder einmal den Standpunkt klar macht. Der Josef ist ein sozusagen lammfrommer Mensch, dem man es vom Gesicht ablesen kann, daß er das Pulver nicht erfunden hat. Kleiner von Gestalt als die meisten der stämmigen Hotzen, hat er auch nichts vom kriegerischen Geist jener Hauensteiner, die vor 80 und 100 Jahren ihr Leben für die Salpeterersache einsetzten. Ihm geht Ruhe und Frieden über alles, und weil er immer und überall sich nachgiebig zeigt, hat ihm das Schicksal in seinen oft sonderbaren Launen ein Eheweib beschieden, das weit eher die Pluderhose zu tragen berechtigt wäre, als der Hotze selber. Fleißig und arbeitsam erledigt Sepli seine Kleinhäuslergeschäfte und ist am Abend glücklich, in der behaglich durchwärmten Stube sein Pfifli Tubak rauchen und sinnieren zu können. Was um ihn vorgeht im Wald, heroben oder draußen in der Welt mit ihren Kämpfen, das kümmert Binker nicht im mindesten; soll nur jeder sehen, wie er sich durch's Leben bringt. Ihm ist's viel wichtiger, die schlecht gedeihenden Kartoffeln zu ernten und rechtzeitig Holz für den Winter aus Haus zu schaffen. Ganz anders veranlagt ist seine Vroni, die, lebhaften Sinnes, trotz ihrer gesetzten Jahre, sich um alle öffentlichen Dinge kümmert und namentlich für die alte und neue Salpeterersache sich lebhaft interessiert, von der sie eine Besserung der Lage und ihrer eigenen Verhältnisse sich erhofft. So sehr Vroni aber bisher in ihren gutmütigen Mann hineingeredet hat, erzielt hat sie nichts, denn Josef ist nicht zu bewegen, für die Salpeterersache auch nur einen Schritt zu thun, und immer setzt er ihrem Andrängen passiven Widerstand entgegen und läßt Vroni belfern und schwätzen. Diesmal zieht das Weib alle Schleusen der Beredsamkeit und zetert, daß die Fenster klirren. Erst heute früh beim Wasserholen hat ihr eine Salpeterin von der nächtlichen Versammlung am toten Bühl erzählt und vertrauliche Mitteilung über die gefaßten Beschlüsse und die Führerschaft des Ägidius Riedmatter gemacht: Dinge, die Vroni ungemein interessierten und veranlaßten, ihren Beitritt zur Salpeterervereinigung durch die Nachbarin anmelden zu lassen. Und vom Dorfbrunnen heimgekehrt, war es Vroni's wichtiges Geschäft, alles liegen zu lassen und Josef aufzufordern, sich zum Ausgehen fertig zu machen und dem Vertrauensmann Peter Gottstein, dem Wirt zum „dürren Ast“ den Beitritt des Binker'schen Ehepaares zu erklären. Josef hatte diese Mitteilung ruhig und geduldig wie immer angehört, sein Pfifli in Brand gesteckt und dann gelassen zur Antwort gegeben: „I mog nit!“ Nun war's um ihn geschehen, und Vroni legte los, daß es eine Art hat. „Hesch du au e Kuraschi, bisch du e Ma?! Was bisch du? E Lamm, e Schof, das hockt de ganze Zit im Stübli und träumet und wartet, bis die bratene Täubli ihm ins Maul flieget! Dunderschiß, bisch du e Ma! Di soll der Dunder in Erdsbode verschlage, du Waschlappe du!“ Und was der erzürnten Vroni in die Hände kommt, wirft sie dem Gatten an den Leib, Häfele, den Besen und zu guterletzt den Milchkübel mit der Ziegenmilch, so daß heute wohl Fasttag bei Binkers sein wird, wenn Sepli die verspritzte Milch nicht vom Boden aufschlecken will. Das zornige Weib hätte das Gezeter aber ebenso gut vor einem Holzklotz halten können, die Wirkung wäre dieselbe geblieben. Josef rührt sich nicht und läßt die Vroni schreien, als sie aber anhebt aufs neue und ihm droht, ihn und das Haus zu verlassen mit den schwerwiegenden Worten: „Die Eh' isch ab, so du nit Salpeterer wirsch!“ da erhebt sich Sepli zitternd und sagt stotternd, so weit solle es denn doch nicht kommen. Augenblicklich nimmt Vroni diese Gemütsbewegung und den erreichten Vorteil wahr und bekräftigt ihre Rede mit der verschärften Drohung, daß sie noch in dieser Stunde von hinnen gehen werde, wenn Sepli nicht sofort dem Streitpeterle das Gelöbnis in die Hand leisten werde. „Ja, ja, i goh!“ stammelt der eingeschüchterte Wäldler und sucht nach seinem Mantel. Ein Freudenschimmer fliegt über Vroni's runzeliges Gesicht, und flink trägt sie dem besiegten Gatten Mantel, Pelzmütze und Stock herbei und drängt zur Eile. So ist Josef in seinem ganzen Leben noch nicht bedient worden, er fühlt sich wie ein Herr, und freut sich, es durch Nachgiebigkeit so wohlbehaglich zu haben. Freilich der Gang ist unangenehm und die Salpeterei ihm zuwider; aber vielleicht bekommt er fürder den Hausfrieden und wird's Vronele künftig sanftmütiger sein! Drum stapft Sepli mit 'm Pfifli im Mund hinüber durch Schnee und Wald gen Hochschür zum Wirt zum „dürren Ast“. Vroni aber muß eine Weile verschnaufen und überläßt sich ganz dem Wonnegefühl des erreichten Sieges. Daß die Drohung so gewirkt, überrascht sie eigentlich selbst, denn insgeheim hat sie eher befürchtet, daß Sepli sie gehen heißen würde. Hat sie ihm doch das Leben bisher sauer genug gemacht und verbittert und das Regiment scharf, fast zu scharf geführt. Und übermäßig jung und sauber ist's Vronele auch nicht mehr; Sepli könnte unschwer eine hübschere Gesponsin bekommen. Aber an so was denkt der Mann ja nicht und der Pfarrer würde ihm solche Gedanken schon austreiben. Ein Wäldler hat noch niemals sein angetrautes Weib verlassen. Freilich auch nicht eine Wäldlerin ihren Mann; aber die Salpeterersache ändert Brauch und Ordnung, Gewohnheit und Recht, weil sie ein Kampf um heilige Rechte ist. Und Sepli muß ein richtiger Salpeterer werden; dafür wird Vroni schon sorgen.
* * * * *
Des Streitpeterle hoffnungsvoller Sohn, 's Jaköble, hat zeitig früh aus den Federn gemußt, so früh, daß der Bursch im ersten Augenblick des Gewecktwerdens nicht wußte, ob es Mitternacht, Abend oder Morgen sei. Sein Zögern, die Langsamkeit, mit welcher er aus dem Bette kroch, hatte Ätti fuchtig gemacht, und Vaters Zornesrufe ließen Jobbeli flink in die Kleider fahren und fragen, wo es denn „füürig“ sei (wo es brenne)? Aber da kam der Bursch übel an, denn der Vater wetterte: „Dunderschiß, nu numme kein Wörtle mehr, steh uf und lueg, was i dir z'sage han: Du gohsch uf Herrischried und seist m Hottinger im Hus neben der Chilch: Ägid Basel! Er soll no hüt am Rhi uf'm Riedmatter warte, Botschaft abnehme und ruftrage bis Herrischried. Du wartsch dort und tragsch no in der Nacht Kundschaft her zu mir. Vostehsch, Jobbeli? Und steh' uf und laß di nit sehe, sei an nüt ze de Halunke! Uf jez un bhüdi!“ Damit drückte Peter dem Jobbeli etwas Geld in die Hand und schob den Burschen zur Thür hinaus in den bitterkalten, nebligen Wintermorgen. Der scharf um den Bühl wehende Wind trieb Jaköble zur Eile, auch schien ein Stehenbleiben nicht rätlich, weil Ätti unzweifelhaft in solchem Falle dem Bübli flinke Füße machen würde. Jedenfalls muß die Sache heillos pressant sein, sonst hätte Jobbeli nicht so früh aus den Federn gemußt. Freilich wenn der Hottinger vormittags noch nach Säckingen muß, heißt es sich sputen. Hernach aber hat Jobbeli heidenmäßig viel freie Zeit in Herrischried und kann hinterm warmen Ofen im „Roten Ochsen“ wartend liegen, bis der Hottinger vom Rhein wieder herauf zurückkommt. Also stapft Jaköble flink durch den harstigen Schnee nach Herrischried, wo die Essen rauchen zum Zeichen, daß die Morgensuppe gekocht wird. Das Haus neben der Kirche ist bald gefunden und der Hottinger erfragt, welcher alsbald forteilt, der Ordre gemäß, um den Salpetererführer in Säckingen zu erwischen. Jobbeli aber schlendert gemütlich zum „Roten Ochsen“, in dessen Gaststube eben der Ofen in Brand gesetzt wird. Der Bursch fragt nicht viel und kriecht auf die Bank hinterm Ofen um den Schlaf nachzuholen. Chüngi (Kunigunde) schaffet fleißig, die Stube in Stand zu setzen und kümmert sich nicht weiter um das Bühler Büebli.
Gegen Mittag aber, als der Kuckuck in der Schwarzwälder Uhr unter Verbeugungen elfmal seinen Ruf in der behäbigen Stube erschallen läßt, kriecht Jobbeli hervor, reibt sich die Augen klar, streckt und dehnt die Glieder und bittet Chüngi, ihm ein Mittagsüppli zu geben, „ume Chrützer“ und aufgeschmälzte „Grundbire“ dazu und auch ein Schöppli Kaiserstühler. So setzt sich Jobbeli an den einen Tisch nahe dem Ofen und harret als einziger Gast in der braungeräucherten Stube seiner Atzung, welche die braunbezopfte Chüngi denn auch bald herbeiträgt und darauf das Kännlein badischen Weines. Still ist's in der Stube; nur Jobbelis Löffel klappert zuweilen und im dickbauchigen Ofen prasselt das Tannenholz, das frisch nachgefüllt worden. Draußen hat sich der Nebel gehoben und ist's lichter sonniger Tag geworden. Es flimmert und glitzert schier blendend; die Häuser tragen weiße Hauben und blitzende Streifen liegen auf den Fenstersimsen. Dicht beschneit sind die nahen Tannen, deren tiefes Grün neben dem überwältigenden Weiß kaum durchzudringen vermag. Ein Holzschlitten mit Blochen beladen, von Kühen gezogen, fährt vorüber mit pfeifendem Schleifen über den trockenen Schnee, geleitet von einem gegen die Kälte vorsorglich vermummten Knecht. Dann wird es wieder ruhig und still draußen. Drinnen tickt nur die Uhr in der Ecke über dem schwarzgeräucherten Kruzifix. Chüngi leistet nach dem Abtragen des leeren Geschirres dem Jobbeli Gesellschaft und fragt ihn nach dem Zweck seiner Anwesenheit in Herrischried. Und der Bursch, ein Schwerenöter, versichert gekommen zu sein, um in Chüngis schöne Rehaugen zu schauen, er hascht nach ihrem Händchen.
Ungläubig wehrt das Maidli ab und schlägt Jobbeli auf die zudringlichen
Pfoten: „O Jesis, was bisch du mer für e verlogenes Büebli!“
Lachend beteuert Jobbeli seine Behauptung und sucht Chüngi an der Hüfte zu umfassen, doch schwapp sitzen ihm des Mädchens fünf Finger im Gesicht, und der Bursch reibt sich verdutzt die geschlagene Wange. Im selben Augenblick wird die Thür geöffnet und ein stattlicher Bursch tritt ein, die Scene mit Hallo begrüßend und zu Jaköble gewendet, fragend: „Isch was gange, Jobbeli?“
Etwas zaghaft meint der Bühler: „'s isch nüt gange!“
Der wehmütige Ton reizt nun auch Chüngi zum silberhellen Gelächter, indes sich Michel, des Martin Biber zu Herrischried Einziger, zu Jobbeli an den Tisch setzt, ein Schöppli Durbacher bestellt und dem Bühler auf die Achsel klopft: „Musch es annersch mache, Jobbeli, ze Herrischried im Wald balzet der Urhahn annersch, haha!“
Das glaubt Jaköble gern nach den eben gemachten Erfahrungen, doch verspürt er wenig Lust, neue Balzversuche anzustellen.
Der stämmige Martin verläßt auch das Thema gleich und fragt: „Jobbeli, hesch du Kuraschi, so müschet mer Charte und spiele mer'n Win aus!“
„Isch recht!“ stimmt Jobbeli zu, und Chüngi bringt die abgegriffenen Karten. Bald ist das Spiel im Gange und hin und her wendet sich das Glück, bis Fortuna ihre Gunst ausschließlich dem Bühler Büebli schenkt, so daß Jobbeli zechfrei wird und Groschen um Groschen in Bargeld einstreicht.
„Zum Teufel, i verlier' heut no mi Röckli!“ ruft ärgerlich Michel und wirft einen Sechsbätzner auf den weinbetropften Tisch. „Halt zu mer, Heckener, bisch mi letzter!“
„Was isch Trumpf?“
„Alleweil oebbis e Herz! Weisch Jobbeli, e Herz het e jeder!“
„Gstoche sell Herz! Her ze mer, Heckener!“
„Dunderschiß, hesch du e Glück!“
„Wos mache mer jez? Hesch du no oebbis ze setze?“
„I will doch probire, un 's Glück hassadire, weisch wos, Jobbeli? Jez spiele mer ume Ohrläppli vonemer!“