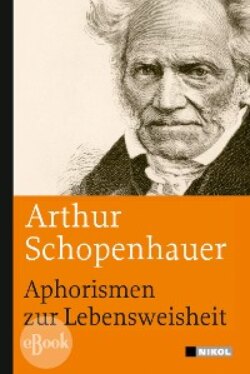Читать книгу Aphorismen zur Lebensweisheit - Arthur Schopenhauer - Страница 6
KAPITEL II.
VON DEM, WAS EINER IST.
ОглавлениеDaß Dieses zu seinem Glücke viel mehr beiträgt, als was er HAT, oder was er VORSTELLT, haben wir bereits im Allgemeinen erkannt. Immer kommt es darauf an, was Einer sei und demnach an sich selber habe: denn seine Individualität begleitet ihn stets und überall, und von ihr ist Alles tingirt, was er erlebt. In Allem und bei Allem genießt er zunächst nur sich selbst: Dies gilt schon von den physischen; wie viel mehr von den geistigen Genüssen. Daher ist das Englische to enjoy one's self ein sehr treffender Ausdruck, mit welchem man z. B. sagt he enjoys himself at Paris, also nicht »er genießt Paris«, sondern »er genießt SICH in Paris.« – Ist nun aber die Individualität von schlechter Beschaffenheit; so sind alle Genüsse wie köstliche Weine in einem mit Galle tingirten Munde. Demnach kommt, im Guten wie im Schlimmen, schwere Unglücksfälle bei Seite gesetzt, weniger darauf an, was Einem im Leben begegnet und widerfährt, als darauf, wie er es empfindet, also auf die Art und den Grad seiner Empfänglichkeit in jeder Hinsicht. Was Einer in sich ist und an sich selber hat, kurz die Persönlichkeit und deren Werth, ist das alleinige Unmittelbare zu seinem Glück und Wohlseyn. Alles Andere ist mittelbar; daher auch dessen Wirkung vereitelt werden kann, aber die der Persönlichkeit nie. Darum eben ist der auf persönliche Vorzüge gerichtete Neid der unversöhnlichste, wie er auch der am sorgfältigsten verhehlte ist. Ferner ist allein die Beschaffenheit des Bewußtseyns das Bleibende und Beharrende, und die Individualität wirkt fortdauernd, anhaltend, mehr oder minder in jedem Augenblick: alles Andere hingegen wirkt immer nur zu Zeiten, gelegentlich, vorübergehend, und ist zudem auch noch selbst dem Wechsel und Wandel unterworfen: daher sagt Aristoteles: η γαρ φύσις βέβαια, ου τα χρήματα (nam natura perennis est, non opes.). Eth. Eud. VII, 2. Hierauf beruht es, daß wir ein ganz und gar von außen auf uns gekommenes Unglück mit mehr Fassung ertragen, als ein selbstverschuldetes: denn das Schicksal kann sich ändern; aber die eigene Beschaffenheit nimmer. Demnach also sind die subjektiven Güter, wie ein edler Charakter, ein fähiger Kopf, ein glückliches Temperament, ein heiterer Sinn und ein wohlbeschaffener, völlig gesunder Leib, also überhaupt mens sana in corpore sano, zu unserm Glücke die ersten und wichtigsten; weshalb wir auf die Beförderung und Erhaltung derselben viel mehr bedacht seyn sollten, als auf den Besitz äußerer Güter und äußerer Ehre.
Was nun aber, von jenen Allen, uns am unmittelbarsten beglückt, ist die Heiterkeit des Sinnes: denn diese gute Eigenschaft belohnt sich augenblicklich selbst. Wer eben fröhlich ist, hat allemal Ursach es zu seyn: nämlich eben diese, daß er es ist. Nichts kann so sehr, wie diese Eigenschaft, jedes andere Gut vollkommen ersetzen; während sie selbst durch nichts zu ersetzen ist. Einer sei jung, schön, reich und geehrt; so frägt sich, wenn man sein Glück beurtheilen will, ob er dabei heiter sei: ist er hingegen heiter; so ist es einerlei, ob er jung oder alt, gerade oder pucklich, arm oder reich sei; er ist glücklich. In früher Jugend machte ich ein Mal ein altes Buch auf, und da stand: »wer viel lacht ist glücklich, und wer viel weint ist unglücklich,« – eine sehr einfältige Bemerkung, die ich aber, wegen ihrer einfachen Wahrheit doch nicht habe vergessen können, so sehr sie auch der Superlativ eines truism's ist. Dieserwegen also sollen wir der Heiterkeit, wann immer sie sich einstellt, Thür und Thor öffnen: denn sie kommt nie zur unrechten Zeit; statt daß wir oft Bedenken tragen, ihr Eingang zu gestatten, indem wir erst wissen wollen, ob wir denn auch wohl in jeder Hinsicht Ursach haben, zufrieden zu seyn; oder auch, weil wir fürchten, in unsern ernsthaften Ueberlegungen und wichtigen Sorgen dadurch gestört zu werden: allein was wir durch diese bessern ist sehr ungewiß; hingegen ist Heiterkeit unmittelbarer Gewinn. Sie allein ist gleichsam die baare Münze des Glückes und nicht, wie alles Andere, bloß der Bankzettel; weil nur sie unmittelbar in der Gegenwart beglückt; weshalb sie das höchste Gut ist für Wesen, deren Wirklichkeit die Form einer untheilbaren Gegenwart zwischen zwei unendlichen Zeiten hat. Demnach sollten wir die Erwerbung und Beförderung dieses Gutes jedem andern Trachten vorsetzen. Nun ist gewiß, daß zur Heiterkeit nichts weniger beiträgt, als Reichthum, und nichts mehr, als Gesundheit: in den niedrigen, arbeitenden, zumal das Land bestellenden Klassen, sind die heitern und zufriedenen Gesichter; in den reichen und vornehmen die verdrießlichen zu Hause. Folglich sollten wir vor Allem bestrebt seyn, uns den hohen Grad vollkommener Gesundheit zu erhalten, als dessen Blüthe die Heiterkeit sich einstellt. Die Mittel hiezu sind bekanntlich Vermeidung aller Excesse und Ausschweifungen, aller heftigen und unangenehmen Gemüthsbewegungen, auch aller zu großen oder zu anhaltenden Geistesanstrengung, täglich wenigstens zwei Stunden rascher Bewegung in freier Luft, viel kaltes Baden und ähnliche diätetische Maaßregeln. Wie sehr unser Glück von der Heiterkeit der Stimmung und diese vom Gesundheitszustande abhängt, lehrt die Vergleichung des Eindrucks, den die nämlichen äußern Verhältnisse, oder Vorfälle, am gesunden und rüstigen Tage auf uns machen, mit dem, welchen sie hervorbringen, wann Kränklichkeit uns verdrießlich und ängstlich gestimmt hat. Nicht was die Dinge objektiv und wirklich sind, sondern was sie für uns, in unsrer Auffassung, sind, macht uns glücklich oder unglücklich: Dies eben besagt Epiktets ταρασσϵι τους ανϑρωπους ου τα πραγατα, αλλα τα πϵρι των πραγματων δογματα (commovent homines non res, sed de rebus opiniones). Ueberhaupt aber beruhen %o unsers Glückes allein auf der Gesundheit. Mit ihr wird Alles eine Quelle des Genusses: hingegen ist ohne sie kein äußeres Gut, welcher Art es auch sei, genießbar, und selbst die übrigen subjektiven Güter, die Eigenschaften des Geistes, Gemüthes, Temperaments, werden durch Kränklichkeit herabgestimmt und sehr verkümmert. Demnach geschieht es nicht ohne Grund, daß man, vor allen Dingen, sich gegenseitig nach dem Gesundheitszustande befrägt und einander sich wohlzubefinden wünscht: denn wirklich ist Dieses bei Weitem die Hauptsache zum menschlichen Glück. Hieraus aber folgt, daß die größte aller Thorheiten ist, seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei, für Erwerb, für Beförderung, für Gelehrsamkeit, für Ruhm, geschweige für Wollust und flüchtige Genüsse: vielmehr soll man ihr Alles nachsetzen.
So viel nun aber auch zu der, für unser Glück so wesentlichen Heiterkeit die Gesundheit beiträgt, so hängt jene doch nicht von dieser allein ab: denn auch bei vollkommener Gesundheit kann ein melancholisches Temperament und eine vorherrschend trübe Stimmung bestehn. Der letzte Grund davon liegt ohne Zweifel in der ursprünglichen und daher unabänderlichen Beschaffenheit des Organismus, und zwar zumeist in dem mehr oder minder normalen Verhältniß der Sensibilität zur Irritabilität und Reproduktionskraft. Abnormes Uebergewicht der Sensibilität wird Ungleichheit der Stimmung, periodische übermäßige Heiterkeit und vorwaltende Melancholie herbeiführen. Weil nun auch das Genie durch ein Uebermaaß der Nervenkraft, also der Sensibilität, bedingt ist; so hat Aristoteles ganz richtig bemerkt, daß alle ausgezeichnete und überlegene Menschen melancholisch seien: παντϵς οσοι πϵριττοι γϵγονασιν ανδρϵς, η ϰατα φιλοσοφιαν, η πολιτιϰην, η ποιησιν, η τϵχνας, φαινονται μϵλαγχολιϰοι οντϵς (Probl. 30, 1.). Ohne Zweifel ist dieses die Stelle, welche Cicero im Auge hatte, bei seinem oft angeführten Bericht: Aristoteles ait, omnes ingeniosos melancholicos esse (Tusc. 1, 33.). – Die hier in Betrachtung genommene, angebotene, große Verschiedenheit der Grund-Stimmung überhaupt aber hat SHAKESPEARE sehr artig geschildert:
Nature has fram'd stränge fellows in her time:
Some that will evermore peep through their eyes,
And laugh, like parrots, at a bag-piper,
And others of such vinegar aspect,
That they'll not show their teeth in way of smile,
Though Nestor swear the jest be laughable.[1]
Merch. of Ven. Sc. 1.
Eben dieser Unterschied ist es, den PLATO durch die Ausdrücke δυσϰολος und ϵυϰολος bezeichnet. Derselbe läßt sich zurückführen auf die bei verschiedenen Menschen sehr verschiedene Empfänglichkeit für angenehme und unangenehme Eindrücke, in Folge welcher der Eine noch lacht bei Dem, was den Andern fast zur Verzweiflung bringt: und zwar pflegt die Empfänglichkeit für angenehme Eindrücke desto schwächer zu seyn, je stärker die für unangenehme ist, und umgekehrt. Nach gleicher Möglichkeit des glücklichen und des unglücklichen Ausgangs einer Angelegenheit, wird der δυσϰολος beim unglücklichen sich ärgern, oder grämen, beim glücklichen aber sich nicht freuen; der ϵυϰολο hingegen wird über den unglücklichen sich nicht ärgern, noch grämen, aber über den glücklichen sich freuen. – Wie nun aber nicht leicht ein Uebel ohne alle Kompensation ist; so ergiebt sich auch hier, daß die δυσϰολοι, also die finstern und ängstlichen Charaktere, im Ganzen, zwar mehr imaginäre, dafür aber weniger reale Unfälle und Leiden zu überstehn haben werden, als die heitern und sorglosen: denn wer Alles schwarz sieht, stets das Schlimmste befürchtet und demnach seine Vorkehrungen trifft, wird sich nicht so oft verrechnet haben, als wer stets den Dingen die heitere Farbe und Aussicht leiht. – Wann jedoch eine krankhafte Affektion des Nervensystems, oder der Verdauungswerkzeuge, der angeborenen δυσϰολια in die Hände arbeitet; dann kann diese den hohen Grad erreichen, wo dauerndes Mißbehagen Lebensüberdruß erzeugt und demnach Hang zum Selbstmord entsteht. Diesen vermögen alsdann selbst die geringsten Unannehmlichkeiten zu veranlassen; ja, bei den höchsten Graden des Uebels, bedarf es derselben nicht ein Mal; sondern bloß in Folge des anhaltenden Mißbehagens wird der Selbstmord beschlossen und alsdann mit so kühler Ueberlegung und fester Entschlossenheit ausgeführt, daß der meistens schon unter Aufsicht gestellte Kranke, stets darauf gerichtet, den ersten unbewachten Augenblick benutzt, um, ohne Zaudern, Kampf und Zurückbeben, jenes ihm jetzt natürliche und willkommene Erleichterungsmittel zu ergreifen. Ausführliche Beschreibungen dieses Zustandes giebt Esquirol, des maladies mentales. Allerdings aber kann, nach Umständen, auch der gesundeste und vielleicht selbst der heiterste Mensch sich zum Selbstmord entschließen, wenn nämlich die Größe der Leiden, oder des unausweichbar herannahenden Unglücks, die Schrecken des Todes überwältigt. Der Unterschied liegt allein in der Größe des dazu erforderlichen Anlasses, als welche mit der δυσϰολια in umgekehrtem Verhältniß steht. Je größer diese ist, desto geringer kann jener seyn, ja am Ende auf Null herabsinken: je größer hingegen die ϵυϰολια und die sie unterstützende Gesundheit, desto mehr muß im Anlaß liegen. Danach giebt es unzählige Abstufungen der Fälle, zwischen den beiden Extremen des Selbstmordes, nämlich dem des rein aus krankhafter Steigerung der angebornen δυσϰολια entspringenden, und dem des Gesunden und Heiteren, ganz aus objektiven Gründen.
Der Gesundheit zum Theil verwandt ist die Schönheit. Wenn gleich dieser subjektive Vorzug nicht eigentlich unmittelbar zu unserm Glücke beiträgt, sondern bloß mittelbar, durch den Eindruck auf Andere; so ist er doch von großer Wichtigkeit, auch im Manne. Schönheit ist ein offener Empfehlungsbrief, der die Herzen zum Voraus für uns gewinnt: daher gilt besonders von ihr der Homerische Vers:
Ουτοι αποβλητ' ϵστι ϑϵων ϵριϰυδϵα δωρα, 'Οσσα ϰϵν αυτοι δωσι, ϵϰων δ' ουϰ αν τις ϵλοιτο.
Der allgemeinste Ueberblick zeigt uns, als die beiden Feinde des menschlichen Glückes, den Schmerz und die Langeweile. Dazu noch läßt sich bemerken, daß, in dem Maaße, als es uns glückt, vom einen derselben uns zu entfernen, wir dem andern uns nähern, und umgekehrt; so daß unser Leben wirklich eine stärkere, oder schwächere Oscillation zwischen ihnen darstellt. Dies entspringt daraus, daß Beide in einem doppelten Antagonismus zu einander stehn, einem äußern, oder objektiven, und einem innern, oder subjektiven. Aeußerlich nämlich gebiert Noth und Entbehrung den Schmerz; hingegen Sicherheit und Ueberfluß die Langeweile. Demgemäß sehn wir die niedere Volksklasse in einem beständigen Kampf gegen die Noth, also den Schmerz; die reiche und vornehme Welt hingegen in einem anhaltenden, oft wirklich verzweifelten Kampf gegen die Langeweile. Der innere, oder subjektive Antagonismus derselben aber beruht darauf, daß, im einzelnen Menschen, die Empfänglichkeit für das Eine in entgegengesetztem Verhältniß zu der für das Andere steht, indem sie durch das Maaß seiner Geisteskräfte bestimmt wird. Nämlich Stumpfheit des Geistes ist durchgängig im Verein mit Stumpfheit der Empfindung und Mangel an Reizbarkeit, welche Beschaffenheit für Schmerzen und Betrübnisse jeder Art und Größe weniger empfänglich macht: aus eben dieser Geistesstumpfheit aber geht andrerseits jene, auf zahllosen Gesichtern ausgeprägte, wie auch durch die beständig rege Aufmerksamkeit auf alle, selbst die kleinsten Vorgänge in der Außenwelt sich verrathende INNERE LEERHEIT hervor, welche die wahre Quelle der Langenweile ist und stets nach äußerer Anregung lechzt, um Geist und Gemüth durch irgend etwas in Bewegung zu bringen. In der Wahl desselben ist sie daher nicht ekel; wie Dies die Erbärmlichkeit der Zeitvertreibe bezeugt, zu denen man Menschen greifen sieht, imgleichen die Art ihrer Geselligkeit und Konversation, nicht weniger die vielen Thürsteher und Fensterkucker. Hauptsächlich aus dieser inneren Leerheit entspringt die Sucht nach Gesellschaft, Zerstreuung, Vergnügen und Luxus jeder Art, welche Viele zur Verschwendung und dann zum Elende führt. Vor diesem Abwege bewahrt nichts so sicher, als der INNERE Reichthum, der Reichthum des Geistes: denn dieser läßt, je mehr er sich der Eminenz nähert, der Langenweile immer weniger Raum. Die unerschöpfliche Regsamkeit der Gedanken aber, ihr an den manigfaltigen Erscheinungen der Innen- und Außenwelt sich stets erneuerndes Spiel, die Kraft und der Trieb zu immer andern Kombinationen derselben, setzen den eminenten Kopf, die Augenblicke der Abspannung abgerechnet, ganz außer dem Bereich der Langenweile. Andrerseits nun aber hat die gesteigerte Intelligenz eine erhöhte Sensibilität zur unmittelbaren Bedingung, und größere Heftigkeit des Willens, also der Leidenschaftlichkeit, zur Wurzel: aus ihrem Verein mit diesen erwächst nun eine viel größere Stärke aller Affekte und eine gesteigerte Empfindlichkeit gegen die geistigen und selbst gegen körperliche Schmerzen, sogar größere Ungeduld bei allen Hindernissen, oder auch nur Störungen; welches alles zu erhöhen die aus der Stärke der Phantasie entspringende Lebhaftigkeit sämmtlicher Vorstellungen, also auch der widerwärtigen, mächtig beiträgt. Das Gesagte gilt nun verhältnißmäßig von allen den Zwischenstufen, welche den weiten Raum vom stumpfesten Dummkopf bis zum größten Genie ausfüllen. Demzufolge steht Jeder, wie objektiv, so auch subjektiv, der einen Quelle der Leiden des menschlichen Lebens um so näher, als er von der andern entfernter ist. Dem entsprechend wird sein natürlicher Hang ihn anleiten, in dieser Hinsicht, das Objektive dem Subjektiven möglichst anzupassen, also gegen DIE Quelle der Leiden, für welche er die größe re Empfänglichkeh hat, die größere Vorkehr zu treffen. Der geistreiche Mensch wird vor Allem nach Schmerzlosigkeit, Ungehudeltseyn, Ruhe und Muße streben, folglich ein stilles, bescheidenes, aber möglichst unangefochtenes Leben suchen und demgemäß, nach einiger Bekanntschaft mit den sogenannten Menschen, die Zurückgezogenheit und, bei großem Geiste, sogar die Einsamkeit wählen. Denn je mehr Einer an sich selber hat, desto weniger bedarf er von außen und desto weniger können auch die Uebrigen ihm seyn. Darum führt die Eminenz des Geistes zur Ungeselligkeit. Ja, wenn die Qualität der Gesellschaft sich durch die Quantität ersetzen ließe; da wäre es der Mühe werth, sogar in der großen Welt zu leben: aber leider geben hundert Narren, auf Einem Haufen, noch keinen gescheuten Mann. – Der vom andern Extrem hingegen wird, sobald die Noth ihn zu Athem kommen läßt, Kurzweil und Gesellschaft, um jeden Preis, suchen und mit Allem leicht vorlieb nehmen, nichts so sehr fliehend, wie sich selbst. Denn in der Einsamkeit, als wo jeder auf sich selbst zurückgewiesen ist, da zeigt sich, was er AN SICH SELBER hat: da seufzt der Tropf im Purpur unter der unabwälzbaren Last seiner armsäligen Individualität; während der Hochbegabte die ödeste Umgebung mit seinen Gedanken bevölkert und belebt. Daher ist sehr wahr, was SENEKA sagt: omnis stultitia laborat fastidio sui (ep. 9); wie auch Jesus Sirachs Ausspruch: »des Narren Leben ist ärger, denn der Tod.« Demgemäß wird man, im Ganzen, finden, daß Jeder in dem Maaße gesellig ist, wie er geistig arm und überhaupt gemein ist. Denn man hat in der Welt nicht viel mehr, als die Wahl zwischen Einsamkeit und Gemeinheit. Die geselligsten aller Menschen sollen die Neger seyn, wie sie eben auch intellektuell entschieden zurückstehn: nach Berichten aus Nord-Amerika, in Französischen Zeitungen (le Commerce, Octbr. 19, 1837), sperren die Schwarzen, Freie und Sklaven durcheinander, in großer Anzahl, sich in den engsten Raum zusammen, weil sie ihr schwarzes Stumpfnasengesicht nicht oft genug wiederholt erblicken können.
Dem entsprechend, daß das Gehirn als der Parasit, oder Pensionair, des ganzen Organismus auftritt, ist die errungene FREIE MUSSE eines Jeden, indem sie ihm den freien Genuß seines Bewußtseyns und seiner Individualität giebt, die Frucht und der Ertrag seines gesammten Daseyns, welches im Uebrigen nur Mühe und Arbeit ist. Was nun aber wirft die freie Muße der meisten Menschen ab? Langeweile und Dumpfheit, so oft nicht sinnliche Genüsse, oder Albernheiten da sind, sie auszufüllen: sie ist eben das ozio lungo duomini ignoranti des Ariosto. Daher ist, in allen Ländem, die Hauptbeschäftigung aller Gesellschaft das Kartenspiel geworden: es ist der Maaßstab des Werthes derselben und der deklarirte Bankrott an allen Gedanken. Weil sie nämlich keine Gedanken auszutauschen haben, tauschen sie Karten aus und suchen einander Gulden abzunehmen. O, klägliches Geschlecht! Um indessen auch hier nicht ungerecht zu seyn, will ich den Gedanken nicht unterdrücken, daß man zur Entschuldigung des Kartenspiels allenfalls anführen könnte, es sei eine Vorübung zum Welt- und Geschäftsleben, sofern man dadurch lernt, die vom Zufall unabänderlich gegebenen Umstände (Karten) klug zu benutzen, um daraus was immer angeht zu machen, zu welchem Zwecke man sich denn auch gewöhnt, Contenance zu halten, indem man zum schlechten Spiel eine heitere Miene aufsetzt. – Weil also, wie gesagt, die FREIE MUSSE die Blüthe, oder vielmehr die Frucht des Daseyns eines Jeden ist, indem nur sie ihn in den Besitz seines eigenen Selbst einsetzt, so sind Die glücklich zu preisen, welche dann auch etwas Rechtes an sich selber erhalten; während den Allermeisten die freie Muße nichts abwirft, als einen Kerl, mit dem nichts anzufangen ist, der sich schrecklich langweilt, sich selber zur Last. Demnach freuen wir uns, »ihr lieben Brüder, daß wir nicht sind der Magd Kinder, sondern der Freien.« (Gal. 4, 31.)
Ferner, wie das Land am glücklichsten ist, welches weniger, oder keiner, Einfuhr bedarf; so auch der Mensch, der an seinem innern Reichthum genug hat und zu seiner Unterhaltung wenig, oder nichts, von außen nöthig hat; da dergleichen Zufuhr viel kostet, abhängig macht, Gefahr bringt, Verdruß verursacht und am Ende doch nur ein schlechter Ersatz ist für die Erzeugnisse des eigenen Bodens. Denn von Andern, von außen überhaupt, darf man in keiner Hinsicht viel erwarten. Was Einer dem Andern seyn kann, hat seine sehr engen Gränzen: am Ende bleibt doch jeder allein, und da kommt es darauf an, WER jetzt allein sei. Auch hier gilt demnach, was Göthe (Dicht. u. Wahrh. Bd. 3. S. 474.) im Allgemeinen ausgesprochen hat, daß, in allen Dingen, jeder zuletzt auf sich selbst zurückgewiesen wird. Das Beste und Meiste muß daher Jeder sich selber seyn und leisten. Je mehr nun Dieses ist, und je mehr demzufolge er die Quellen seiner Genüsse in sich selbst findet, desto glücklicher wird er seyn. Mit größtem Rechte also sagt Aristoteles: η ϵυδαιμονια των αυταρϰων ϵστι (Eth. Eud. VII, 2.), zu deutsch: das Glück gehört Denen, die sich selber genügen. Denn alle äußern Quellen des Glückes und Genusses sind, ihrer Natur nach, höchst unsicher, mißlich, vergänglich und dem Zufall unterworfen, dürften daher, selbst unter den günstigsten Umständen, leicht stocken; ja, Dieses ist unvermeidlich, sofern sie doch nicht stets zur Hand seyn können. Im Alter nun gar ver siegen sie fast alle nothwendig: denn da verläßt uns Liebe, Scherz, Reiselust, Pferdelust und Tauglichkeit für die Gesellschaft: sogar die Freunde und Verwandten entführt uns der Tod. Da kommt es denn, mehr als je, darauf an, was Einer an sich selber habe. Denn Dieses wird am längsten Stich halten. Aber auch in jedem Alter ist und bleibt es die ächte und allein ausdauernde Quelle des Glücks. Ist doch in der Welt überall nicht viel zu holen: Noth und Schmerz erfüllen sie, und auf Die, welche diesen entronnen sind, lauert in allen Winkeln die Langeweile. Zudem hat in der Regel die Schlechtigkeit die Herrschaft darin und die Thorheit das große Wort. Das Schicksal ist grausam und die Menschen sind erbärmlich. In einer so beschaffenen Welt gleicht Der, welcher viel an sich selber hat, der hellen, warmen, lustigen Weihnachtsstube, mitten im Schnee und Eise der Decembernacht. Demnach ist eine vorzügliche, eine reiche Individualität und besonders sehr viel Geist zu haben ohne Zweifel das glücklichste Loos auf Erden; so verschieden es etwan auch von dem glänzendesten ausgefallen seyn mag. Nur müssen die äußern Umstände es soweit begünstigen, daß man auch sich selbst besitzen und seiner froh werden könne; weshalb schon Koheleth (7, 12.) sagt: »Weisheit ist gut mit einem Erbgut, und hilft, daß Einer sich der Sonne freuen kann.« Wem nun, durch Gunst der Natur und des Schicksals, dieses Loos beschieden ist, der wird mit ängstlicher Sorgfalt darüber wachen, daß die innere Quelle seines Glückes ihm zugänglich bleibe; wozu Unabhängigkeit und Muße die Bedingungen sind. Diese wird er daher gern durch Mäßigkeit und Sparsamkeit erkaufen; um so mehr, als er nicht, gleich den Andern, auf die äußern Quellen der Genüsse verwiesen ist. Darum wird die Aussicht auf Aemter, Geld, Gunst und Beifall der Welt, ihn nicht verleiten, sich selber aufzugeben, um den niedrigen Absichten, oder dem schlechten Geschmacke, der Menschen sich zu fügen. Vorkommenden Falls wird er es machen wie HORAZ in der Epistel an den Mäcenas (Lib. I, ep . 7.).
Die hier erörterte Wahrheit, daß die Hauptquelle des menschlichen Glückes im eigenen Innern entspringt, findet ihre Bestätigung auch an der sehr richtigen Bemerkung des ARISTOTELES, in der Nikomachäischen Ethik (I, 7; et VII, 13, 14), daß jeglicher Genuß irgend eine Aktivität, also die Anwendung irgend einer Kraft voraussetzt und ohne solche nicht bestehn kann. Nun ist die ursprüngliche Bestimmung der Kräfte, mit welchen die Natur den Menschen ausgerüstet hat, der Kampf gegen die Noth, die ihn von allen Seiten bedrängt. Wenn aber dieser Kampf ein Mal rastet, da werden ihm die unbeschäftigten Kräfte zur Last: er muß daher jetzt mit ihnen SPIELEN, d. h. sie zwecklos ge brauchen: denn sonst fällt er der andern Quelle des menschlichen Leidens, der Langenweile, sogleich anheim. Von dieser sind daher vor Allen die Großen und Reichen gemartert, und hat von ihrem Elend schon Lukretius eine Schilderung gegeben, deren Treffendes zu erkennen man noch heute, in jeder großen Stadt, täglich Gelegenheit findet:
Exit saepe foras magnis ex aedibus ille, Esse domi quem penaesum est, subitoque reventat; Quippe foris nihilo melius qui sentiat esse. Currit, agens mannos, ad villam praecipitanter, Auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans: Oscitat extemplo, tetigit quum limina viliae; Aut abit in somnum gravis, atque oblivia quaerit; Aut etiam properans urbem petit, atque revisit.
III, 1073.
Bei diesen Herren muß in der Jugend die Muskelkraft und die Zeugungskraft herhalten. Aber späterhin bleiben nur die Geisteskräfte: fehlt es dann an diesen, oder an ihrer Ausbildung und dem angesammelten Stoffe zu ihrer Thätigkeit; so ist der Jammer groß. Weil nun der WILLE die einzige unerschöpfliche Kraft ist; so wird er jetzt angereizt durch Erregung der Leidenschaften, z. B. durch hohe Hasardspiele, dieses wahrhaft degradirende Laster. – Ueberhaupt aber wird jedes unbeschäftigte Individuum, je nach der Art der in ihm verwaltenden Kräfte, sich ein Spiel zu ihrer Beschäftigung wählen: etwan Kegel, oder Schach; Jagd, oder Malerei; Wettrennen, oder Musik; Kartenspiel, oder Poesie; Heraldik, oder Philosophie, u.s.w. Wir können sogar die Sache methodisch untersuchen, indem wir auf die Wurzel aller menschlichen Kraftäußerungen zurückgehn, also auf die DREI PHYSIOLOGISCHEN GRUNDKRÄFTE, welche wir demnach hier in ihrem zwecklosen Spiele zu betrachten haben, in welchem sie als die Quellen dreier Arten möglicher Genüsse auftreten, aus denen jeder Mensch, je nachdem die eine, oder die andere jener Kräfte in ihm vorwaltet, die ihm angemessene erwählen wird. Also zuerst, die Genüsse der REPRODUKTIONSKRAFT: sie bestehn im Essen, Trinken, Verdauen, Ruhen und Schlafen. Diese werden daher sogar ganzen Völkern als ihre Nationalvergnügungen von den andern nachgerühmt. Zweitens die Genüsse der IRRITABILITÄT: sie bestehn im Wandern, Springen, Ringen, Tanzen, Fechten, Reiten und athletischen Spielen jeder Art, wie auch in der Jagd und sogar im Kampf und Krieg. Drittens, die Genüsse der SENSIBILITÄT: sie bestehn im Beschauen, Denken, Empfinden, Dichten, Bilden, Musici ren, Lernen, Lesen, Meditiren, Erfinden, Philosophiren u. s.w. – Ueber den Werth, den Grad, die Dauer jeder dieser Arten der Genüsse lassen sich mancherlei Betrachtungen anstellen, die dem Leser selbst überlassen bleiben. Jedem aber wird dabei einleuchten, daß unser, allemal durch den Gebrauch der eigenen Kräfte bedingter Genuß und mithin unser, in dessen häufiger Wiederkehr bestehendes Glück, um so größer seyn wird, je edlerer Art die ihn bedingende Kraft ist. Den Vorrang, welchen, in dieser Hinsicht, die Sensibilität, deren entschiedenes Ueberwiegen das Auszeichnende des Menschen vor den übrigen Thiergeschlechtern ist, vor den beiden andern physiologischen Grundkräften hat, als welche in gleichem und sogar in höherem Grade den Thieren einwohnen, wird ebenfalls Niemand ableugnen. Der Sensibilität gehören unsere Erkenntnißkräfte an: daher befähigt das Ueberwiegen derselben zu den im ERKENNEN bestehenden, also den sogenannten GEISTIGEN Genüssen, und zwar zu um so größeren, je entschiedener jenes Ueberwiegen ist. Dem normalen, gewöhnlichen Menschen kann eine Sache allein dadurch lebhafte Theilnahme abgewinnen, daß sie seinen WILLEN anregt, also ein persönliches Interesse für ihn hat. Nun ist aber jede anhaltende Erregung des WILLENS wenigstens gemischter Art, also mit Schmerz verknüpft. Ein absichtliches Erregungsmittel desselben, und zwar mittelst so kleiner Interessen, daß sie nur momentane und leichte, nicht bleibende und ernstliche Schmerzen verursachen können, sonach als ein bloßes Kitzeln des Willens zu betrachten sind, ist das Kartenspiel, diese durchgängige Beschäftigung der »guten Gesellschaft«, aller Orten. – Der Mensch von überwiegenden Geisteskräften hingegen ist der lebhaftesten Theilnahme auf dem Wege bloßer ERKENNTNISS, ohne alle Einmischung des WILLENS, fähig, ja bedürftig. Diese Theilnahme aber versetzt ihn alsdann in eine Region, welcher der Schmerz wesentlich fremd ist, gleichsam in die Atmosphäre der leicht lebenden Götter, ϑέων ρϵια ζωοντων Während demnach das Leben der Uebrigen in Dumpfheit dahingeht, indem ihr Dichten und Trachten gänzlich auf die kleinlichen Interessen der persönlichen Wohlfahrt und dadurch auf Miseren aller Art gerichtet ist, weshalb unerträgliche Langeweile sie befällt, sobald die Beschäftigung mit jenen Zwecken stockt und sie auf sich selbst zurückgewiesen werden, indem nur das wilde Feuer der Leidenschaft einige Bewegung in die stockende Masse zu bringen vermag; so hat dagegen der mit überwiegenden Geisteskräften ausgestattete Mensch ein gedankenreiches, durchweg belebtes und bedeutsames Daseyn: würdige und interessante Gegenstände beschäftigen ihn, sobald er sich ihnen überlassen darf, und in sich selbst trägt er eine Quelle der edelsten Genüsse.
Anregung von außen geben ihm die Werke der Natur und der Anblick des menschlichen Treibens, sodann die so verschiedenartigen Leistungen der Hochbegabten aller Zeiten und Länder, als welche eigentlich nur ihm ganz genießbar, weil nur ihm ganz verständlich und fühlbar sind. Für ihn demnach haben jene wirklich gelebt, an ihn haben sie sich eigentlich gewendet; während die Uebrigen nur als zufällige Zuhörer Eines und das Andere halb auffassen. Freilich aber hat er durch dieses Alles ein Bedürfniß mehr, als die Andern, das Bedürfniß zu lernen, zu sehn, zu studiren, zu meditiren, zu üben, folglich auch das Bedürfniß freier Muße: aber eben weil, wie VOLTAIRE richtig bemerkt, iln'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins, so ist dies Bedürfniß die Bedingung dazu, daß ihm Genüsse offen stehn, welche den Andern versagt bleiben, als welchen Natur- und Kunstschönheiten und Geisteswerke jeder Art, selbst wenn sie solche um sich anhäufen, im Grunde doch nur Das sind, was Hetären einem Greise. Ein so bevorzugter Mensch führt, in Folge davon, neben seinem persönlichen Leben, noch ein zweites, nämlich ein intellektuelles, welches ihm allmälig zum eigentlichen Zweck wird, zu welchem er jenes erstere nur noch als Mittel ansieht; während den Uebrigen dieses schaale, leere und betrübte Daseyn selbst als Zweck gelten muß. Jenes intellektuelle Leben wird daher ihn vorzugsweise beschäftigen, und es erhält, durch den fortwährenden Zuwachs an Einsicht und Erkenntniß, einen Zusammenhang, eine beständige Steigerung, eine sich mehr und mehr abrundende Ganzheit und Vollendung, wie ein werdendes Kunstwerk; wogegen das bloß praktische, bloß auf persönliche Wohlfahrt gerichtete, bloß eines Zuwachses in der Länge, nicht in der Tiefe fähige Leben der Andern traurig absticht, dennoch ihnen, wie gesagt, als Selbstzweck gelten muß; während es jenem bloßes Mittel ist.
Unser praktisches, reales Leben nämlich ist, wenn nicht die Leidenschaften es bewegen, langweilig und fade; wenn sie aber es bewegen, wird es bald schmerzlich: darum sind Die allein beglückt, denen irgend ein Ueberschuß des Intellekts, über das zum Dienst ihres Willens erforderte Maaß, zu Theil geworden. Denn damit führen sie, neben ihrem wirklichen, noch ein intellektuelles Leben, welches sie fortwährend auf eine SCHMERZLOSE Weise und doch lebhaft beschäftigt und unterhält. Bloße MUSSE, d.h. durch den Dienst des Willens UNBESCHÄFTIGTER Intellekt, reicht dazu nicht aus; sondern ein wirklicher Ueberschuß der KRAFT ist erfordert: denn nur dieser befähigt zu einer dem Willen nicht dienenden, rein geistigen Beschäftigung: hingegen otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura (Sen. ep. 82). Je nachdem nun aber dieser Ueberschuß klein oder groß ist, giebt es unzählige Abstufungen jenes, neben dem realen zu führenden intellektuellen Lebens, vom bloßen Insekten-, Vögel-, Mineralien-, Münzen-Sammeln und Beschreiben, bis zu den höchsten Leistungen der Poesie und Philosophie. Nebenbei wird ein solches intellektuelles Leben auch noch eine Schutzwehr gegen die vielen Gefahren, Unglücksfälle, Verlüste und Verschwendungen, in die man geräth, wenn man sein Glück ganz in der realen Welt sucht. So hat z. B. mir meine Philosophie nie etwas eingebracht; aber sie hat mir sehr viel erspart.
Der normale Mensch hingegen ist, hinsichtlich des Genusses seines Lebens, auf Dinge AUSSER IHM gewiesen, auf den Besitz, den Rang, auf Weib und Kinder, Freunde, Gesellschaft u. s. w., auf diese stützt sich sein Lebensglück: darum fällt es dahin, wenn er sie verliert, oder er sich in ihnen getäuscht sah. Dies Verhältniß auszudrücken, können wir sagen; daß sein Schwerpunkt AUSSER IHM fällt. Eben deshalb hat er auch stets wechselnde Wünsche und Grillen: er wird, wenn seine Mittel es erlauben, bald Landhäuser, bald Pferde kaufen, bald Feste geben, bald Reisen machen, überhaupt aber großen Luxus treiben; weil er eben in Dingen aller Art ein Genüge VON AUSSEN sucht; wie der Entkräftete aus Consomme's und Apothekerdrogen die Gesundheit und Stärke zu erlangen hofft, deren wahre Quelle die eigene Lebenskraft ist. Stellen wir nun, um nicht gleich zum andern Extrem überzugehn, neben ihn einen Mann von nicht gerade eminenten, aber doch das gewöhnliche, knappe Maaß überschreitenden Geisteskräften; so sehn wir diesen etwan irgend eine schöne Kunst als Dilettant üben, oder aber eine Realwissenschaft, wie Botanik, Mineralogie, Physik, Astronomie, Geschichte, u. dgl. betreiben und alsbald einen großen Theil seines Genusses darin finden, sich daran erholend, wenn jene äußern Quellen stocken, oder ihn nicht mehr befriedigen. Wir können insofern sagen, daß sein Schwerpunkt schon zum Theil IN IHN SELBST fällt. Weil jedoch bloßer Dilettantismus in der Kunst noch sehr weit von der hervorbringenden Fähigkeit liegt, und weil bloße Realwissenschaften bei den Verhältnissen der Erscheinungen zu einander stehn bleiben; so kann der ganze Mensch nicht darin aufgehn, sein ganzes Wesen kann nicht bis auf den Grund von ihnen erfüllt werden und daher sein Daseyn sich nicht mit ihnen so verweben, daß er am Uebrigen alles Interesse verlöre. Dies nun bleibt der höchsten geistigen Eminenz allein vorbehalten, die man mit dem Namen des Genie's zu bezeichnen pflegt: denn nur sie nimmt das Daseyn und Wesen der Dinge im Ganzen und absolut zu ihrem Thema; wonach sie dann ihre tiefe Auffassung desselben, gemäß ihrer individuellen Richtung, durch Kunst, Poesie, oder Philosophie auszusprechen streben wird. Daher ist allein einem Menschen dieser Art die ungestörte Beschäftigung mit sich, mit seinen Gedanken und Werken dringendes Bedürfniß, Einsamkeit willkommen, freie Muße das höchste Gut, alles Uebrige entbehrlich, ja, wenn vorhanden, oft nur zur Last. Nur von einem solchen Menschen können wir demnach sagen, daß sein Schwerpunkt GANZ IN IHN fällt. Hieraus wird sogar erklärlich, daß die höchst seltenen Leute dieser Art, selbst beim besten Charakter, doch nicht jene innige und gränzenlose Theilnahme an Freunden, Familie und Gemeinwesen zeigen, deren Manche der Andern fähig sind: denn sie können sich zuletzt über Alles trösten; wenn sie nur sich selbst haben. Sonach liegt in ihnen ein isolirendes Element mehr, welches um so wirksamer ist, als die Andern ihnen eigentlich nie vollkommen genügen, weshalb sie in ihnen nicht ganz und gar ihres Gleichen sehn können, ja, da das Heterogene in Allem und Jedem ihnen stets fühlbar wird, allmälig sich gewöhnen, unter den Menschen als verschiedenartige Wesen umherzugehn und, in ihren Gedanken über dieselben, sich der dritten, nicht der ersten Person Pluralis zu bedienen. –
Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint nun Der, welchen die Natur in intellektueller Hinsicht sehr reich ausgestattet hat, als der Glücklichste; so gewiß das Subjektive uns näher liegt, als das Objektive, dessen Wirkung, welcher Art sie auch sei, immer erst durch Jenes vermittelt, also nur sekundär ist. Dies bezeugt auch der schöne Vers:
Πλούτος o της ψυχής πλουτος μονος ϵστιν αληϑής Τ'αλλα δ'ϵχϵι ατην πλϵιονα των ϰτϵανων.
Lucian in Anthol. 1, 67.
Ein solcher innerlich Reicher bedarf von außen nichts weiter, als eines negativen Geschenks, nämlich freier Muße, um seine geistigen Fähigkeiten ausbilden und entwickeln und seinen innern Reichthum genießen zu können, also eigentlich nur der Erlaubniß, sein ganzes Leben hindurch, jeden Tag und jede Stunde, ganz er selbst seyn zu dürfen. Demgemäß sehn wir die großen Geister aller Zeiten auf freie Muße den allerhöchsten Werth legen. Δοϰϵι δϵ η ϵυδαιμονια ϵν τη σχολη ϵιναι (videtur beatitudo in otio esse sita) sagt ARISTOTELES (Eth. Nie. X, 7.), und Diogenes Laertius (II, 5, 31.) berichtet, daß Σωϰρατης ϵπηνϵι σχολην, ως ϰαλλιστον ϰτηματων (Socrates otium ut possessionum omnium pulcherrimam laudabat). Dem entspricht auch, daß Aristoteles (Eth. Nie. X, 7, 8, 9.) das philosophische Leben für das glücklichste erklärt. Sogar gehört hieher, was er in der Politik (IV, 11.) sagt: τον ϵυδαιμονα βιον ϵιναι τον ϰατ' αρϵτην ανϵμποδιστον, welches, gründlich übersetzt, besagt: »seine Trefflichkeit, welcher Art sie auch sei, ungehindert üben zu können, ist das eigentliche Glück«, und also zusammentrifft mit GÖTHE's Ausspruch, im Wilh. Meister: »wer mit einem Talent, zu einem Talent geboren ist, findet in demselben sein schönstes Daseyn.« – Nun aber ist freie Muße zu besitzen nicht nur dem gewöhnlichen Schicksal, sondern auch der gewöhnlichen Natur des Menschen fremd: denn seine natürliche Bestimmung ist, daß er seine Zeit mit Herbeischaffung des zu seiner und seiner Familie Existenz Nothwendigen zubringe. Er ist ein Sohn der Noth, nicht eine freie Intelligenz. Dem entsprechend, wird freie Muße dem gewöhnlichen Menschen bald zur Last, ja, endlich zur Quaal, wenn er sie nicht, mittelst allerlei erkünstelter und fingirter Zwecke, durch Spiel, Zeitvertreib und Steckenpferde jeder Gestalt auszufüllen vermag: auch bringt sie ihm, aus dem selben Grunde, Gefahr, da es mit Recht heißt difficilis in otio quies. Andrerseits jedoch ist ein über das normale Maaß weit hinausgehender Intellekt ebenfalls abnorm, also unnatürlich. Ist er dennoch ein Mal vorhanden, so bedarf es, für das Glück des damit Begabten, eben jener den Andern bald lästigen, bald verderblichen freien Muße; da er ohne diese ein Pegasus im Joche, mithin unglücklich seyn wird. Treffen nun aber beide Unnatürlichkeiten, die äußere und die innere, zusammen; so ist es ein großer Glücksfall: denn jetzt wird der so Begünstigte ein Leben höherer Art führen, nämlich das eines Eximirten von den beiden entgegengesetzten Quellen des menschlichen Leidens, der Noth und der Langenweile, oder dem sorglichen Treiben für die Existenz und der Unfähigkeit, die Muße (d.i. die freie Existenz selbst) zu ertragen, welchen beiden Uebeln der Mensch sonst nur dadurch entgeht, daß sie selbst sich wechselseitig neutralisiren und aufheben.
Gegen dieses Alles jedoch kommt andrerseits in Betracht, daß die großen Geistesgaben, in Folge der überwiegenden Nerventhätigkeit, eine überaus gesteigerte Empfindlichkeit für den Schmerz, in jeglicher Gestalt, herbeiführen, daß ferner das sie bedingende leidenschaftliche Temperament und zugleich die von ihnen unzertrennliche größere Lebhaftigkeit und Vollkommenheit aller Vorstellungen eine ungleich größere Heftigkeit der durch diese erregten Affekte herbeiführt, während es doch überhaupt mehr peinliche, als angenehme Affekte giebt; endlich auch, daß die großen Geistesgaben ihren Besitzer den übrigen Menschen und ihrem Treiben entfremden, und ihm hundert Dinge, an welchen diese großes Genüge haben, schaal und ungenießbar machen; daher denn das überall sich geltend machende Gesetz der Kompensation vielleicht auch hier in Kraft bleibt, ja, sogar oft genug, und nicht ohne Schein, be hauptet worden ist, der geistig beschränkteste Mensch sei im Grunde der glücklichste; wenn gleich Keiner ihn um dieses Glück beneiden mag. In der definitiven Entscheidung der Sache will ich um so weniger dem Leser vorgreifen, als selbst SOPHOKLES hierüber zwei einander diametral entgegengesetzte Aussprüche gethan hat:
Πολλω το φρονϵιν ϵυδαιμονιας πρωτον υπάρχϵι. (Sapere longe prima felicitatis pars est.)
Antig. 1328.
und wieder:
Eν τω φρονϵιν γαρ μηδϵν ηδιστος βιος. (nihil cogitantium jucundissima vita est.)
Ajax. 550.
Inzwischen will ich hier doch nicht unerwähnt lassen, daß der Mensch, welcher, in Folge des streng und knapp normalen Maaßes seiner intellektuellen Kräfte, KEINE GEISTIGE BEDÜRFNISSE HAT, es eigentlich ist, den ein der deutschen Sprache ausschließlich eigener, vom Studentenleben ausgegangener, nachmals aber in einem höheren, wiewohl dem ursprünglichen, durch den Gegensatz zum Musensohne, immer noch analogen Sinne gebrauchter Ausdruck als den PHILISTER bezeichnet. Nun würde ich zwar, von einem höhern Standpunkt aus, die Definition der Philister so aussprechen, daß sie Leute wären, die immerfort auf das Ernstlichste beschäftigt sind mit einer Realität, die keine hat. Allein eine solche, schon transscendentale Definition, würde dem populären Standpunkt, auf welchen ich mich in dieser Abhandlung gestellt habe, nicht angemessen, daher auch vielleicht nicht durchaus jedem Leser faßlich seyn. Jene erstere hingegen läßt leichter eine specielle Erläuterung zu und bezeichnet hinreichend das Wesentliche der Sache, die Wurzel aller der Eigenschaften, die den PHILISTER charakterisiren. Er ist demnach EIN MENSCH OHNE GEISTIGE BEDÜRFNISSE. Hieraus nun folgt gar mancherlei: erstlich, IN HINSICHT AUF IHN SELBST, daß er ohne geistige GENÜSSE bleibt; nach dem schon erwähnten Grundsatz: il n'est de vrais plaisirs, qu'avec de vrais besoins. Kein Drang nach Erkenntniß und Einsicht, um ihrer selbst Willen, belebt sein Daseyn, auch keiner nach eigentlich ästhetischen Genüssen, als welcher dem ersteren durchaus verwandt ist. Was dennoch von Genüssen solcher Art etwan Mode, oder Auktorität, ihm aufdringt, wird er als eine Art Zwangsarbeit möglichst kurz abthun. Wirkliche Genüsse für ihn sind allein die sinnlichen: durch diese hält er sich schadlos. Demnach sind Austern und Champagner der Höhepunkt seines Daseyns, und sich Alles, was zum leiblichen Wohlseyn beiträgt, zu verschaffen, ist der Zweck seines Lebens. Glücklich genug, wenn dieser ihm viel zu schaffen macht! Denn, sind jene Güter ihm schon zum voraus oktroyirt; so fällt er unausbleiblich der Langenweile anheim; gegen welche dann alles Ersinnliche versucht wird: Ball, Theater, Gesellschaft, Kartenspiel, Hasardspiel, Pferde, Weiber, Trinken, Reisen u. s. w. Und doch reicht dies Alles gegen die Langeweile nicht aus, wo Mangel an geistigen Bedürfnissen die geistigen Genüsse unmöglich macht. Daher auch ist dem Philister ein dumpfer, trockener Ernst, der sich dem thierischen nähert, eigen und charakteristisch. Nichts freut ihn, nichts erregt ihn, nichts gewinnt ihm Antheil ab. Denn die sinnlichen Genüsse sind bald erschöpft; die Gesellschaft, aus eben solchen Philistern bestehend, wird bald langweilig; das Kartenspiel; zuletzt ermüdend. Allenfalls bleiben ihm noch die Genüsse der Eitelkeit, nach seiner Weise, welche denn darin bestehn, daß er an Reichthum, oder Rang, oder Einfluß und Macht, Andere übertrifft, von welchen er dann deshalb geehrt wird; oder aber auch darin, daß er Wenigstens mit Solchen, die in Dergleichen eminiren, Umgang hat und so sich im Reflex ihres Glanzes sonnt (a snob). – Aus der aufgestellten Grundeigenschaft des Philisters folgt ZWEITENS, IN HINSICHT AUF ANDERE, daß, da er keine geistige, sondern nur physische Bedürfnisse hat, er Den suchen wird, der diese, nicht Den, der jene zu befriedigen im Stande ist. Am allerwenigsten wird daher unter den Anforderungen, die er an Andere macht, die irgend überwiegender geistiger Fähigkeiten seyn: vielmehr werden diese, wenn sie ihm aufstoßen, seinen Widerwillen, ja, seinen Haß erregen; weil er dabei nur ein lästiges Gefühl von Inferiorität und dazu einen dumpfen, heimlichen Neid verspürt, den er aufs Sorgfältigste versteckt, indem er ihn sogar sich selber zu verhehlen sucht, wodurch aber gerade solcher bisweilen bis zu einem stillen Ingrimm anwächst. Nimmermehr demnach wird es ihm einfallen, nach dergleichen Eigenschaften seine Werthschätzung, oder Hochachtung abzumessen; sondern diese wird ausschließlich dem Range und Reichthum, der Macht und dem Einfluß vorbehalten bleiben, als welche in seinen Augen die allein wahren Vorzüge sind, in denen zu excelliren auch sein Wunsch wäre. – Alles Dieses aber folgt daraus, daß er ein Mensch OHNE GEISTIGE BEDÜRFNISSE ist. –
Ich habe in dieser ganzen Betrachtung der persönlichen Eigenschaften, welche zu unserm Glücke beitragen, nächst den physischen, hauptsächlich die intellektuellen berücksichtigt. Auf welche Weise nun aber auch die moralische Trefflichkeit unmittelbar beglückt, habe ich früher in meiner Preisschrift über das Fundament der Moral §. 22, dargelegt, wohin ich also von hier verweise.
[1]Die Natur hat, in ihren Tagen, seltsame Käuze hervorgebracht, Einige, die stets aus ihren Aeugelein vergnügt hervorgucken und, wie Papageien über einen Dudelsackspieler lachen, und Andere von so sauertöpfischem Ansehn, daß sie ihre Zähne nicht durch ein Lächeln bloß legen, wenn auch Nestor selbst schwüre, der Spaaß sei lachenswerth.